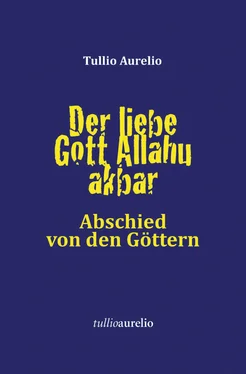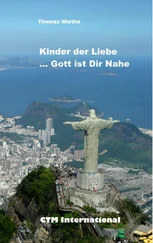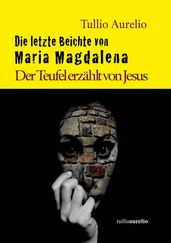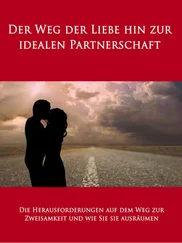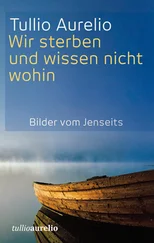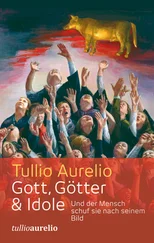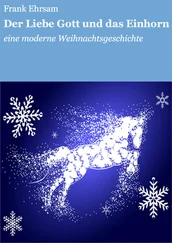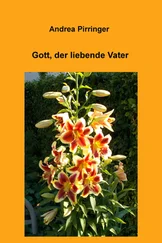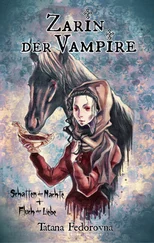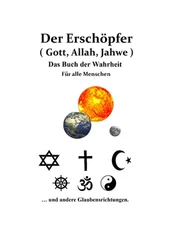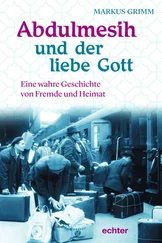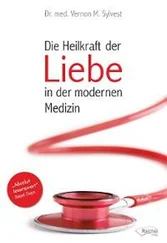Das ist ein sehr weiser Satz, der vielen Menschen, besonders den Berufstheologen und Predigern aller Art sehr ans Herz zu legen ist. Das Schweigen ist ein Zeichen, dass unsere Welt beschränkt ist, und markiert die Grenze zwischen dem Wort und dem Mystischen.
Wittgensteins Schüler dachten weiter und fragten sich, welche Funktion religiöse Satze dann haben können, wenn sie nichts über Gott aussagen. Sie kommen zum Schluss, dass religiöse Sätze Ausdruck eines Gefühls oder einer Absicht der Menschen sind.
Paul van Buren schreibt in seinem Werk ‚The Edges Of Language’: „A religious belief is neither more nor less than an intention to behave in a certain way, together with the rehearsal or remembrance of particular religious stories.„ (S. 35) Der religiöse Glaube (oder: eine religiöse Aussage) ist nichts anderes als der Ausdruck einer Absicht, sich so oder so zu verhalten, meistens verbunden mit dem Gedenken einer eigenen religiösen Tradition.
Wir kommen später auf die Sprachphilosophie erneut zurück. Hier plädiere ich weder dafür, dass sie nur Wahres, noch dafür, dass sie nur Falsches behauptet. Ich wollte hier nur die Funktion dieser philosophischen Richtung bei der Entstehung meiner Zweifel an den Aussagen über Gott schildern: Sie kann auf jeden Fall helfen, über religiöse Aussagen nachzudenken und sie analytisch in Frage zu stellen.
Was man mit der Sprachphilosophie teilen kann, ist die Auffassung, dass wir Gott nicht beschreiben können, weil wir ihn nicht kennen und mit unseren Sinnen nicht erfahren können. Das ist aber längst keine neue Erkenntnis, die der Sprachphilosophie zuzuschreiben wäre. Schon im Johannesevangelium steht: „Gott hat niemand jemals gesehen“ (Joh 1,18). Und selbst Mose durfte die Herrlichkeit Gottes nicht schauen. „Mein Angesicht kannst du nicht schauen, denn kein Mensch sieht mich und bleibt am Leben.“(Ex 33,20)
Mose hätte fragen können, ob das Sprechen mit Gott weniger gefährlich sei als dessen Angesicht anzuschauen, denn Jahwe sprach gern und lange mit Mose auf dem Berg Horeb. Das Antlitz Gottes, seine Herrlichkeit, die den Menschen und dessen Verstand blendet, ist mit dem Wesen Gottes gleichzusetzen. Der Mensch vermag das Wesen Gottes nicht zu ‚sehen’, zu ergründen, ohne daran zugrunde zu gehen. Aber auch das ist menschliche Rede über Gott.
Diese Erkenntnis ist eigentlich uralt, und dass die Menschen trotzdem meinen, über Gott allerlei sagen zu können, ist genau so alt. Mose selbst, nach der Erfahrung seiner Unfähigkeit, Gott zu erkennen, konnte sich nicht vorstellen, nicht von Gott zu erzählen. Denn er hatte lange mit ihm auf dem Berg Sinai fabuliert. Da er aber nicht das Angesicht, sondern nur den Rücken Jahwes schauen durfte, konnte er doch nicht wissen, ob die Worte, die er zu hören glaubte, tatsächlich von Jahwes Mund gesprochen wurden.
Ähnlich ist es bei den heutigen religiösen Führern, Propheten und Verkündern: Religiöse Sprache, besonders die Aussagen über Gott und seine Eigenschaften, nimmt zeitweilig den Charakter langweiliger Geschwätzigkeit an. Berufstheologen, die die Aufgabe zu haben glauben, den Menschen zu erklären, wie Gott ist und was er von den Menschen will, lassen sich von der Erkenntnis, die auch sie haben dürften, dass auch sie von Gott nichts wissen, nicht beeindrucken und den Mund verbieten.
Deshalb ist es ein sehr wichtiges Anliegen, herauszufinden, welchen Sinn, welche Funktion religiöse Sprache hat, wenn sie schon über Gott wahrscheinlich nichts aussagt. Sind unsere Aussagen über Gott, unsere Gottesbilder, lediglich Aussagen über uns, eigene Selbstbildnisse, geistige Selfies mit Blitzlicht?
Eine zweite Methode, religiöse Sprache und Bilder zu analysieren, ist, den Inhalt der religiösen Aussagen rein logisch, dialektisch und antithetisch zu hinterfragen. Man betrachtet die Rede von Gott als eine Metapher. Sie überträgt auf ein unbekanntes Wesen Eigenschaften, die Menschen der beobachtbaren Welt entnehmen. Jeder Metapher wohnt nicht nur eine bejahende Aussage, sondern auch deren Negation inne. Wenn man z.B. sagt: „Dieser Mann ist ein Bär“, meint man etwa, dass der Mann Bärenkräfte besitzt oder so aussieht wie ein Bär. Man meint allerdings keinesfalls, dass der Mann tatsächlich ein Bär ist.
Aussagen über Gott sind grundsätzlich metaphorischer Art. Sie haben einen ästhetischen, bejahenden Sinn. Wenn man ‚der liebe Gott’ sagt, fühlt man sich erfüllt von seiner Liebe und geschützt von einem höheren Wesen. Allerdings sagt uns die Wirklichkeit selbst, dass der liebe Gott nicht so lieb sein kann, wie einzelne von uns meinen. Die Wirklichkeit ist so voll von Ungereimtheiten, dass man an der Liebe Gottes für die Welt zweifeln und verzweifeln kann.
Das Ergebnis ist also nicht großartig anders als bei den Sprachphilosophen: Es bleibt an dem, was man meint, über Gott sagen zu können, nicht viel übrig.
Dass Gottes Wirken in der Welt, und zwar nicht nur naturwissenschaftlich, nicht feststellbar ist, sollte heute ziemlich allgemein anerkannt sein. Allerdings lassen sich die Menschen nicht nur von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen inspirieren: Mit Sicherheit spielt das Gefühl im Leben aller Menschen eine noch größere Rolle als Logik und rationale Erkenntnis, und das Kuschelgefühl der Geborgenheit in der Nähe und in den Armen eines als real geglaubten Gottes ist öfter stärker als die rationale Erkenntnis, dass Gott wissenschaftlich nicht erfahrbar ist.
Das versteht allerdings der Gläubige sogar als einen Vorzug des Göttlichen: Gott ist nicht fassbar, nicht festhaltbar, genau weil er Gott ist. Nur, der Gläubige ‚weiß’ immer noch nicht, wie und was Gott sein soll.
Auch in der Zeit, als die Sprachphilosophie in aller Munde war, konnte man feststellen, dass sie in der deutschen Universitätstheologie keine sichtbaren Spuren hinterließ, geschweige denn beim kirchlichen Personal, bei den Pfarrern und den Kaplänen. Letzteres ist nicht wirklich verwunderlich. Man kann nicht so naiv sein, sich vorzustellen, dass hauptamtliche Seelsorger aller religiösen Richtungen und Bekenntnisse - deren Hauptberuf es ist, über Gott zu sprechen - sich von irgendeinem Sprachphilosophen den Mund verbieten lassen. Aber die wissenschaftliche Theologie, sie hätte sich mit dieser Infragestellung des theologischen Konstrukts durchaus nachhaltiger befassen können. Aber auch an den theologischen Fakultäten waren keine Spuren davon zu entdecken.
Der Grund scheint allerdings klar zu sein: Der Mensch denkt über das, was seine Grenzen übersteigt, nach. Die Erfahrung der eigenen Grenze lässt vermuten, analog zur empirischen Erfahrung, dass jenseits eines Zauns ein neues Feld beginnt, dass jenseits unserer Grenzen eine andere Welt existiert. Vielleicht gibt es im Menschen eine innewohnende Notwendigkeit, über sich selbst hinaus zu denken, gerade weil er sich als beschränkt und begrenzt erfährt.
Die Rede über das, was den Menschen übersteigt, kann aber nicht gleich als wahre Beschreibung einer Realität verstanden werden, die der Mensch gar nicht kennt, deren hypothetischer Charakter die Gefahr in sich birgt, dass es diese ‚Realität’ gar nicht gibt.
Die sogenannte religiöse Sprache könnte also lediglich ein Ausdruck der menschlichen Erfahrung der eigenen Grenzen sein. Religiöse Sprache wäre dann eine Rede von Menschen über sich selbst sein. Sie enthielte in ihrem Kern durchaus einen Sinn, aber keinen, der den Menschen übersteigt.
Es ist für den Menschen eine bittere Erkenntnis, sich selbst als begrenzt zu erfahren. Diese zunächst reine philosophische Einsicht ist längst nicht so bitter wie die tagtägliche existentielle Erfahrung, dass der Mensch nicht alles kann, was er möchte, dass er nicht alles erreichen kann, was er erreichen möchte, nicht alles versteht, nicht alles begreift, nicht immer gesund ist, nicht immer zufrieden und glücklich ist, dass so viel gegen seine Interessen, seinen Willen geschieht, dass immer wieder Gefahren und Bedrohungen für sein Leben entstehen und überwunden werden müssen. Und überhaupt ist er sich bewusst, auch wenn er es zu verdrängen versucht: Die größte Beschränkung seines Daseins ist das sicher auf ihn zurollende Ende seines Lebens, der Tod. Der Tod ist die schmerzlichste existentielle Erfahrung, die erst dann hingenommen wird, wenn man das Leben, aus irgendeinem Grund, satt hat.
Читать дальше