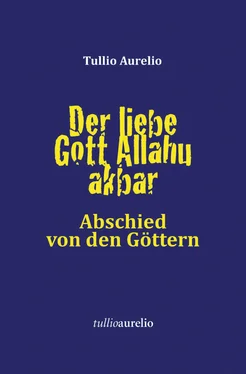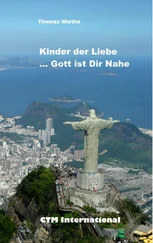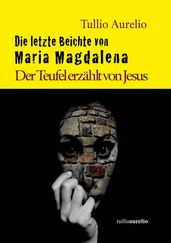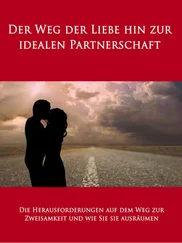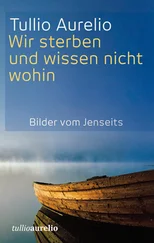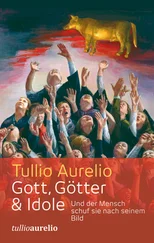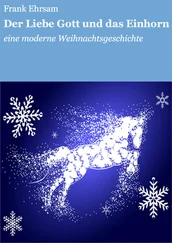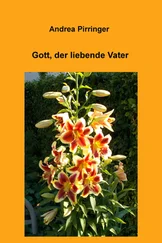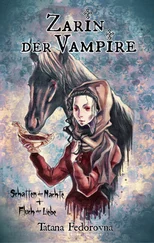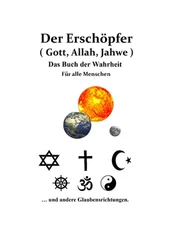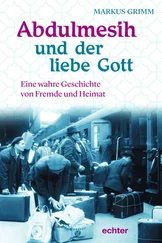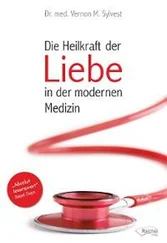Früher - eigentlich bis kurz vor diesem Morgen - wusste mein Gott über mich gut Bescheid. Er wusste, dass ich aufgewacht war, und er gab mir unterschwellig bereits erste Anweisungen, etwa wie ich zu beten hätte, an wen ich denken, was ich dringend erledigen sollte. Er war mein allgegenwärtiger Begleiter, er sah alles, er durchschaute das Innerste meines Herzens, ihm etwas vorenthalten zu wollen, war unmöglich. Er wusste genau, was für mich gut und was nicht gut war, entsprechend waren seine Erwartungen an mich. Das machte mich damals gar nicht unglücklich. Ich wähnte mich sogar glücklich aufgehoben – ein Gefühl, das mir ermöglichte, mich diesem inneren Gott gerne zu fügen.
Später, als religiöser Spätpubertärer, lehnte ich mich immer stärker gegen seine Weisungen auf, wurde ihm gegenüber immer kritischer. Das geschah aber schrittchenweise, und ich bildete mir ein, der liebe Gott merkte gar nicht, dass ich immer stärker auf Distanz zu ihm ging. Oder vielleicht, anders ausgedrückt, mir selbst wurde nicht ganz bewusst, dass ich Gott immer weniger brauchte.
‚Heute früh’ bedeutet also nicht die Morgenröte des heutigen Tages, sondern den Beginn einer neuen Zeit, deren Anfänge weit zurück reichen, als man sich denken mag. Aber nun ist es soweit: Alle meine Götter sind tot.
Nach einem Augenblick der Desorientierung fühle ich mich ‚heute früh’ endlich wohl.
Ich muss wohl erklären, was ich mit dem Satz meine, dass alle meine Götter tot waren, damit man mich nicht mit Nietzsches’ Übermensch verwechselt. Ich bin nicht Nietzsches’ Übermensch, eher ein Durchschnittsmensch, hoffentlich ein normaler Mensch.
Die Wirklichkeit ist wie immer vielschichtiger, als sie sich vordergründig zeigt. Ich formuliere deshalb vorsichtiger: Alle meine Götter sind tot. Die Unterstreichung macht deutlich, dass ich zunächst nur meine Götter als tot erfahre und als solche erkläre.
Es ist also kein Bekenntnis, dass Gott, wenn es ihn gibt, tot ist. Wenn es Gott gibt, dann ist er nicht tot, und wenn es Gott nicht gibt, dann hat es ihn nie gegeben, und deshalb ist er auch nie gestorben. Die zwei Aussagen - alle meine Götter sind tot, und: Gott selbst, wenn es ihn gibt, kann so oder so nicht tot sein – sind nicht unsinnig, sie sind Teile eines nur scheinbaren Paradoxes. Die Auflösung des Paradoxes ist sehr einfach: Meine Götter sind seit ihrer Entstehung in meinem Hirn nie Gott gewesen, sie lebten nur in meinem Kopf und in meinem Gefühl. Ob es einen Gott wirklich gibt, weiß ich auch heute nicht.
Gott sei Dank! Gott sei Dank?
Am 15. November 2017 fand sich in der SZ folgende Meldung: „Heiko Herrlich, 45, Trainer von Bayer Leverkusen, beobachtet bei den Fußballprofis eine verstärkte Suche nach Gott. ‚Die Gläubigen in der Bundesliga werden immer mehr. Ich begrüße das’, sagte er der Bildzeitung ... Weil es eine Übersättigung und Reizüberflutung gibt, haben viele Spieler das Gespür dafür, dass es etwas anderes geben muss, das einen viel reicher macht als das beste Handy, das größte Auto, das dickste Bankkonto.“
Auch dafür ist Gott heutzutage gut: armen Fußballspielern mit der großen Geldbörse ein wenig Freude schenken. Der Teufel, sagt ein deutsches Sprichwort, scheißt immer auf den größten Haufen. Gott anscheinend auch, wenn auch auf einen Haufen Geld. Gott übernimmt gern die Funktion eines Zuckerl oder des Sahnehäubchens.
Angefangen zu zweifeln, dass die übermittelten oder von Menschen gebastelten Gottesbilder Gott selbst sind, habe ich, als ich mir Alltagssätze über Gott durch den Kopf gehen und auf der geistigen Zunge der Sprachdeutung zergehen ließ.
Der häufigste Satz über Gott, der aus menschlichem Mund ausgesprochen wird, ist wahrscheinlich „Gott sei dank!“. „Gott sei Dank“ habe ich in ganz schlimmen Situationen gehört, mit Sicherheit auch selber gesagt. ‚Gott sei Dank’ sagte ein Autofahrer, der beim Aufprall mit einem anderen Auto, dessen Fahrer verstarb, verletzt am Leben blieb. ‚Gott sei Dank’ sagten Bewohner der Karibik nach dem Durchzug eines Hurrikans, der alles zerstört hatte und ihnen, außer des nackten Lebens, alles genommen hatte. „Gott sein Dank, ich bin durch ein Wunder gerettet“, sagte ein anderer Autofahrer, der bei dem Einsturz einer Autobahnbrücke, bei dem an die vierzig Menschen starben, unverletzt blieb.
Aber auch „wenn Gott will“ oder „so Gott will“ – die Araber sagen ‚inschallah’ – wird nicht seltener verwendet. „Der liebe Gott“, „der gütige Gott“, „Gott, unser Vater“, „Gott, unser Schöpfer“, „Gott im Himmel...“ sind auch häufig verwendete Ausdrücke, die irgendetwas über Gott aussagen wollen.
Lange genug habe ich selbst solche Sätze, wie religiöse Beruhigungspillen und Palliativen wiederholt, aber, soweit ich mich zurückerinnern kann, nie mit voller Überzeugung. Der Zweifel nagte von Anfang an in meinem Hirn, mal stärker, mal leiser, an der Gewissheit solcher Sätze.
Und der Zweifel wurde immer stärker. Immer bewusster stellte ich sie selbst in Frage, indem ich antithetisch fragte, wie das Gegenteil des Guten möglich ist, wenn es einen fürsorglichen Gott gibt, und welche Rolle er dabei spielen könnte. Nicht das Problem des Bösen stand zur Debatte, sondern die Beobachtung, dass es bei der Liebesbezeichnung Gottes für einen Menschen oder für ein Volk immer eine andere Seite, einen anderen Menschen, ein anderes Volk gab, der darunter leiden musste.
Folgender Text von Leszek Kolakowski (Der Himmelschlüssel, S. 36) zeigt paradigmatisch, was ich meine:
„Der Psalmist sagt zum Herrn (Psalm 136,10.15):
Er habe Ägypten an ihren Erstgeburten geschlagen, denn seine Güte währet ewiglich;
er habe Pharao und sein Heer ins Schilfmeer gestoßen, denn seine Güte währet ewiglich.
Die Frage: Was denken die Ägypter und der Pharao über die Barmherzigkeit Gottes?“
Der gute Gott ist nicht immer und überall zu allen gut. Seine Güte ist manchmal, oder sogar sehr häufig, selektiv: dem einen gewährt Gott seine Güte, dem anderen seine Rute. Das Leben eines Menschen kann den Tod eines anderen bedeuten. Es gibt also oft auch die Kehrseite der Güte Gottes, das andere Gesicht des janusköpfigen Gottes, und auch diese Seite verdient es, betrachtet zu werden.
Am Speisetisch zu sitzen und zu essen gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten des Lebens, denn ohne Essen würden wir sterben. Die Befriedigung eines grundlegenden Bedürfnisses füllt nicht nur den Magen mit Speise, sondern auch das Herz, als vermeintlichen Sitz der Gefühle, mit Freude. Nichts scheint also verständlicher zu sein als die Dankbarkeit gegenüber denen, die uns Speise und Trank schenken, auch gegenüber Gott. Auch gegenüber Gott?
Bei der Formulierung dieser ‚Dankbarkeit’ kommt die Einstellung der Menschen zur Sprache, denen es gut geht oder die wenigstens etwas zu essen haben. Es ist die Einstellung derjenigen, die vom gütigen Gesicht des zweigesichtigen Januskopfes angeschaut werden. So zum Beispiel in folgender Umformulierung des Psalms 145: „Aller Augen warten auf dich, o Herr. Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen.“
Eine ähnliche Dankbarkeit entspringt meistens dem Mund von Menschen, die am Esstisch sitzen und bereits satt, keinesfalls hungrig sind, vielleicht eher einen angenehmen Appetit verspüren, bevor sie wieder anfangen zu essen: „Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir, Dank sei dir dafür.“ Oder in diesem Gebet: „O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für deine Gaben, Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst.“
Das steht im Einklang mit dem, was Jesus über den himmlischen Vater und die hungrigen Vögel sagte: „Schaut auf die Vögel des Himmels: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen, und eurer himmlischer Vater ernährt sie“ (Mt 6,26). Und Jesus selbst in seiner Bergpredigt meint, wir sollen uns die Vögel des Himmels als Beispiel nehmen, denn der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen.
Читать дальше