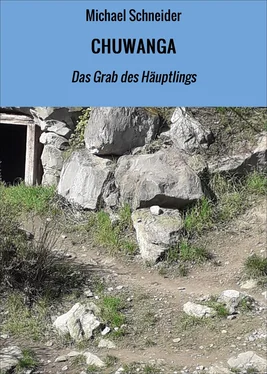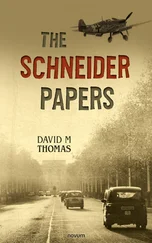„Und wenn sie entdeckt wird?“
„Dann behaupten wir einfach sie gehört nicht zu uns. Was genaugenommen auch stimmt.“ Stan laß in seinen Augen ganz deutlich ein; und außerdem ist sie bloß eine gottverdammte Indianerin, doch das sprach der Deputy nicht laut aus.
Jacksons Stirn legte sich in Falten.
„Und wer soll auf sie aufpassen?“
„Das machen wir.“ Stan traute seinen Ohren nicht. Hatte Wilhelm eben wir gesagt? „Wir gehören auch nicht dazu, nicht richtig jedenfalls. Zumindest kennt uns dieser Blackfist noch nicht.“ Er nahm den Deputystern ab und legte ihn auf den Tisch. „Aber er wird uns schon noch kennenlernen.“
Während sich Will und Tampka bereit machten, gab ihnen Mendoza noch ein paar Informationen über das Gelände und nannte ihnen den besten weg um ungesehen an eines der Fenster, auf der Rückseite des Sägewerks, zu gelangen.
„Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum sie uns nicht einfach schon letzte Nacht angegriffen haben?“ wunderte sich Mendoza über die Vorgehensweise ihrer Widersacher.
„Sie fürchten wohl das bei dem darauffolgenden Massaker auch Chico alias Emilio sterben könnte und aus irgendeinem seltsamen Grund wollen sie das nicht riskieren.“ erwiderte Wilhelm Achselzuckend.
„Wahrscheinlich, weil er Carlos` Bruder ist.“ entgegnete Stanford als er ebenfalls dazu kam.
Als die Anderen gerade mit anderen Dingen beschäftigt waren nahm Mendoza den Engländer ein wenig zur Seite, um mit ihm persönlich zu reden.
„Sie scheinen mir der klügste und besonnenste von ihnen zu sein. Ich bitte sie, daher auf meine Familie zu achten und dafür zu sorgen das niemand etwas… Dummes tut.“ Mendoza sah Stanford mit einem flehenden Blick an, der es ihm unmöglich machte zu widersprechen. Die beiden anderen kamen wieder dazu, bevor Stan etwas dazu sagen konnte. Als wäre es ihm peinlich, würden die anderen etwas von seiner bitte an Stan erfahren, beendete Mendoza das Thema schnell wieder.
„Dann viel Glück Engländer,“ verabschiedete er sich von Stanford, nachdem er ihnen nun alles Nötige erzählt hatte.
„Danke Mexikaner,“ rutschte es Stan heraus. Sein Versuch diesen unnötigen Kommentar mit einem gequälten Lächeln zu überspielen wirkte ebenso unnötig.
„Ich bin gar kein Mexikaner. Ich bin echter Spanier, Senior.“ In Mendozas Stimme schwang eine große Portion Stolz mit, was Stan nicht wirklich verstand. Spanier oder Mexikaner, war das nicht egal?
„Sind nicht alle Mexikaner, Spanier?“
Nun wirkte Mendoza tatsächlich etwas ungehalten.
„Sind nicht eigentlich alle Engländer Angelsachsen?“ erwiderte er schnippisch. „Also Deutsche?“
Wäre er ein Revolverheld wie Wilhelm, hätte Stanford vermutlich mit blauen Bohnen geantwortet, so jedoch musste er sich eine ebenso schnippische Antwort ausdenken. Doch stattdessen kam ihm Wilhelm freudig dazwischen:
„Hey, wir sind also nicht nur beste Freunde, sondern sogar so was wie Blutsbrüder!“ Darauf wusste Stan keine schnippische Bemerkung. Er hatte recht. Egal woher sie ursprünglich einmal kamen. Jetzt waren sie alle hier und verfolgten ein gemeinsames Ziel.
„Wie weit ist es noch?“ Stanford wollte nicht ungeduldig klingen, doch irgendwie war ihm die totale Finsternis in dem Tunnel unheimlich.
Tampka versuchte, ihn zu beruhigen.
„Als ich vorhin hier durch bin, ging es nur ein paar Schritte immer geradeaus. Wir müssten gleich da sein.“ Sie ließ Stan vor, damit er als erster den Ausgang erreichen würde.
Und dann stand er plötzlich in der Kirche, direkt hinter dem Altar, genau wie sie gesagt hatte. Durch die großen Fenster an den Seiten kam etwas Mondlicht herein, dadurch konnte er etwas mehr sehen als in dem dunklen Gang hinter ihm. Er wollte gerade erleichtert aufatmen, als er im letzten Moment einem Gegenstand ausweichen konnte, der auf seinen Kopf zugeschossen kam. Die Schaufel verfehlte ihn nur knapp. Im nächsten Augenblick hatte der hinter ihm auftauchende Wilhelm, das Werkzeug auch schon am Stiel gepackt und seinem Besitzer entrissen. Zeitgleich hatte Tampka das Gewehr aus dem Sheriffsbüro welches ihr Jackson gegeben hatte, auf den Angreifer gerichtet. Stan hatte noch gar nicht richtig registriert, was hier gerade geschehen war, da hatten die zwei den Mann auch schon überwältigt.
Wilhelm schrie den inzwischen auf dem Boden sitzenden Mann an.
„Was zum Teufel…?“
Stanford musterte den selbst im Sitzen noch imposant großen Mann genau. „Hey, ich kenne sie doch?“
„R. I. P.“ erwiderte der Riese, als würde Stan genau wissen, was er damit meinte.
„Verflucht noch mal,“ keuchte Wilhelm der dem Hünen noch immer Mistraute.
„Raymond I. Porter.“ Der Mann hob zur Begrüßung seinen zylinderartigen Hut ein kleines Stück.
„Sie sind der Bestatter,“ erwiderte Stan überrascht aber auch ein kleines bisschen erleichtert das es sich nicht um einen von Blackfist Thompsons Männern handelte. „Sie haben im Saloon am Klavier gespielt.“
„Bestatter! Totengräber, Sargbauer, Schneider, Gärtner, einige sehen mich sogar als so eine Art Bürgermeister an … und nicht zu vergessen, da ich der Einzige bin, der dem einigermaßen nahekommt, Priester! Und ihr zwei seid doch diese Kopfgeldjäger oder nicht? Also seid ihr die dreckigen Hunde, die uns das alles eingebrockt haben. Ich hätte euch doch eins mit der Schaufel überziehen sollen.“
Nachdem ihm die drei die ganze Lage noch einmal genau erklärt hatten, beruhigte der Mann sich nicht nur, er bot ihnen sogar seine Unterstützung an.
„Es reicht schon aus, wenn sie aufhören mit Gegenständen nach uns zu schlagen und aus dem Weg gehen.“ Wilhelm war noch immer nicht gut auf den Mann zu sprechen. Dieser wirkte jedoch kaum noch verärgert. Vielmehr schien er die Hoffnung zu haben, die drei könnten ihm und den anderen vielleicht doch noch helfen.
„Ich sehe die Leute in dieser Stadt als meine Familie an. Sie respektieren mich und ich helfe ihnen, wo ich kann und wenn es nur mit einem schlecht gespielten Stück auf dem Klavier ist.“ Er sah die kleine Gruppe ernst an. „Ich werde alles tun, was nötig ist, um die Geiseln zu befreien.“
Gerade als Stanford etwas erwidern wollte, bedachte sie Tampka, die zu einem der Fenster gegangen war, still zu sein. Sie hatte draußen etwas gehört.
„Das ist die Patrouille.“ Flüsterte sie ihnen zu.
Auch alle anderen bemühten sich, möglichst leise zu sprechen.
„Vor denen habe ich mich vorhin hier in der Kirche zu verstecken versucht.“ Auch der Totengräber sprach kaum hörbar. Tampka zog das Messer aus ihrem Stiefel.
„Nicht.“ Stanford hielt ihre Hand fest, sodass sie es wieder wegstecken musste. „Wenn wir Thompsons Leute abmurksen, lässt er den Austausch morgen früh platzen und wir bringen die Gefangenen unnötig in Gefahr.“
Bevor einer von Ihnen etwas dagegen tun konnte, war Porter zum Eingang gelaufen.
„Es ist meine Familie, die von denen festgehalten wird. Ich lenke die Zwei ab, geht ihr zum Sägewerk rüber. Bitte enttäuscht mich nicht.“ Und schon war er nach draußen verschwunden. Die drei hatten keine Chance, ihn aufzuhalten und konnten nur zusehen, wie er davonlief, während ihn die beiden Gangster verfolgten.
„Sie sind weg. Wir sollten losgehen.“ Sagte Tampka. Stanford hatte kein gutes Gefühl bei der Sache. Er spürte, dass heute etwas gewaltig schief gehen würde.
Stan sah zu dem Glockenturm der heruntergekommenen Kirche hinüber. Er konnte Wilhelm in der Dunkelheit nicht einmal erahnen, trotzdem wusste er ganz genau, dass er dort war, mit dem Gewehr im Anschlag, immer bereit ihm zu helfen, wenn es nötig werden würde. Dennoch war es der junge Deutsche, der ihn bewunderte, ihn für einen Helden hielt. Sich regelrecht an ihn klammerte, weil er stets einen Plan hatte. In Wahrheit war er der Held von ihnen beiden. Stan ist nur so mutig wegen ihm. Weil er weiß, dass ihn Will stets beschützen würde. Der Junge war nicht der schlauste, doch er konnte kämpfen, mit dem Gewehr ebenso gut umgehen wie mit den Fäusten. So hatten sie sich auch kennengelernt, während einer Schlägerei in einem Saloon. Stanford hatte sich mit einem einarmigen Banditen angelegt. Er wollte den Helden spielen und einer schönen Maid in Not zu Hilfe kommen. Leider hatte der Einarmige Freunde, große, grimmige Freunde. Und die hatten auch alle noch beide Arme. Wilhelm war eigentlich dort, um sich ebenfalls mit ihm anzulegen. Stanford hatte ihn zuvor abgezockt. Ihn um all sein Hab und Gut erleichtert. Doch dann in dem Saloon kam er ihm zu Hilfe. Anstatt ihm danach den Schädel einzuschlagen, so wie dem Einarmigen und seinen zwei Kumpanen, teilte er sich mit ihm sogar das Kopfgeld. Denn wie sich herausstellte, hatte Wilhelm zuvor deren Steckbriefe entdeckt, als er Stanford beim Sheriff anzeigen wollte. Fortan waren die zwei ein unzertrennliches Team. Stanford sorgte stets für die nötige Ablenkung, während sich Wilhelm die Bösen vorknöpfte. Nein, er war kein Held, er war nichts weiter als ein Betrüger. Wilhelm war der wahre Held. Er ist nur der, der Schmiere steht. Schmiere stehen. Stanford fiel wieder ein, warum er hinter der Hausecke stand.
Читать дальше