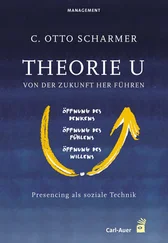Erst am späten Nachmittag öffnete ich zum ersten Mal die Augen. Ich blickte auf ein unbekanntes Dach und versuchte mich zwanghaft zu orientieren. „Mutter, er ist aufgewacht!“ rief eine piepende Stimme. Vorsichtig neigte ich meinen Kopf zur Seite und sah ein Mädchen meines Alters, die gerade dabei war, meine Stirn mit einem feuchten Tuch abzutupfen. Ich konnte spüren, wie sehr ich glühte und meine Haare waren pitschnass geschwitzt. Und plötzlich stand Luisa neben ihr, die mich besorgt ansah. „Na los, hol ihn einen Becher Wasser.“ sagte sie prompt und das Mädchen räumte den Platz. Nun setzte sich Luisa neben mich an das Bett und musterte mich. „Wie geht es dir, Jacob?“ fragte sie mich. Ich blickte verwirrt in ihr errötetes Gesicht und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Und plötzlich kamen die Erinnerungen zurück. „Mutter!“ flüsterte ich und setzte mich sofort auf. „Ich muss zu Mutter!“ rief ich dann hysterisch. „Du kannst jetzt nicht zu deiner Mutter, Jacob.“ Sie legte eine Hand auf meine Schulter und in diesem Moment kam das Mädchen mit einem Becher Wasser zurück. Sie reichte es mir und versuchte zu lächeln, dennoch konnte ich in ihren großen grünen Augen etwas Mitleid sehen. Das Mädchen hatte braunes, langes Haar welches zu zwei Zöpfen geflochten war und auf ihrem Gesicht sprießten überall Sommersprossen. Sie trug ein langärmliches, weinrotes Kleid mit einer weißen Schürze, die von einigen Schmutzflecken befallen war. Nachdem ich sie gemustert hatte, nahm ich den Becher entgegen und trank hastig daraus. Währenddessen spielte sich das Geschehnis mit meiner Mutter noch einmal vor meinen Augen ab und ich konnte einfach nicht glauben, was passiert war. Die Tatsache, dass meine Mutter hinter Gittern saß und schlimmstenfalls hingerichtet werden würde, brachte mich fast um den Verstand.
Ich gab dem Mädchen den leeren Becher zurück und versuchte aufzustehen. „Wo willst du denn hin? Du solltest dich ausruhen, Jacob!“ riet mir Luisa im strengen Ton. „Nein, ich muss zu meinem Vater!“ rief ich und riss mich von ihr los, als sie mich festhalten wollte. So rannte ich zur Tür und verließ die Hütte, welche in einer der dunklen, verwinkelten Gassen lag. Ich eilte durch sie hindurch, rammte einige Dorfbewohner die mir entgegenkamen, die mich mit „Pass doch auf, du Narr!“ oder „Welch‘ unverschämter Knabe!“ beschimpften. Doch das juckte mich überhaupt nicht, ich wollte nur noch zu meinem Vater, der meine Mutter aus diesem Albtraum herausholen würde. Ganz bestimmt.
Als ich das Dorf endlich verlassen hatte und auf der vertrauten Holzbrücke stand, lehnte ich mich kurz an das Holzgerüst und schnappte nach Luft. Erschöpft nahm ich einen letzten tiefen Atemzug ehe ich weiterrannte. Die Steigung des Hügels gab mir nochmal den Rest und ich versuchte gleichmäßig weiter zu atmen, doch es fühlte sich so an, als würde ich jeden Moment ersticken. Aus der Ferne konnte ich schon unsere Weide sehen, so kniff ich die Zähne zusammen und rannte weiter – mit der Gewissheit, es gleich geschafft zu haben. Noch bevor ich das Weidentor erreichte, schrie ich: „Vater! Vater! Vater!“ Stürmisch überquerte ich die Weide und hielt Ausschau nach ihm. Nochmals rief ich nach ihm, bis er endlich aus der Scheune kam. Erleichtert rannte ich auf ihn zu und er musterte mich mit weiten Augen. Mir kam es so vor, als wüsste er schon, dass etwas Schreckliches passiert war. „Mutter wird im Kerker gefangen gehalten! Sie wollen sie hinrichten und wir müssen sie befreien, Vater! Komm schnell!“ rief ich und lehnte mich völlig atemlos nach vorn, um wieder Luft zu kriegen. Erschrocken blickte er in die Richtung des Dorfes und legte seinen Hirtenstab beiseite. Erwartungsvoll blickte ich ihm in sein angespanntes Gesicht, bis er eiskalt antwortete: „Deine Mutter hat es nicht anders gewollt. Ich habe sie davor gewarnt.“ Nach diesen herzlosen Worten wandte er sich dann von mir ab. „Was?! Aber Vater, das kannst du doch nicht zulassen! Sie hat nichts getan - wir müssen sie da rausholen und zwar schnell!“ rief ich wieder und brach sofort in Tränen aus. Er ignorierte mich und kehrte mit ernster Miene einen Strohhügel zusammen. „Aber Vater, willst du denn, dass sie stirbt?“ fragte ich ihn und meine Stimme versagte beim letzten Wort. Ohne mich anzusehen, antwortete er mit seiner tiefen Stimme: „Nein, das möchte ich nicht. Sie hat ihren Tod selbst gewählt – das ist ein Unterschied.“ Mit diesen kühlen Worten hatte ich gewiss nicht gerechnet, so sackten meine butterweichen Beine zusammen und ich fiel mit den Knien auf den Boden. Ich stützte mich auf den Händen ab und bekam kein einziges Wort mehr heraus. Die Tränen kullerten über mein Gesicht und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich wimmerte lautstark vor mich hin - war kraftlos und müde. Meine einzige Hoffnung wurde nun zerstört - von meinem eigenen Vater, der seine Frau – meine Mutter – scheinbar nicht genug liebte um sie zu retten. Doch ich liebte sie - mehr als er sich erdenken konnte. Es fraß mich innerlich auf, dass ich nichts tun konnte, ich war schließlich nur ein kleiner, dummer Junge, der noch nicht erwachsen und mutig genug war, um zu handeln. Und plötzlich erinnerte ich mich an die Worte meiner Mutter, letzte Nacht in der Scheune: „Du hast etwas, was dein Vater nicht hat.“ „Und was wäre das, Mutter?“ „Du hast großen Mut, Jacob. Zwar schlummert es noch in dir, doch du besitzt eine Menge davon.“ In diesem Moment krallte ich wütend meine Hände in den Erdboden. „Mutter hatte Recht!“ brüllte ich lautstark und blickte provozierend zu meinem Vater, der mir immer noch den Rücken zuwandte. „Du bist der größte Feigling, den ich kenne! Ich bin nicht so wie du und werde auch niemals so sein, hörst du!“ Ich wartete kurz auf eine Reaktion, doch er unterbrach weder seine Arbeit, noch antwortete er auf meinen Wutausbruch. Noch nie zuvor hatte ich mich getraut, mich gegen ihn zu verschwören doch zu groß war meine Wut, die in mir kochte. „Du verdammter Feigling!“ brüllte ich wieder, wischte mir mit meinem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und stand auf. Zum ersten Mal fühlte ich mich mutig, was mich dazu motivierte, meinen Vater weiter zu beschimpfen. Doch bevor ich den nächsten Brüller loslassen konnte, kam er plötzlich auf mich zu und gab mir eine Ohrfeige, die in der ganzen Scheune erschallte. Erschrocken blickte ich noch für einen Moment in seine bösen Augen, ehe ich mich umdrehte und über die Weide rannte. Der kleine Funken Mut, der kurz in mir geleuchtet hatte, war bereits wieder erloschen - so rannte ich zurück in die Richtung des Dorfes, ohne Plan und ohne jegliche Hoffnung. Ich nahm nicht mal den kühlen Wind wahr, der durch meine wuscheligen Haare blies, während ich den steilen Hügel hinunterrannte. Ich wollte einfach nur weg – weg von meinem herzlosen Vater, der meine geliebte Mutter einfach so losließ. Kein einziges Mal dachte ich darüber nach, wo ich nun hingehen sollte, meine Beine trugen mich einfach durch die dunklen Gassen des Dorfes, bis ich vor Luisas Tür stand und stürmisch daran klopfte. Sofort wurde sie geöffnet, doch ich konnte einfach nichts sagen. Mir wurde schwindelig, ich sah alles verschwommen und kniff mir konzentriert die Augen zu. Luisa sprang auf mich zu und begleitete mich in das Haus hinein, in dem ich an diesem Tag schon einmal aufgewacht war. Luisa reichte mir ein warmes Getränk, in dem verschiedene Kräuter schwammen. Durstig trank ich den Becher aus und ehe mir bewusst wurde welch‘ betäubende Wirkung dieses Getränk hatte, entkrampfte sich mein angespannter Kiefer, meine zusammengeballten Hände lösten sich und ich fühlte mich plötzlich leicht wie eine Feder. Ich merkte, wie meine Muskeln erschlafften und mein ganzer Körper zusammensackte - ich hatte auf einmal keine Kontrolle mehr über mich. Nur noch erinnerte ich mich an das Mädchen, das mich mit ihren neugierigen, großen Augen beobachtete, wie sich mein Kopf langsam dem weichen Stroh näherte. Ich konnte spüren, wie sie eine warme Decke über mich legte und mit ihrer zierlichen Hand über meinen Kopf streichelte. Je mehr ich mich innerlich gegen diese Betäubung wehrte, umso müder wurde ich, bis ich den Kampf gegen die starke Kräutermischung endgültig verloren hatte.
Читать дальше