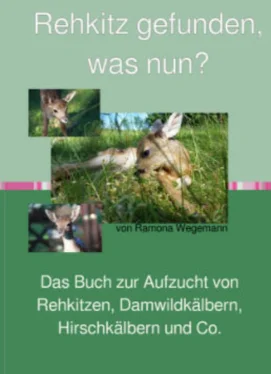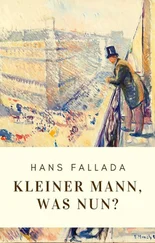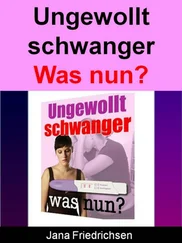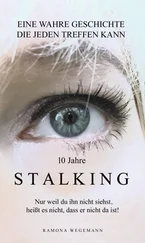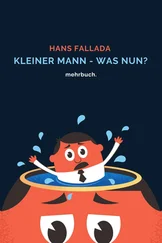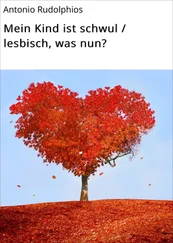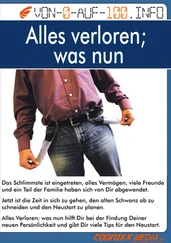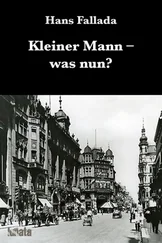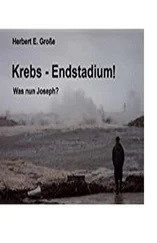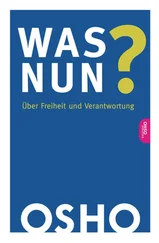Unten ein Reh im rot-brauen Sommerfell


Reh im grau-braunen Winterfell
Die dunklere Färbung ermöglicht neben der wärmeren Beschaffenheit eine zudem bessere Wärmeaufnahme durch vereinzelte Sonnenstrahlen, die sich im Winter noch zeigen. Zudem haben Rehe auch eine Art Fettbeschichtung im Fell, die wie bei einem Regenschirm wasserabweisend wirkt. Im Winter sollten die Tiere daher nicht im Fell gekrault und gestreichelt werden, damit diese Schutzschicht nicht zerstört wird. Im Nackenbereich und auf dem Rücken kann man diese fettartige Beschichtung bei genauer Betrachtung auch mit dem bloßen Auge erkennen. Es scheint in der Tat wie weißes Pulver zwischen den Haaren zu liegen.

Auch das Unterhautfettgewebe, die eigene Stoffwechselanpassung im Winter und spezifische Verhaltensweisen der Tiere, dienen als Schutz gegen winterliche Kälte. Sogar die Arbeit der Mikroorganismen beim Verdauungsprozess bietet eine wärmende Unterstützung für das Tier. Bei tiefen Temperaturen liegen die Tiere möglichst zusammengerollt und ziehen die Beine dicht an den Körper heran. Zum Ruhen werden richtige Nester mit den Hufen in die Erde oder den Schnee gescharrt, um einen isolierenden Kranz um sich herum zu schaffen und somit dem Wind und der Kälte weniger Angriffsfläche zu bieten. Gern nutzen die Tiere auch trockene und wärmende Untergründe wie Nester aus Stroh, Heu oder trockenem Gras oder einfach nur loser Erde, in die sie ihre Liegekuhlen hineinscharren können.

Wo es möglich ist, lieben es Rehe trocken, warm und weich zu liegen. Wenn sich ein Nest aus Heu oder trockenem Gras bietet, wird dies gern genutzt. Bild unten zeigt entspannt ausgestrecktes lockeres Liegen, bei warmen Temperaturen.

Die Körperoberfläche ergibt den meisten Wärmeverlust. Das heißt, dass die Wärmeverlustrate abhängig ist vom Verhältnis Körpergewicht zu Körperoberfläche. Kleine und leichtere Tiere haben demnach verhältnismäßig mehr Körperoberfläche zum Körpergewicht. So haben kleinere und leichtere Tiere auch weitaus mehr Probleme, ihren Wärmehaushalt stabil zu halten, als ein kräftigeres Tier. Für die Gewinnung von Köperenergie müssen die Tiere für den Winter auch Fettreserven / Energiereserven anlegen. Zum einen deponieren Rehe Energie in Form von Glykogen (eine besser speicherbare aber nicht so rasch verfügbare Energie aus Fettreserven) in Leber und Muskulatur. Zum anderen speichern Rehe Energie in Form von Fettdepots unter der Haut (Unterhautfettgewebe), in der Bauchhöhle (Nieren- und Gekrösefett) und in den langen Röhrenknochen in der Herzgegend. Bei extremer Kälte kann die Wärmebildung sogar bis auf das 5fache der normalen Tätigkeit ansteigen. Dies bedeutet für das Tier eine enorme Belastung und verbraucht Unmengen an Energie. Jede zusätzliche Belastung durch Unruhe und Störung belastet den Organismus zusätzlich und verbraucht viel der lebensnotwendigen Energie. (Hier erinnere ich an den jagenden Hund der das Reh nun die letzten lebensnotwendigen Energiereserven verbrauchen lässt oder eine von Jägern gern vorgenommene Treibjagd). Bei leichteren Tieren kann solche Unruhe und Störung ausreichen, dass die lebensnotwenigen Energiereserven verbraucht werden und das Tier somit den Winter nicht mehr überleben kann. Nach dem Zusammenbruch des Organismus, wird es nach mehreren Tagen des Leidens letztlich erfrieren.

Rehe können Temperaturunterschiede von nur 1°C wahrnehmen. So ist es durchaus logisch erklärbar, dass sie sich nicht nur aus Gründen zum Schutz vor Regen und Wetter unter großen Schirmfichten aufhalten und dort gern ruhen. Schutz vor Wind und Regen ist bei starken Außentemperaturen dringend notwendig. Die Auskühlung des Körpers wird durch Feuchtigkeit und Wind beschleunigt. So ist beispielsweise bei einer Windgeschwindigkeit von nur 16km/h bei einer Temperatur von immerhin +5 °C das Empfinden der Kälte bei –2°C. Dass die gefühlte Temperatur von der tatsächlichen abweicht, kennen schließlich auch wir Menschen gut.
Durch die im Winter ohnehin spärliche Futterauswahl, bei geschlossener Schneedecke oftmals gänzlich fehlende Futterauswahl, reduziert das Reh natürlicherweise seinen Energieaufwand für seine Verdauungsabwärme. Die Bildung der Pansenzotten, Pansenbakterien und der Pansensaft geht stark zurück. Die Zelluloseverdauung steht auf absolutem Jahrestiefpunkt. Das heißt, es stellt seine Energie auf Sparflamme und stellt seinen Organismus komplett auf die karge Zeit ein. Es ist somit von der Energie abhängig, die es im Herbst (September bis Dezember) bereits angelegt und nun zur Verfügung hat.
Daher ist es nachvollziehbar, dass den Tieren kaum mit einer alleinigen Notfütterung im Winter geholfen ist. Die Fütterungen müssten bereits im Herbst beginnen, wenn die Tiere noch in der Lage sind, die Nahrung aufzunehmen und anzulegen. Auch hier arbeitet der Jäger mit verstärktem Jagddruck im Herbst wieder gegen die Natur, wenn er vermehrt Unruhe und Leid bei den Tieren verbreitet, während diese sich auf den Winter vorbereiten müssten.
Im Gehege gehaltenes Wild sollte im Hochwinter energiereduziertes und eiweißreduziertes Futter erhalten, um Verdauungsstörungen und dem Fettlebersyndrom vorzubeugen.

Trächtige Ricken haben im Winter sogar die Entwicklung des Embryos eingestellt (s.o.) Dies nennt man Keimruhe oder auch Eiruhe. Das Ei entwickelt sich erst ab dem Frühjahr weiter, wenn der Organismus seine Energie wieder aus der Umgebung beziehen kann.
Zu beachten ist, dass jede Beunruhigung in der vegetationslosen Zeit vermieden werden sollte. Hier sind nicht nur die Jäger angesprochen, sondern auch alle Spaziergänger, Jogger, Reiter und vor allem Hundebesitzer.
In manchen Gebieten wurde speziell für Wildtiere ein sogenannter Wintereinstand hergerichtet (eine Ruhezone, Futterbereich und Liegeplatz).
Solche Wintereinstände sollten ungestört bleiben. Jagdliche Aktivitäten sollten spätestens bis Weihnachten abgeschlossen sein und bei geschlossener Schneedecke ohnehin aus tierschutzrelevanten Gründen komplett entfallen.
Rehkitz gefunden was nun?

Kommen wir nun zum aufgefundenen Rehkitz. Wie verhält man sich, wenn man ein hilfsbedürftiges Kitz gefunden hat? Zunächst gebe ich zusammengefasst ein paar erste Hilfestellungen, die ich später noch näher in den einzelnen Kapiteln ausweiten werde. Die schnelle und kurze Übersicht in der ersten Hilfe soll zunächst eine schnell lesbare Information bieten, bevor wir nochmals näher in die einzelnen Themen einsteigen. Lesen Sie sich die folgenden Seiten und Hilfsthemen bitte sorgfältig durch, ggf. mit einer zweiten Person, um Missverständnisse zu vermeiden!
Читать дальше