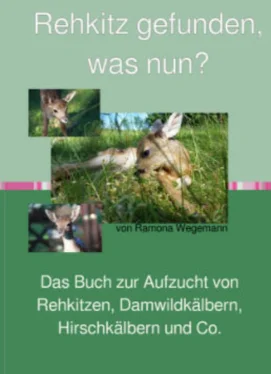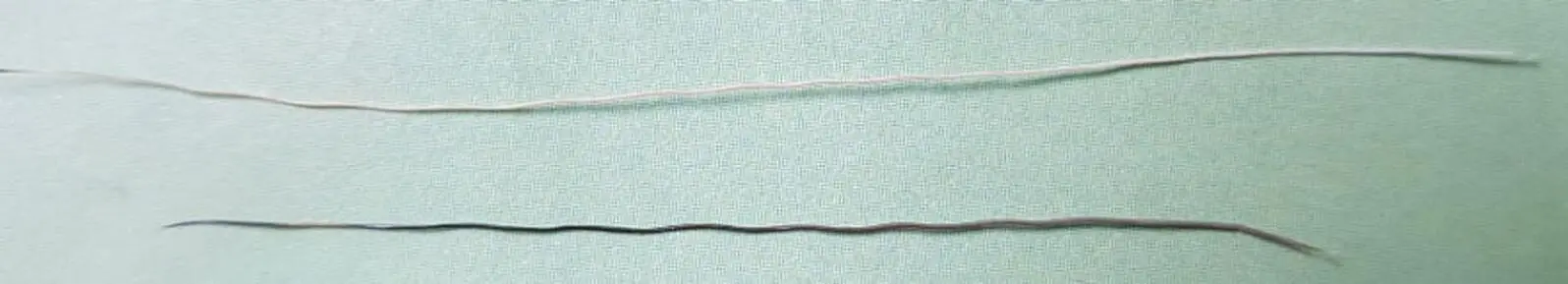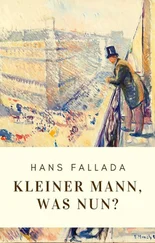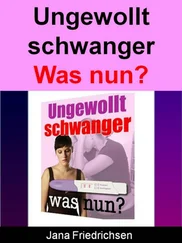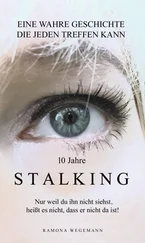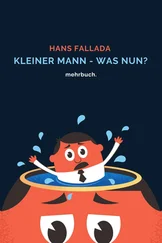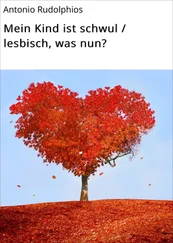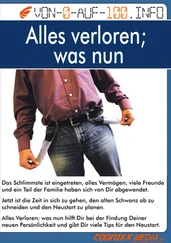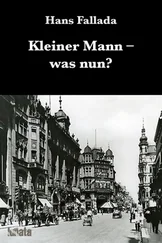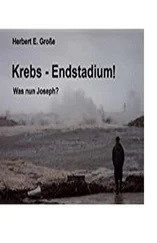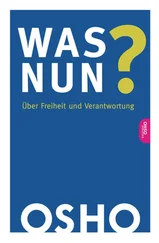Junges Damwild beim Betasten und Erkunden seiner Umgebung.
Einen großen Teil des täglichen Wasserbedarfs decken Rehe durch natürliche Äsungsbedingungen (Aufnahme von Knospen, Klee, frischem Saftfutter etc.) Frisches Wasser benötigen die Tiere aber dennoch, täglich etwa 1,35 Liter / 10kg Körpergewicht. Der Wasserbedarf steigt bei trockenen Futtermitteln auf mehr als 4 Liter /10kg. So benötigt ein ausgewachsenes Reh bei trockener Fütterung (starker Winter und trockene Sommer) immerhin gut 8-10 Liter Wasser pro Tag. Je saftiger das Futter ist, desto weniger Wasserbedarf hat das Tier. Bei genügend Saftfutter kann der tägliche Bedarf bei nur noch 0,5 Liter / 10kg liegen. Es ist daher selbstverständlich, dass Fütterungen immer in der Nähe von Wasservorkommen vorgenommen werden sollten. Wassermangel und Dehydrierung kann insbesondere bei trockenen Minustemperaturen im Winter oder in langen trockenen Sommerperioden auftreten. Auf Gaben von Salzlecksteinen sollte in diesen Zeiten eher verzichtet werden, wenn man nicht für ausreichenden Wasserausgleich in diesen schweren Zeiten sorgen kann. In besonders kalten Tagen geht das Bedürfnis der Tiere zu trinken zurück. Dies bedeutet aber nicht, dass man den Tieren nichts mehr bereitstellen müsste. Vielleicht kennt man es vergleichsweise von sich selbst, dass man an kalten Tagen häufiger Wasser lassen muss? Es hat einen wichtigen Grund, der den Körper vor zu schneller und zu starker Auskühlung schützen soll. Der unnötig aufgestaute Urin in der Blase ist eine Wassermenge, die viel Energie beanspruchen würde, um das Wasser auf Körpertemperatur zu halten. Diese Energie für ein Abfallprodukt des Körpers zu verschwenden, könnte unter Umständen sogar lebensbedrohlich werden. Dieses Wasser möchte der Körper zügig loswerden, um nicht unnötig auskühlen zu müssen. Der Wasserhaushalt wird so gering wie möglich gehalten und auf das nötige Minimum reduziert. In Trockenzeiten (Sommer wie Winter) sollte man stets Wasser zur freien Aufnahme anbieten, dies schützt auch vor Verbissschäden (Abnagen von jungen Baumrinden u. a.) Bei akutem Wassermangel wird sonst das Wiederkäuen für das Tier unmöglich. Es hat sich herausgestellt, dass wo Jagddruck an Wasserstellen vorhanden ist und die Tiere keine Möglichkeit haben ungestört und in Ruhe ihren Wasserbedarf zu stillen, dass in dieser Umgebung die Verbissschäden höher sind, als anderswo, wo die Tiere ohne Angst an Wasser gelangen. Hochsitze und Jagdruck an Wassereinständen aufzustellen, ist demnach nicht nur unfair sondern auch eine Provokation von Verbiss. Dieser Umstand erklärt sich, wenn man die Umstände hierzu nun kennt.
Wiederkäuen ist lebensnotwendig.
Ein erwachsener Wiederkäuer ist durch den komplexen Vorgang der Pflanzenverwertung durch das Wiederkäuen in der Lage, sich fast unabhängig von externen Eiweißzufuhr zu machen. Ein Kitz und ein Kalb, haben noch keine ausgereiften Pansen und keine vollwertige Funktion des Wiederkäuvorgangs und benötigen noch externe Eiweiße über Milch und Nahrung. Das Wiederkäuen ist ein lebensnotwendiger Vorgang, der nur unter zwei Voraussetzungen geschieht. 1. braucht das Wild hierzu Ruhe und 2. muss das zuvor aufgenommene Futter einen Mindestgehalt an strukturreicher Rohfaser enthalten (mindestens 14-16%). Denn nur entsprechend strukturierte Rohfaserpartikel können den Reflex an den Rezeptoren an der Vormagenwand auslösen, um den Futterbrei hochzubringen und den Vorgang zum Wiederkäuen auszulösen.
Ohne eine ausreichende Beiäsung und Aufnahme von Rohfaser können die meisten Grundfuttersorten nicht zum Wiederkäuen verwendet werden. Beim Wiederkäuen werden des weiteren Methangase ausgestoßen, die sich im Gärprozess im Pansen bilden und sonst zu einer Pansenaufgasung führen würden. Es käme ohne entsprechende Wiederkäuvorgänge zu einer Übersäuerung des Pansens und das Tier erkrankt und wird sterben.
Das Einspeicheln des Futterbreis ist wichtiger Bestandteil beim Wiederkäuprozess. Der Speichel eines Wiederkäuers ist allerdings komplett anders aufgebaut, als der Speichel eines Menschen oder eines Fleischfressers (wie Hund/Wolf/Fuchs/Katze etc.) Der Speichel hält mit seiner natürlich puffernden Wirkung den PH-Wert im Pansen stabil. Dies trägt dazu bei, dass der Pansen nicht übersäuert. Der normale PH-Wert eines Wiederkäuers liegt zwischen 5,8 – 7,2. Bei zu viel Kraftfuttermengen ohne entsprechende Rohfaserfütterung wird weniger wiedergekäut und durch die verminderte Speichelproduktion kippt das Gleichgewicht der Mikroorganismen. Ein niedriger PH-Wert von nur 5-4 ist bereits lebensbedrohlich für das Tier. Es stellt sich Durchfall ein, akute Fressunlust, Schmerzen, Entzündung der Pansenschleimhaut, Kümmerer und akute Todesfälle.
Rehwild produziert im gesunden Normalfall bis zu 10 Liter Speichel am Tag, Rotwild (Hirsch und Hirschkuh) sogar 10-50 Liter Speichel am Tag. Das Reh hat ernährungssituativ als Futterselektierer eine wesentlich kleinere Ohrspeicheldrüse, als Rothirsch und Damhirsch, oder auch als Schafe oder Rinder. Die Speichelproduktion ist wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Mikroorganismen im Pansen. (Bakterien, Hefen, Pansensiliaten). Rehe haben 4 Mägen, eigentlich sogar 5 wenn man den Vormagen dazu zählt. Das Futter läuft durch eine Reihe von Mägen der Verwertung und Aufbereitung, bevor es letztlich lebensnotwendig aufgeschlossen und verwertet werden kann. Nach der Aufnahme wandert das Futter in den Vormagen, (das erste Mal in den Pansen). Vom Pansen aus geht das aufgenommene Futter in den Netzmagen, der bildlich beschreibend wie ein Netz nun sortiert, was umgehend weiter zur Verwertung geht und was nochmals zum Wiederkäuen hochgewürgt und nochmals zerkleinert werden muss. Wenn durch das Wiederkäuen der Futterbrei entsprechend zerkleinert ist, kommt er in den Blättermagen. Hier wird dem Futterbrei wieder Flüssigkeit entzogen und gelangt dann weiter in den Labmagen. Im Labmagen wird nun der Futterbrei mit Magensäure versetzt und angesäuert, die überschüssigen Bakterien werden durch die Salzsäure im Labmagen abgetötet, der Futterbrei mit Enzymen versetzt und kann hier entsprechend weiter aufgeschlossen werden. Der so vorbereitete Futterbrei gelangt nun in den Darmtrakt und kann hier durch die Darmschleimhaut verwertet werden. Die restliche Flüssigkeit wird aufgenommen. Der unverwertbare Rest gelangt in Form von Losung (Kot) zum Darmausgang hinaus.
Erhaltung der Körpertemperatur beim Reh
Mit Minusgraden kommen Rehe wesentlich besser zurecht, als mit hohen heißen Temperaturen. Das Winterhaar der Tiere ist länger und dichter als im Sommer und hat eine dichte, leicht fettende Unterwolle. Oberflächlich betrachtet sieht das Haarkleid vom Reh glatt aus und kann auch als glatt anliegend beschrieben werden. Doch betrachtet man ein einzelnes Haar ganz genau, so erkennt man, dass die Haare wellig verlaufen und Winterhaare innen hohl sind. Diese perfekte Isolierung schützt die Tiere auch bei strengen Temperaturen.
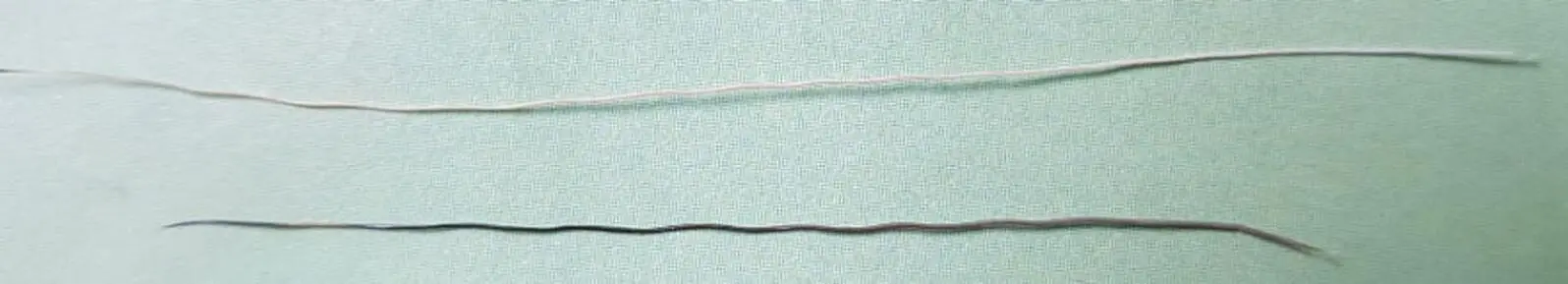

Die Isolierung ist so gut, dass sich Rehe oft sogar einschneien lassen und der Schnee auf dem Rücken der Tiere nicht schmilzt.


Das Winterfell ist auch dunkler gefärbt, als das rötliche Sommerfell.
Читать дальше