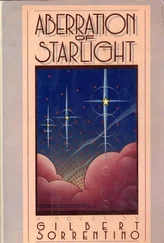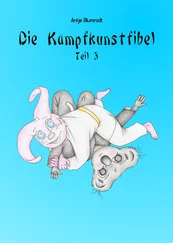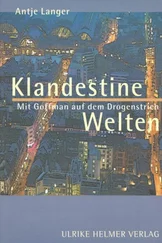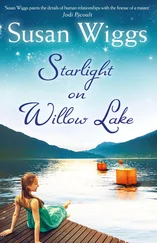„Übermorgen schon?“ Hart stellte sie die Teller auf den Tisch zurück, dass es klirrte. „Aber Amina braucht dich jetzt. Hättest du das Ganze nicht ein paar Tage verschieben können? Dieser Junge ist seit zehn Jahren tot, es hätte ihm sicher nichts ausgemacht, noch ein bisschen länger zu warten, bis du dich seiner annimmst.“
Ich dachte daran, wie durcheinander Robert am Telefon gewirkt hatte. „Das ist mein Job, Susan und außerdem hatte ich meinen Flug schon gebucht, als du mich heute wegen Amina angerufen hast.“
Ich griff ungern zu dieser Notlüge, aber ich hatte auch keine Lust, als schlechter Vater hingestellt zu werden. „Und wir haben ja auch noch Kathy.“
Kathy Sloan war eine von Susans Studentinnen. Sie passte auf die Kinder auf, wenn meine Frau und ich ausgehen wollten oder wir beide noch am Abend beruflich zu tun hatten, was hin und wieder vorkam.
„Soll Kathy auf die Kinder aufpassen oder zur Elternversammlung gehen?“, fauchte sie mich an und verließ die Küche.
Ich räumte das Geschirr in den Spüler und wischte den Tisch ab. Anschließend schickte ich die Kinder ins Bad. Susan saß an ihrem Schreibtisch. Vermutlich korrigierte sie Arbeiten ihrer Studenten.
Amina ließ sich von mir beim Waschen helfen und ich fragte mich, wie lange ich das wohl noch durfte. Es war mühsam, den Gipsarm im Schlafanzugärmel unterzubringen.
Schließlich saß ich mit beiden Kindern auf Aminas Bett und erzählte ihnen Geschichten. In der Zeit, in der ich in verschiedenen Reservaten gelebt hatte, waren mir an nächtlichen Lagerfeuern unzählige Geschichten zu Ohren gekommen. Einige davon waren zu hart, die behielt ich für mich. Aber es gab andere, Geschichten, die gut ausgingen und Hoffnung gaben.
Amina hatte immer ein offenes Ohr für Storys aus dem Indianerleben, weil sie sich auf ihre kindliche Art damit identifizierte. Mike hingegen wollte lieber Verbrechergeschichten aus erster Hand hören. Indianergeschichten, in denen Menschen mit Tieren sprachen, fand er langweilig. Nur die Geschichte vom Windigo , dem kannibalischen Geist aus der Wildnis, fazinierte ihn. Den Windigo fand Mike toll .
Vor ein paar Tagen erst, war Amina in der Bibliothek auf dieses Buch über das Volk der Cree mit der bebilderten Geschichte des Windigo gestoßen und hatte sie Mike gezeigt. Beide waren damit zu mir gekommen. Natürlich kannte ich die Windigo -Geschichte, sie war für mich jedoch mit einem unerklärlichen Grauen behaftet. Ich mochte sie nicht, denn der menschenfressende Unhold geisterte seit ich denken konnte durch meine Nächte und verursachte mir Albträume. Aber das wollte und konnte ich vor meinen Kindern nicht zugeben. Also erzählte ich ihnen an diesem Abend zum wiederholten Mal, was ich über den Windigo wusste.
„Einst war der Windigo ein Mensch wie du und ich. Es war im tiefen Winter, als er schon einige Tage hungrig durch die Wälder streifte, auf der Suche nach einem Tier, das er erlegen konnte. Da begegnete er einer wilden Kreatur, die hatte Haare im Gesicht, an den Armen und Beinen, und besaß ein Herz aus Eis. Da wurde auch sein Herz zu Eis, und von diesem Moment an war er unfähig, menschliche Gefühle zu empfinden. Er irrt umher auf der Suche nach neuen Opfern. Und wer nicht aufpasst, den erwischt er und verspeist ihn.“
Ich packte Mike, zeigte meine Zähne und knurrte wie ein Ungeheuer. Mein Sohn quietschte und lachte vor Vergnügen. Amina verdrehte die Augen. Für meine Kinder war der Windigo ein Märchenwesen - und vor einem Märchenwesen fürchtete man sich nicht.
Ich blieb bei ihnen, bis sie eingeschlafen waren. Nachdenklich betrachtete ich meinen Sohn, der mir sehr ähnlich sah, mit seinem glatten Haar und den schrägen Augen. Mike wollte kein Indianer sein, nicht einmal ein halber. Wie würde er in ein paar Jahren damit klarkommen? Es verletzte mich natürlich, dass Mike mit seiner indianischen Hälfte ein Problem hatte, aber ich wusste, wie er sich fühlte.
Im Alter von acht Jahren hatten auch für mich die Probleme begonnen. Ich sah anders aus als die Kinder, mit denen ich auf Mercer Island zur Schule ging. Aber was noch schlimmer war, ich sah auch anders aus als meine eigene Schwester. Ich fand mich hässlich und litt darunter. Bis Mom mir von ihrer Großmutter erzählte. Granny Arlette war zu drei Vierteln Cree-Indianerin und meine Mutter begründete mein Aussehen mit dieser Blutsverwandtschaft. Sie erzählte mir, dass es genetische Merkmale gibt, die manchmal ganze Generationen überspringen und dann unversehens wieder auftauchen - so wie bei mir. Sie besaß ein vergilbtes schwarz-weiß Foto von Granny Arlette, das sie als junge Frau zeigte, und die verblüffende Ähnlichkeit mit mir überzeugte mich letztendlich.
Doch vor vierzehn Jahren stürzte die Cessna ab, mit der Mom und Dad zum Angelurlaub in Kanada unterwegs waren. Als Alice und ich den Nachlass unserer Eltern sichteten, fielen mir zwischen ihrer Heiratsurkunde, verschiedenen Versicherungspolicen und den Übertragungsurkunden für Verlag und Haus, meine Adoptionspapiere in die Hände. Die Tatsache, dass sie mich belogen hatten, war ein Schock für mich und wirbelte mein Leben mächtig durcheinander. Was heute wahr ist, kann morgen schon nicht mehr wahr sein - das war die Lektion, die ich damals lernte.
Seit dem Tod der beiden war ich auf der Suche nach meiner Vergangenheit. Ich wollte sie finden, meine leibliche Mutter, meinen Vater. Vielleicht hatte ich Brüder und Schwestern, Onkel und Tanten. Menschen, deren genetisches Muster zu meinem passte. Und obwohl meine Nachforschungen bisher ohne Erfolg geblieben waren, konnte ich nicht aufgeben. Das hatte wohl etwas mit Identität zu tun, mit meinen Wurzeln oder auch nur mit der einfachen Wahrheit, die man mir aus unerfindlichen Gründen verweigert hatte.
Auf leisen Sohlen schlich ich aus dem Kinderzimmer, setzte ich mich an meinen Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. Es war an der Zeit, etwas über Daniel Blueboy herauszufinden.
Obwohl ich verschiedene Suchmaschinen benutzte, war die Ausbeute unbefriedigend. Zuerst fand ich einen kurzen Zeitungsbericht vom 28. November 1997. Der siebzehnjährige Cree-Indianer Daniel Blueboy - ein jugendlicher Straftäter - war in den Morgenstunden des 27. November 1997 dreizehn Kilometer außerhalb der Stadt von zwei Gleisarbeitern tot aufgefunden worden. Der Pathologe hatte Alkohol im Blut des Jungen festgestellt und eine gewaltsame Todesursache ausgeschlossen. Blueboy starb an Unterkühlung. In der Nacht seines Todes war die Temperatur auf -28°C gesunken, und der Junge hatte nur T-Shirt, Flanellhemd, einen einfachen Jeansanzug und Sommerschuhen getragen. Die Winnipegger Stadtpolizei vermutete, dass Daniel Blueboy auf dem Weg in das fünf Kilometer entfernte Stony Mountain-Gefängnis gewesen war, um sich dort freiwillig zu stellen.
Diese Zeitungsnotiz - ein Polizeibericht im Lokalteil der Winnipeg Sun - war keine zehn Zeilen lang. Trotzdem wusste ich nun etwas mehr. Und ärgerte mich. Warum hatte Robert Blueboy mir nicht erzählt, dass sein kleiner Bruder in der Nacht, in der er starb, betrunken war und zudem polizeilich gesucht wurde? War Daniel ein Herumtreiber und Krimineller gewesen? Vielleicht hatte er mit Drogen gedealt, hatte versucht, ein kleines Geschäft nebenher zu machen, und war in einem Bandenkrieg zwischen die Fronten geraten. Auf diese Weise waren schon viele Jugendliche unter der Erde gelandet.
Wie auch immer: Niemand hatte es verdient, so zu sterben.
Bei meinen Recherchen stieß ich schließlich auf einen Artikel, den ein Reporter der Winnipeg Free Press am 8. Dezember, also rund zwei Wochen nach Daniels Tod geschrieben hatte. Mark Flanagan äußerte Zweifel an der Darstellung der Polizei, Blueboy wäre auf dem Weg ins Stony Mountain Gefängnis gewesen, als er starb. Der Junge war aus einem Wohnheim für Jugendliche ausgebüchst und wurde deshalb polizeilich gesucht. Betty Blueboy, Daniels Mutter, schwor Flanagan gegenüber felsenfest, ihr Sohn wäre niemals mitten in der Nacht bei – 28°C zu diesem berüchtigten Gefängnis gelaufen, um sich freiwillig zu stellen.
Читать дальше