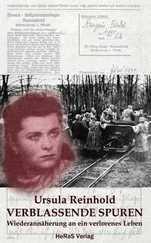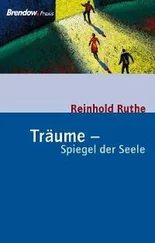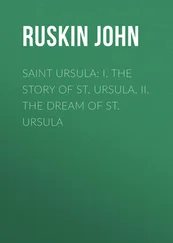Ein Dialog von Ansichten und Gedanken über die Zeit, die wir durchlebt haben und wie sie sich in Büchern von Zeitgenossen spiegelt, so etwas schwebt mir als Struktur für die Niederschrift und Anlage dessen vor, was ich mitzuteilen habe. Dabei geht es mir vor allem auch darum, den eigenen Irrtümern und Illusionen auf die Spur zu kommen.
Hans Magnus Enzensberger. Eine aufregende Begegnung.
Man schrieb das Jahr 1970. Es war Juni und ich hatte erst vor drei Monaten meine Tätigkeit als Redakteurin der Zeitschrift „Weimarer Beiträge“ begonnen. Eines Morgens stürzte die Chefin des Blattes in die Redaktionsräume, die sich in einem schmalen Gebäude am Anfang der Oberwallstraße befanden, nur wenige Meter vom U-Bahn-Eingang Hausvogteiplatz entfernt. Das dreigeschossige Haus stand dort sehr vereinzelt, es gehörte zu den wenigen Gebäuden, die an der linken Ecke des Hausvogteiplatzes stehen geblieben waren. Die Bebauung des ganzen Platzes wies große Lücken auf, sie waren durch die Bombenabwürfe des letzten Krieges gerissen worden. Nur an der Ecke zur Mohren- und Taubenstraße hin war inzwischen ein Neubau entstanden, der aber auch dort den Freiraum nicht füllte, den es gab.
Unsere Redaktion lag im Erdgeschoss des schmalen Gebäudes, während in den oberen Etagen die Redaktion der Wochenzeitung „Sonntag“ und die Werbeabteilung des Aufbau-Verlages untergebracht waren. Aus den Fenstern unserer Redaktion schaute man in Richtung Westen auf den Eingang der U-Bahn Linie, die von Pankow bis Thälmannplatz fuhr, während ich aus meinem Arbeitszimmer in östliche Richtung das Licht der vormittäglichen Sonne erleben und auf Pappeln sehen konnte. Die Bäume vor den Fenstern waren wahrscheinlich in den Jahren seit der großen Zerstörung herangewachsen. Sie standen auf einer Rasenfläche mit Bänken, auf die wir Redakteure uns in der warmen Jahreszeit mittags setzten. Daran grenzte ein ausgedehnter Parkplatz, der zu dem großen Haus gehörte, das in etwa hundert Metern Entfernung zu sehen war. Dort hatte einstmals die Reichsbank residiert, aber zu unserer Zeit war dort der obere Verwaltungsapparat der führenden Partei untergebracht. Wenn ich von meinen Manuskripten aufschaute, aus dem Fenster hinaus, sah ich auf das große Haus. Wir machten Witze darüber, dass die Partei ihre Augen immer überall habe, und lachten gutmütig, weil ja auch wir die Partei waren, fast alle, die wir die Redaktion bildeten. Unsere Chefin ging in dem großen Haus regelmäßig ein und aus und versorgte uns mit den neuesten Informationen aus der Führungsetage der Partei, auf die wir uns einen Reim zu machen suchten. Niemand von uns hätte sich wohl damals vorstellen können, dass in dieses große Haus irgendwann das Außenministerium der Bundesregierung eines vereinigten Deutschlands einziehen und unser schäbiges Gebäude nach gründlicher Sanierung Sitz der Botschaft des Königreichs Marokko sein würde.
Also eines schönen Tages im Juni stürzte die Chefredakteurin wie gewohnt gegen Mittag in die Redaktion. Zu dieser Tageszeit hatte sie ihre Informationsrunde hinter sich und versorgte uns sofort mit den neuesten Nachrichten. Wenn wir unter uns waren, nannten wir Redakteure sie Chefin, ansonsten riefen wir uns bei unseren Vornamen. Sie unterrichtete uns, dass der Dichter Hans Magnus Enzensberger für morgen im Deutschen Theater zu Besprechungen erwartet würde. Man plante dort, im Herbst sein Stück „Das Verhör von Habana“ aufzuführen. Wir sollten uns unbedingt an ihn heranmachen und ein Interview vereinbaren, eine solche Gelegenheit gebe es nicht jeden Tag und zudem stehe unserer Zeitschrift ein solches Gespräch, wenn es denn zustande käme, gut an. Denn gerade hatten wir eine neue Rubrik eröffnet, die den akademischen Habitus der „Weimarer Beiträge“ auflockern sollte. Die Zeitschrift war 1954 im Auftrag der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar von Louis Fürnberg und Hans-Günter Thalheim gegründet worden. Zum wissenschaftlichen Profil gehörte inzwischen - über die deutsche Klassik hinaus - die gesamte deutsche Literaturgeschichte. Seit 1969 gab es Bestrebungen, näher an den aktuellen Literaturprozess heranzukommen. Wir bemühten uns darum, neben literaturgeschichtlichen Beiträgen, auch Artikel über die aktuelle Literatur zu organisieren. So wurden seit kurzem Schriftsteller aus Ost und West in der Zeitschrift vorgestellt, wobei Interviews mit monografischen Beiträgen über Werk und Wirken kombiniert wurden. Die ersten Beiträge waren schon publiziert, Joachim Seyppel war einer der ersten in der Reihe westdeutscher Autoren, die in der Zeitschrift einen Platz fanden. Er war damals weder in West-, noch in Ostdeutschland sonderlich bekannt. Nach längerem USA-Aufenthalt nach Westdeutschland zurückgekehrt, hatte er dort keinen Verleger für seine Satire „Als der Führer den Krieg gewann“ gefunden. Daraufhin suchte er Kontakt zum Aufbau-Verlag in der Französischen Straße. Die Zeitschrift „Weimarer Beiträge“, die verwaltungsmäßig zum Verlag gehörte, kam so zu ihrem ersten Gesprächspartner aus Richtung Westen. Seyppel siedelte wenige Jahre danach in die DDR über, die er etwa zehn Jahre später wieder verließ. Er ging zurück in die Bundesrepublik. Damals hatte er auch die Romane „Abendlandfahrt“ und „Torso Conny der Große“ im Gepäck, die schon gedruckt vorlagen. Später übergab er dem Aufbau-Verlag ein größeres Manuskript von etwa tausend Seiten mit tagebuchartigen Aufzeichnungen: „Nachtbücher über Tage“, so der Titel. Nicht nur die zuständige Lektorin verbrachte schlaflose Nächte über dem Manuskript, auch ich kam in Berührung mit dem Geschriebenen, sollte per Gutachten Vorschläge zur Kürzung machen, die der Autor aber sämtlich verwarf. Es ging dabei weniger um politisch Anstößiges als um allzu Detailliertes und Banales, von dem wir den Text entlastet sehen wollten. Der Autor kämpfte um jedes von ihm geschriebene Wort, aber es gelang der Lektorin dennoch, ein lesbares Buch daraus zu machen. Einige seiner Bücher las ich mit viel Interesse, u. a. sein Reisebuch über Wanderungen nach Fontanes „Ein Yankee in der Mark“ und auch seine Darstellung über die Beziehung zwischen Heinrich Mann und seiner Frau Nelly. Im Wintersemester 1992/93 bin ich ihm in einem Literaturseminar über die Gruppe 47 an der Berliner Humboldt-Universität begegnet, das ich zu leiten hatte und in dem er mir das Programm gründlich durcheinanderbrachte.
Herr Enzensberger war ein prominenter Mann, ein bekannter Autor. Er war seit Jahrzehnten anerkannt. Es war klar, man musste die Gelegenheit beim Schopfe fassen, denn wir konnten nicht einfach zu ihm nach Westberlin fahren, wo er zu dieser Zeit wohnte, und auch er würde nicht jeden Tag über die Grenze kommen. Also du wirst es versuchen, sagte die Chefin, erkundige dich, wann er im DT zu erwarten ist, sprich mit dem zuständigen Dramaturgen, bitte ihn, dich mit ihm bekannt zu machen. Du musst von dort unbedingt eine feste Interviewverabredung mitbringen. Sie sprach nur noch zu mir hin, es war klar, dass ich mit dieser Aufgabe betraut werden sollte. Große Aufregung befiel mich, beinahe bekam ich einen Schreck. Aber natürlich war ich auch stolz darauf, dass sie mir das zutraute. Es gab einen Wirbel in meinem Inneren, das Blut schoß mir in den Kopf, hochrot saß ich nun in der Runde und brachte fürs erste kein Wort heraus. Erst seit kurzer Zeit in der Redaktion hatte ich gerade begonnen, meine Scheu gegenüber den Wissenschaftlern, mit denen ich es zu tun hatte, abzulegen. Manch kritische Zurechtweisung hatte ich erlebt, aber auch, dass meine redaktionellen Vorschläge ernsthaft erwogen und mitunter auch angenommen wurden. Aber es war das erste Mal, dass ich mit einem so prominenten, von mir verehrten Dichter sprechen würde. Ob er sich dazu bereit findet, fragte ich mich.
Unsicher auch darüber, was politisch von einem Mann wie Enzensberger zu halten war. Als Freund der DDR verstand er sich nicht, so viel war mir klar, aber vielleicht kann er als ein Sympathisant gelten, dachte ich, denn als Klassenfeind erschien er mir nicht. Also ich blieb unsicher, auch darüber, ob ich der Sache gewachsen sein würde. Aber ich widersprach dem Vorschlag der Chefin nicht. Ich kannte Gedichte von ihm, war neugierig auf den Mann. Immerhin sagte ich mir, es liegt nahe, dass die Chefin mich mit der Aufgabe betraut, denn ich hatte vor einem halben Jahr eine Dissertation über aktuelle westdeutsche Literaturentwicklungen verteidigt und kannte mich daher in der Materie ein wenig besser aus als die anderen Redakteure.
Читать дальше