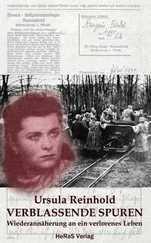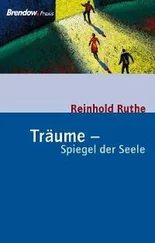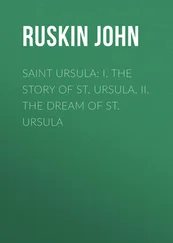Seitenblicke auf Kollegen
Außerordentlich hartnäckig erscheinen mir lieb gewordene Illusionen. Solchen Eindruck gewinne ich aus der Lektüre vieler Darstellungen, denen ich in den Jahren seit 1990 begegnet bin, und in denen Intellektuelle, honorige Leute, Kulturschaffende, Historiker, Literaturwissenschaftler, manchmal Kollegen von mir, durchblicken lassen, wie sie auf die Politik und die Politiker der DDR Einfluss nahmen oder nehmen wollten und wie sie von denen daran gehindert und zurückgewiesen wurden. Die Nachzeichnung solch vergeblicher Bemühungen und unfruchtbarer Kämpfe ist sicherlich notwendig und nützlich. Dabei ist es interessant, aus welcher unterschiedlichen Perspektive die eigene Rolle wahrgenommen wird. Die Selbsttäuschung geht so weit, dass der Eindruck erweckt wird, die Rolle von Intellektuellen und die eigene dabei könne mit Objektivität dargestellt werden. Sicherlich ein verständlicher Wunsch, gegen den die Tatsache spricht, dass es bisher niemandem gelungen ist, die eigene Rolle angemessen zu durchschauen. Es würde mir genügen, die eigenen Intentionen im Gang des Ganzen dargestellt zu finden und dabei auf die Bereitschaft zu stoßen, eigenen Illusionen und Irrtümern nachzugehen. Bei keinem der mir zugänglichen Bilanzen stieß ich auf eine gründliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst-, Politik- bzw. Wissenschaftsverständnis, von dem man sich leiten ließ, während man sich als Mitgestalter der DDR-Gesellschaft sah. Auch unterbleibt meist ein kritisches Bilanzieren des Parteiverständnisses, dem man sich lebenslang verpflichtet fühlte.
Parteibindung marxistischer Intellektueller hatte natürlich ihre berechtigten historischen Anlässe und Gründe, resultierte aus den sozialen und antifaschistischen Kämpfen der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, die die kommunistische Bewegung maßgeblich mittrug. Welche Hypotheken dabei mit dem Stalinismus verbunden waren, ist inzwischen ausführlich nachgearbeitet. Die DDR kam aus diesem Schatten niemals wirklich heraus. Dennoch eröffnete sie mit ihrer Gründung den aus dem Exil zurückkehrenden Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern wie Hanns Eisler, Paul Dessau, Bertolt Brecht, Johannes R. Becher, Erich Weinert, Friedrich Wolf, Anna Seghers, Arnold Zweig, Erich Arendt, Stefan Hermlin, Kuba, Jeanne und Kurt Stern, Stefan Heym u.v.a. ein Feld künstlerischer, literarischer und politischer Wirkungsmöglichkeiten. Schon am Schicksal von Ernst Bloch, Hans Mayer und auf andere Weise auch von Stefan Heym in der DDR, taten sich die Grenzen kritischer Mitsprache auf, die sich bei jüngeren Autoren wie Günter Kunert, Rainer und Sarah Kirsch, Erich Loest, Manfred Bieler zeigten, später dann auch an Restriktionen gegen Christa Wolf, Franz Fühmann, Volker Braun und im letzten Jahrzehnt schließlich daran, dass eine Vielzahl talentierter Autoren in den Westen ging, wie Klaus Schlesinger, Jurek Becker, Klaus Poche u.v.a.. Sie sahen keine Möglichkeit zu produktiver Beziehung mehr, waren der Einschränkungen, Ausschlüsse und anderweitiger Behinderungen überdrüssig.
Das spannungsreich dialektische Verhältnis von Literatur und Politik, wie es sich für die DDR darstellt, scheint mir noch immer ein Desiderat, die Analyse der differenzierten konkreten Erfahrungen steht noch aus; die nach 1990 üblich gewordene Unterscheidung von Dissident und Staatsschriftsteller erweist sich als grobe Simplifikation. Bei ihnen, wie den Intellektuellen in der DDR überhaupt, gab es sehr verschiedene Vorstellungen von Politik, wie sich auch ihr literarisches Selbstverständnis und ihre Ansichten über Eigenart und Wirkung von Literatur in der Gesellschaft unterschieden.
Politisches Handeln war den Intellektuellen in der DDR sicherlich nach und nach immer gründlicher von der Führungskaste abgewöhnt worden. Man hielt sich zurück, war befriedigt, wenn sich diese oder jene kritische Äußerung gedruckt fand, den Weg durch die aufsichtsführenden Behörden hindurch genommen hatte. Aber das war es dann auch schon. Und das Jahr 1990 bestätigte das auf erschreckende Weise. Zum politischen Handeln waren die Intellektuellen und Gesellschaftswissenschaftler der DDR nicht fähig, verblieben in Irritation. Werner Mittenzweis „Brockenlegende“ bestätigt auf unbeabsichtigt ironisch-provokative Weise diesen Fakt, wenn er DDR-Intellektuelle mit Erneuerungswillen in der Eiseskälte einsamer Harzregionen sich zusammenfinden und verenden lässt. Lediglich einige in der DDR ausgebildete Naturwissenschaftler, die der politischen Führung nicht nahegestanden hatten, begaben sich in die Politik. Nur wenige blieben dort, und was ihrer Wirkung zu verdanken ist, bleibt ambivalent und noch nicht absehbar.
Lebendige Zeitgenossenschaft
Von meinen früheren Zusammenkünften mit Schriftstellern waren nicht alle nachdrücklich genug, um bis in die Gegenwart mein Interesse wachzuhalten. Aber, obwohl manche Begegnung einmalig blieb, wirkte dennoch das durch sie geweckte Interesse in meiner Lektüre fort. Mit der Erinnerung an solche unterschiedlich nachwirkenden Begegnungen, die hier beschrieben sind, wird in jedem Fall Zeitgenossenschaft aufgerufen. Aus unterschiedlichen Blickpunkten wahrgenommen, spiegelt sich in Gesprächen mit westdeutschen Autoren ein Stück deutsch-deutscher Beziehung und ihrer Geschichte.
Dabei wird sichtbar, was nicht nur für schreibende Zeitgenossen zutrifft und von Adelbert von Chamisso in die Worte gefasst wurde: „Jeder Dichter betrachtet die Welt aus dem Hals der Flasche, in die er eingeschlossen ist.“ Eine Feststellung, die über Dichter hinaus auch für andere Menschen Geltung beanspruchen kann.
Zeitgenossenschaft stellt sich als eine disparate Angelegenheit dar. Die Rückschau auf sie fördert Ungereimtes, Überraschendes zutage, wenn sich ein Schreiber im Gewirr des Zeitgeistes entdeckt. Solcherlei wird beim Lesen hier begegnen. Geduld ist nötig, um die Fäden zu entwirren. Erinnert wird an Begegnungen mit Büchern und ihren Urhebern in einer Art, die anzeigt, wie sie durch den Zeitgeist bestimmt war und ihn ihrerseits mitbildete. Es spiegelt sich so jüngst vergangene Geschichte, denn die, die sich erinnert, lebte in der DDR, dem untergegangenen Staat und die Schriftsteller, über die sie hier berichtet, denen sie begegnete, deren Bücher sie las und über die sie schrieb, lebten im Westen. Seit zwanzig Jahren nun leben wir in einem Staat.
Ein Kapitel deutsch-deutscher Beziehungen ist damit aufgeschlagen. Westdeutsche Autoren wurden in der DDR gedruckt und gelesen, früher noch, als ostdeutsche Autoren von westdeutschen Verlegern gedruckt wurden. Gelesen wurden selbstverständlich auch Bücher, die in der DDR nicht im Buchhandel zu haben waren. Diese Seite der Rezeption von „Westbüchern“ berührt das Kapitel vom geheimen Leser, über das Simone Barck und Siegfried Lokatis variations- und kenntnisreich ein ganzes Buch geschrieben haben. Die öffentliche Rezeptionsgeschichte der westdeutschen Literatur berührt ebenso wie die Geschichte der Aufnahme der DDR-Literatur im Westen die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Teilstaaten. Sie stellt ein umfangreiches Kapitel von deutsch-deutscher Verlagsgeschichte dar, das in seiner wechselseitigen Beziehung noch darzustellen ist. Für die Verlagsgeschichte der DDR wäre die herausgeberische Arbeit der Verlage Aufbau, Kiepenheuer, Reclam u. a. zu betrachten. Nur erst für den Verlag Volk und Welt ist ein Anfang gemacht worden. Viele Leerfelder scheinen hier auf, die zu untersuchen wären.
Meine Erinnerungen wollen und können solche Leerstellen nicht füllen. Sie verbleiben ganz und gar im Subjektiven. Sie zeichnen Annäherung und Distanz im Umgang mit Autoren und ihrem Werk nach. Beschreiben Lektüreeindrücke, hinterfragen frühere Wertungen und Urteile. Es soll der gedankliche Horizont aufscheinen, der die Prämissen der Urteilenden bildete. Ein schwieriges Unterfangen, weil sich die noch Lebenden stets dem Wind der Zeit ausgesetzt sehen, sich verändern oder auch treu bleiben, auf jeden Fall im Zeitgeist zu Hause sind. Und der war ziemlich anders diesseits und jenseits der Mauer. Dabei ist mein Respekt vor der Leistung vieler hier Porträtierter so groß, dass ich den Drang habe, auch als Mittlerin zu wirken. Denn so ganz und gar kann und will ich meine jahrzehntelang ausgeübte Profession denn doch nicht verleugnen. Daher wird es so sein, dass sich die Schere zwischen Erinnertem und Gedachtem und dem, was mir über Schöpfer und ihre Werke mitzuteilen für nötig scheint, nicht in jedem Fall schließen. Die Autoren sind so verschieden wie mein damaliges und mein heutiges Interesse an ihnen. Auch die Anlässe für eine Wiederbegegnung mit ihren Werken unterscheiden sich. Daher kommt so Vielfältiges hier zusammen, von dem ich dennoch hoffe, dass sich ein Widerschein des lebendiges Prozesses darin finden lässt, der unsere Zeitgenossenschaft gestern und heute ausmacht.
Читать дальше