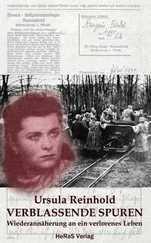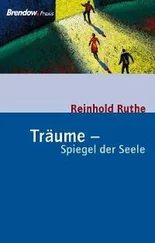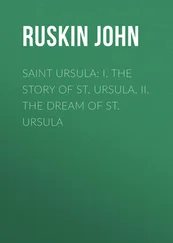1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Die erste Begegnung mit dem Mann war unkomplizierter, als ich sie mir vorgestellt hatte.
Er war in Begleitung einer jungen Frau, die er mir als eine Enkelin Stalins vorstellte. Er nannte mir ihren Namen, den ich mir in der Aufregung leider nicht merkte, und als ich mich später vergewissern wollte, ob das mit der Enkelin stimmte, wusste ich nicht, welchen Namen ich nachschlagen sollte. Daher bin ich mir bis heute unsicher darüber geblieben, ob seine Auskunft stimmte oder ob er mir nur einen Bären aufbinden wollte. Denn, dass ihm ein Schalk im Nacken saß, das war auf Anhieb zu bemerken. Ein Mann von schlanker Gestalt kam mir entgegen, ein beinahe jünglingshaft wirkender Vierzigjähriger mit blondem zum Pony geschnittenem Haar, das die obere Stirn bedeckte. Wahrscheinlich verbarg er damit eine beginnende Glatze, worauf ich damals allerdings nicht achtete. Denn Einzelheiten seines Aussehens sind mir kaum haftengeblieben, sie verschmolzen später mit den in der Öffentlichkeit bekannten Bildern und bestimmen den Gesamteindruck, der mir blieb. Dazu gehört das von vielen Fältchen durchzogene Gesicht, eine deutlich gezeichnete lebhafte Physiognomie. Die Mimik verriet den überaus unruhigen Geist, den widerspruchsvollen Charakter. Lebhaftigkeit bestimmte auch seinen gestischen Habitus, selten nur, dass er in einer Geste länger verharrte. Erstarrung war etwas, was es für ihn nicht zu geben schien. H. M. E. kam mir freundlich im Raum entgegen, drückte mir die Hand, war zuvorkommend und höflich, schob mir den Stuhl zurecht, der für mich herbeigeholt worden war. Leicht ließ ich mich von so viel Zuvorkommenheit beeindrucken, aber ich sollte auf der Hut sein, sagte ich mir, durfte innerlich nicht abrüsten. Denn ich fürchtete seinen Sarkasmus und seine Ironie, ahnte, dass mit ihm nicht immer gut Kirschen essen war, wie es der Volksmund ausdrückt. Er war agil und zu gescheit, um irgend jemandem eine Schwäche durchgehen zu lassen.
Ob er meine Unsicherheit spürte, weiß ich nicht. Überhaupt wird er sich an mich und an die mir so wesentliche Begegnung nicht erinnern. Eher nehme ich an, dass die unbefangene Lebhaftigkeit und Freundlichkeit, mit der er auf mich zuging, der Rolle entsprach, die er sich für die Anbahnung von Beziehungen öffentlichen Charakters schuldig zu sein glaubte. Jahre später las ich in den Erinnerungen von Alfred Andersch, der den jungen Dichter in den Fünfzigerjahren in der Redaktion Radio-Essay im Stuttgarter SWF gefördert und bekannt gemacht hatte, dass es für H. M. E. später für so Unnützes wie ein zweckfreies Gespräch unter Kollegen keine Zeit mehr gegeben habe. Auch teilt uns Andersch mit, dass der damals junge Dichter, den er bei Erscheinen seines ersten Gedichtbandes enthusiastisch gefeiert hatte, der erste gewesen sei, der seine zornigen Verse auf einer elektrischen Schreibmaschine schrieb. Später brachte er auch Alfred Andersch dazu, auf solches Gerät umzurüsten, als der, von Krankheit geschwächt, um seine Arbeitskraft rang. Vielleicht hat er 1970, als wir uns im Deutschen Theater, in der Hauptstadt der DDR, begegneten, schon mit einem PC gearbeitet, wenn es ihn denn schon gegeben hat. Aber danach zu fragen, wäre mir nicht eingefallen. Vor Kurzem erst, dreißig Jahre nach unserer Begegnung, sah ich ihn gealtert auf dem Bildschirm bei einem Podiumsgespräch, das die ARD übertrug. Mit linksgescheiteltem schütterem Haar erschien er mir jetzt als eine überaus korrekte Erscheinung. Verwundert war ich, dass er unablässig rauchte, das war mir verborgen geblieben, oder aber es gehörte damals nicht zu seinen Gewohnheiten. Ja, der Zorn verfliegt, aber die Ironie bleibt, dachte ich in Anspielung auf Worte, die Alfred Andersch über den Dichter geäußert hatte. Noch immer sah man ihn lebhaft reden und schlüssig argumentieren.
Damals brachte ich in die Redaktion eine Verabredung für ein Interview mit. Es konnte erst nach größerem zeitlichen Abstand stattfinden, weil der Dichter zuvor noch auf Reisen ging. Nein, die Fragen, die wir an ihn hatten, wollte er vor unserem Treffen nicht einsehen, denn er war daran gewöhnt, ad hoc zu reagieren. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs sollte sein Bühnenstück „Verhör von Habana“ stehen, das im September 1970 im Deutschen Theater unter der Regie von Manfred Wekwerth Premiere haben würde.
Monate nach der ersten Begegnung ging ich gut präpariert zu unserem neuen Treffen, das in der Wohnung der Chefin stattfand, die ebenfalls zugegen war. Während ich mich an die Szenerie erinnere, wundere ich mich, warum wir an diesem Ort in Lichtenberg zusammenkamen, aber es war damals ihr ausdrücklicher Wunsch und ich sah keinen Grund, ihn nicht zu akzeptieren, obwohl ich an den Club der Kulturschaffenden als Treffpunkt gedacht hatte. Wir saßen in einem mit Bücherregalen vollgestellten Arbeitszimmer und tranken Tee. Während er Platz nahm, machte er eine Bemerkung darüber, dass die Leute hier augenscheinlich gewohnt seien, viele Bücher zu lesen. Wir sahen darin eine Anspielung auf das gerade proklamierte „Leseland DDR“, was aber gar nicht zutreffen musste, weil er über die DDR wenig Bescheid gewusst haben will, wie man später, nach ihrem Zusammenbruch, von ihm hören konnte. Daher ist es wahrscheinlicher, dass er mit seiner Bemerkung auf die im „Kursbuch“ vertretenen Thesen vom Tod der Literatur anspielte. Denn die waren damals in aller Munde. Für Beileidsbekundungen zu ihrem Ableben war das „Kursbuch“ inzwischen zu einer sprichwörtlichen Zuschreibungsadresse geworden, worauf Enzensberger als Herausgeber der Zeitschrift wohl anspielte. Obwohl solche radikalen Thesen nicht von ihm stammten, hatte auch er literarische Produzenten aufgefordert, sich bei der politischen Alphabetisierung der Bundesbürger nützlich zu machen.
Solche direkte politische Funktionszuweisung stand im Gegensatz zur Entwicklungsrichtung der Literatur in der DDR. Hier ging es den maßgeblichen Literaten eher darum, sich direkter politischer Indienstnahme zu entziehen, den spezifischen Rang des Literarischen zu betonen, die Autonomie des literarischen Werkes gegenüber den Einsprüchen der Politiker zu begründen bzw. erst einmal herzustellen. Für linke Intellektuelle in der Bundesrepublik deutete sich damals in mehr oder weniger radikalen Äußerungen ein hoher Grad politischer Veränderungsbereitschaft an. Vor diesem Hintergrund erschienen Wirkungsmöglichkeiten des Literarischen nur noch als begrenzt. Es war eine Zeit, in der vor allem junge linke Schriftsteller neue Arbeits- und Wirkungsfelder mit dokumentarischen Arbeiten, mit Agitprop-Versen und anderen operativen Formen suchten und fanden und prominente Autoren wie Heinrich Böll, Günter Grass, Alfred Andersch, Martin Walser und Hans Magnus Enzensberger sich öffentlich in politische Vorgänge einmischten, wobei ihre Ansichten und Haltungen deutlicher als bisher differierten.
Merkwürdig ist, dass meine Erinnerung an die Gesprächssituation mit dem, was schwarz auf weiß als Interview überliefert ist, nicht recht zusammengeht. Das wird mir bei der neuerlichen Lektüre bewusst, und ich frage mich, woran das liegt. Wahrscheinlich, vermute ich, hängt es damit zusammen, dass mir im Gedächtnis vielerlei wach wird, wenn ich den Namen Hans Magnus Enzensberger aufrufe. Alles, was ich die Jahre danach von und über ihn gelesen habe, ist in meine Vorstellung eingegangen.
Hans Magnus Enzensberger war damals ein wichtiger Protagonist des linken Zeitgeistes. Als kritischer Beobachter und Zeitzeuge hat er Studentenbewegung und außerparlamentarische Opposition mitgetragen und kritisch begleitet. Er trat mit programmatischen Thesen hervor, brachte als Publizist internationale Erfahrungen ein, beteiligte sich an direkten Protesten, besuchte Sit-ins, sprach auf ihnen und anderen Kundgebungen. Politische Aktionen nahm er als Feld neuer gesellschaftlicher Erfahrung wahr, als eine Möglichkeit, Praxis kennenzulernen. Zugleich trat er als deren Kritiker hervor, analysierte und begleitete Programme und Aktionsformen mit prüfenden Randglossen. Dabei blieb er ein Dichter, der politischen Bewegungen nur so weit verpflichtet blieb, wie es die Widersprüche, auch die eigenen zuließen. Seine literarische Produktivität, die sich vor allem an den öffentlichen Angelegenheiten entzündet, entsteht aus den widerspruchsvollen Reibungsflächen der wirklichen Bewegungen. Es sind vielgliedrige Arbeitsfelder, auf denen sich der Dichter bis heute bewegt. Neben der Lyrik sind es Essays zu weitgespannten, sehr verschiedenen gesellschaftlichen Themen, von der Rolle der Bewusstseinsindustrie bis zu den großen Flucht-und Wanderungsbewegungen infolge von Krieg und Bürgerkriegsereignissen in den neunziger Jahren. Dazu kommen Einsprüche zu innen- und außenpolitisches Vorgängen, Hörspiele, Stücke, dokumentarische Biografien und nicht zuletzt die Selbstauskünfte zu verschiedenen Zeiten, die mein heutiges Bild bestimmen.
Читать дальше