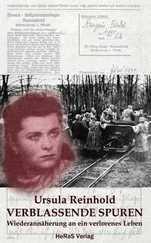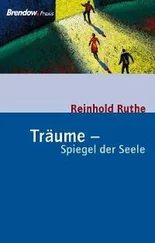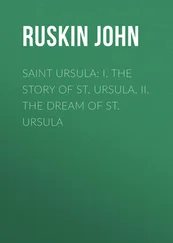1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 H. M. Enzensberger gehörte zu den lebenden Dichtern, deren Verse ich seit Langem las und schätzte. Drei Lyrikbände von ihm befanden sich unter meinen Büchern. Meine Mutter hatte sie mir aus Westberlin mitgebracht. Darin beeindruckten mich besonders die lyrischen Schimpfkanonaden, mit denen er gegen die stumpfe Mentalität der Wohlstandsbürger zu Felde zog. Mir gefiel, wie er die gedankenlose Saturiertheit geißelte, die alles geschehen ließ, fürs Wohlleben Restauration und Wiederbewaffnung in Kauf nahm. Als „Verteidigung der Wölfe“ getarnt, hielt er den Lämmern den Spiegel vor, in dem sie sich als willfährige Opfer eigener Blindheit betrachten konnten. Die Bewusstlosigkeit von Volksmassen, ihre Manipulierbarkeit für fremde Zwecke, ihre Korrumpierbarkeit durch scheinbare Wohltaten brachte er auf unverwechselbare Weise zur Sprache:
„wer näht denn dem general/ den blutstreif in seine hose? wer/ zerlegt vor dem wucherer den kapaun?/ wer hängt sich stolz das blechkreuz/ vor den knurrenden nabel? wer/ nimmt das trinkgeld, den silberling,/ den schweigepfennig? es gibt/ viel bestohlene, wenig diebe; wer/ applaudiert ihnen denn, wer/ steckt die abzeichen an, wer/ lechzt nach der lüge?/ seht in den spiegel: feig,/ scheuend die mühsal der wahrheit, / dem lernen abgeneigt, das denken/ überantwortend den wölfen,/ der nasenring euer teuerster schmuck,/ keine täuschung zu dumm, kein trost / zu billig, jede erpressung/ ist für euch noch zu milde.(...) gelobt sein die räuber: ihr,/ einladend zur vergewaltigung,/werft euch aufs faule bett/ des gehorsams, winselnd noch/ lügt ihr, zerrissen/ wollt ihr werden, ihr/ ändert die welt nicht.“
Solche wortkräftigen Bilder hinterließen bei mir einen nachhaltigen Eindruck, denn der Dichter konterkarierte eine Vorstellung vom Volk, die mir zu einseitig positiv, ja euphemistisch erschien, weil man auch in der DDR erleben konnte, wie dem Volk stets das Hemd näher war als der Rock. Es war doch allzu bereit, für Augenblicksbedürfnisse Ziele und Ideale aufzugeben, sie einfach an den Nagel zu hängen. Von solch rein pragmatischer Haltung wollte ich mich früh unterscheiden, Wissen und Überzeugungen erlangen, um die neue Gesellschaft mitzugestalten. Zudem erinnerten sie mich an die mehr prosaischen Schimpfkanonaden meines Vaters, der häufig über die Borniertheit der Menschen, ihre Sturheit und ihre egoistische Habgier und Enge wetterte.
Auch die poetischen Bilder und melancholischen Töne des Rückzugs zu den Schilfpfeifern und Brachvögeln des Nordens in „Blindenschrift“ gingen mir nahe, weil sie meine Sehnsucht nach Ferne ansprachen. Natürlich war mir geläufig, dass diese lyrischen Äußerungen einer schon vergangenen Lebensperiode des Mannes angehörten. In den letzten Jahren hatte er sich stark in politischen Aktionen und Bewegungen engagiert, war in vielen Ländern der Welt herumgekommen, in Europa und in den USA. Die Vereinigten Staaten hatte er 1968 mit einer öffentlichen Erklärung gegen den Vietnam-Krieg in Richtung Kuba verlassen. Dort und auch in Moskau hielt er sich einige Zeit auf. Seitdem die Studenten auch in Westberlin auf die Straße gingen, lebte er nebenan. Seine bei Suhrkamp erschienenen Untersuchungen zur Bewusstseinsindustrie kannte ich und bewunderte die analytische Schärfe und präzise Sprachkraft des Essayisten. Auch war mir bekannt, dass er seit 1965 im Suhrkamp Verlag das „Kursbuch“ herausgab, kannte die Zeitschrift und hatte manchen Beitrag gelesen.
Bereits 1965 hatten die Herausgeber mit Betrachtungen und Analysen zur „Europäischen Peripherie“ begonnen, die Aufmerksamkeit auf die Verhältnisse in der Dritten Welt zu lenken und den Widerspruch zwischen dem reichen kapitalistischen Norden und dem Elend in den Entwicklungsländern als grundlegenden Widerspruch ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zu rücken. Mit einem „Katechismus zur deutschen Frage“ suchten sie durch neue Blickpunkte die verfestigte Spannung zwischen den beiden deutschen Staaten zu lockern. Sie verlangten Gespräche mit der DDR, schlugen Schritte zur Anerkennung des zweiten deutschen Staates vor, die die angespannte Lage verändern und die Perspektive zur Bildung einer Konföderation eröffnen sollte. Einen zentralen Platz nahmen Analysen der APO-Aktionen ein, in deren Kontext Fragen der Literatur, ihrer Funktion und ihrer Möglichkeiten im politischen Kampf erörtert wurden.
Die Zeitschrift war seit ihrer Gründung zum ideellen Wegbereiter der neuen Linken geworden und gewann auf die junge Intelligenz, die sich als außerparlamentarische Opposition verstand, erheblichen Einfluss. Zum Zeitpunkt unseres Zusammentreffens hatte Enzensberger den Suhrkamp Verlag bereits verlassen, er war dabei, die Zeitschrift „Kursbuch“ auf eine eigene verlegerische Basis zu stellen.
Das „Kursbuch“ sollte über verschiedene verlegerische Bindungen, redaktionelle und inhaltliche Modifikationen hinweg, 1980 zog sich ihr Gründer Enzensberger aus der Herausgeberschaft zurück, mehr als vierzig Jahre lang existieren. Erst beim Übergang ins 21. Jahrhundert war das Renommee linker Intelligenz so weit aufgebraucht, dass die Zeitschrift 2008 wegen mangelndem Interesse eingestellt werden musste. Es mag ein Zufall sein, aber es erscheint mir signifikant, dass kurz darauf auch die Bahn ihre Kunden darüber informierte, dass sie fernerhin auf die Herausgabe eines Kursbuches verzichten muss.
„Lies keine oden, mein sohn, lies die fahrpläne:/ sie sind genauer“, schrieb Enzensberger den Dichtern damals ins Tagebuch, um sie von zeitabgehobener Romantik auf die Tatsächlichkeiten des politischen und sozialen Alltags hinzulenken. Drei Jahre zuvor hatte im „Kursbuch“ die Debatte über ein mögliches Ende der Literatur begonnen. In einigen Beiträgen wurde gar ihr Tod verkündet. Man flocht der schönen Dichtung mannigfache Kränze, um sie in politisierter Form schon bald wieder auferstehen zu lassen. Obwohl Enzensberger solchen völlig nihilistischen Standpunkt nicht teilte, wurde er häufig, damals und mitunter auch später noch, mit den dort vertretenen radikalen Thesen identifiziert. Offensichtlich war, dass sich sein Verständnis von literarischer Arbeit gegenüber seinen Anfängen deutlich modifiziert hatte. Er suchte genauer als bisher ihre Funktion ins Auge zu fassen und für Veränderungen offen zu sein. Neue Gegenstände fesselten sein Interesse, er nahm andere Formen in Gebrauch, alles Schreiben bezog sich direkter auf eine sich politisierende Öffentlichkeit. Sein Beitrag von 1967 „Gemeinplätze, die neueste Literatur betreffend“ umriss mit provokativen Thesen diesen Wandel. Vorstellungen von einem autonomen literarischen Kunstwerk erklärte er hier für obsolet, gab zu erkennen, dass er Autoren, die weiterhin autonom Literarisches produzierten, für nicht mehr zeitgerecht hielt. Politik galt als das Gebot der Stunde, ja, man diskutierte, ob die Situation als revolutionär anzusehen sei.
Auf jeden Fall war Hans Magnus Enzensberger ein Autor, der mich brennend interessierte. Und es gab genügend echte Fragen, die ich ihm stellen wollte, ich musste mir nichts aus den Fingern saugen. Welche Rolle er der Literatur zumaß, war durchaus eine Frage, die mich damals beschäftigte. Mich interessierte, wie sich sein Verständnis von literarischer Arbeit gegenüber seinen Anfängen modifiziert hatte. Wie sah er den gesellschaftlichen Kontext, in dem er sich bewegte? Denn, dass er auch in der Zeit radikaler Thesen nicht aufgehört hatte, zu dichten, stellte sich erst einige Zeit später heraus, als ein Suhrkamp Taschenbuch 1971 Gedichte auch aus den letzten fünf Jahren vorstellte.
Nur meine angeborene Schüchternheit konnte mir im Wege stehen, sie hemmte mich mitunter gänzlich unerwartet. In diesem Fall kamen Respekt vor dem Mann und die Unsicherheit hinzu, nur wenig von all den Dingen wirklich gelesen zu haben, vieles nur vom Hörensagen zu kennen, was da im anderen Teil Deutschlands an aktuellen Ereignissen so quirlig und unübersichtlich ablief. Immer behielt ich das Gefühl, über alles nur ungenau informiert zu sein. Dann beruhigte ich mich wieder bei dem Gedanken, dass uns in der DDR solche geistigen und politischen Wirrnisse erspart blieben, weil man hier die Zukunft sicher im Auge hatte. Aber man musste denen dort drüben helfen, ihren Weg zu finden. Nur, ob ich dafür die geeignete Person war, darüber war ich im Zweifel, und ich verbrachte schlaflose Nächte bis zum Termin des Zusammentreffens, den mir das Sekretariat des Deutschen Theaters vermittelt hatte.
Читать дальше