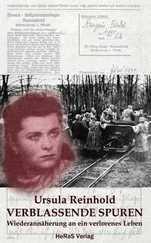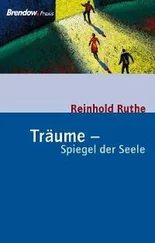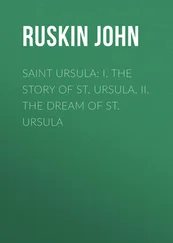Doch auf die Editionsgeschichte möchte ich kurz zurückkommen und auf einige für mich wichtige Erfahrungen eingehen. Erinnerungen, die sicherlich nicht für das gesamte Herausgeberkollektiv stehen, zu dem noch Dieter Schlenstedt und Horst Tanneberger gehörten. Die Gruppe hatte sich in dieser Zusammensetzung erst im Laufe der Arbeit in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre zusammengefunden, als sich die Pläne für eine Edition zu konkretisieren begannen. Horst Tanneberger ist die Vervollständigung der Protokollabschrift auf der Grundlage der Tonbandmitschnitte zu danken, die im Archiv des Rundfunks zu finden waren. Redaktionelle Mitarbeit leisteten auch Hannelore Adolph und Elisabeth Lemke (†).
Das genaue Datum des Tages im Jahr 1985 erinnere ich nicht, an dem wir, Dieter Schlenstedt und ich, einen Termin beim stellvertretenden Minister für Kultur der DDR, dem Verantwortlichen für Druckgenehmigungen, Klaus Höpcke, wahrnahmen. Er war bereits brieflich von dem Plan, das Protokoll herauszugeben unterrichtet worden, und hatte uns wissen lassen, dass er der Sache insgesamt nicht negativ gegenüberstehe. Aber er bat uns darum, ihm eine Konzeption vorzulegen, aus der die Probleme ersichtlich würden, die der Publikation bisher im Wege gestanden hatten. Wie wir mit diesen Fragen umgehen wollten, wie man sie durch Anmerkungen und Kommentare neutralisieren, für das politische und literarische Verständnis, das in der DDR herrschte, publikabel machen könnte, wollte er von uns wissen. Wir überlegten und entwickelten den Plan, die Seiten so einzurichten, dass in einer Spalte der fortlaufende Text der Reden und Diskussionsbeiträge gedruckt werden sollte. Daneben wollten wir einen fortlaufenden Kommentar setzen, der auf politische Großereignisse eingehen, erklärende und polemische Kommentare enthalten sollte. Wir hofften auf diese Weise, die Spuren, die die beginnende politische Konfrontation in den Reden hinterlassen hatte, parteilich zu kommentieren, wie wir gegenüber Höpcke verlauten ließen. Wir waren uns klar darüber geworden, dass das besonders schwierig gegenüber den Stellungnahmen der sowjetischen Schriftsteller sein würde. Die Entgegnungen, mit denen Katajew und Gorbatow auf die Attacke von Melvin Lasky, der die mangelnde Rede- und Pressefreiheit in der Sowjetunion zum Thema gemacht hatte, reagierten, waren so unsachlich, lügnerisch und unzutreffend, dass wir ganz und gar ratlos waren, weil uns dazu nichts einfiel. Peinlich eben. Auch die kritischen Hinweise auf Verhaftungen von Studenten an der Berliner Universität, die damals die Öffentlichkeit erregten und sie sogleich auch spalteten, waren ein Punkt, bei dem wir nicht wussten, wie wir uns zu ihm stellen sollten. Die Arbeit dauerte lange, die Rekonstruktion der Vorgeschichte des Kongresses, die Komplettierung der Teilnehmerliste, die Befragungen der noch lebenden Zeitzeugen, die Erarbeitung einer Übersicht über die damals nur gekürzt veröffentlichten Beiträge des Kongresses, sowie die Recherchen zur Nachgeschichte, die Suche nach Spuren, die er in Memoiren und anderen Zeugnissen hinterlassen hatte, erforderten eine intensive Recherche in Archiven und Bibliotheken. Das war unser Glück, denn so wurde die von uns geplante parteiliche Kommentierung hinfällig, wortwörtlich von der Zeit hinweggefegt. Erstaunlich finde ich es im Rückblick, wie lange wir brauchten, bis wir die Idee der durchgehenden Kommentierung aufgaben und uns auf die Sachanmerkungen beschränkten, die für das Verständnis des Ereignisses unerlässlich waren. Es brauchte eine Weile, um aus der Erkenntnis der historischen Vorgänge des Kalten Krieges die notwendigen Konsequenzen versachlichender Darstellung zu ziehen, um nicht erneut in die Muster der Konfrontation zurückzufallen.
Während unserer Arbeit jährte sich das Ereignis schon zum 40. Mal und aus diesem Anlass organisierte die Sektion Literatur der Akademie der Künste der DDR im Herbst 1987 eine Veranstaltung, die noch lebende Zeitzeugen und Interessierte zusammenführte, während Beiträge einiger Teilnehmer verlesen wurden. Damit wuchs das öffentliche Interesse an der Sache, mich erreichte die Anfrage eines Westberliner Kollegen, der das Material einsehen wollte. Natürlich gab ich ihm die Gelegenheit, was ihn überraschte, denn es gab die verbreitete Vorstellung, dass es sich bei dem Protokoll um ein Geheimdokument handelte. Im Sommer 1989 vermittelte ich auch Ruth Rehmann die Einsichtnahme in das inzwischen wieder im Archiv des Schriftstellerverbandes liegende Urmanuskript. Sie schrieb darüber ihren schönen Roman „Unterwegs in fremden Träumen“, in dem sie das Lesen der Reden, die Erinnerungen an eigenes Erleben in der Nachkriegszeit und die Wendeereignisse des Jahres 1989/90 erzählerisch in Beziehung setzt.
Als eine wichtige Erfahrung sind mir die Gespräche in Erinnerung geblieben, die ich mit den noch lebenden Akteuren von damals führen konnte. Die meisten von ihnen gehörten seinerzeit zu den jungen Autoren. Annemarie Auer, Ernst Rudolf Greulich, Elfriede Brüning, berichteten, wie sie sich im Kreise der Gestandenen gefühlt hatten. Von ihnen erfuhr ich über die Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Schriftsteller, die sich unter der Ägide von Peter Kast gegründet hatte und hörte, in welchem Verhältnis sie zum SDA, dem gesamtberliner Schutzverband Deutscher Autoren stand. Klaus Gysi, Stefan Hermlin, Wolfgang Harich waren damals schon als Redner aufgetreten. Alle erinnerten sich an den Auftritt von Melvin Lasky als an einen auffälligen Eklat. Von Ernst Rudolf Greulich erfuhr ich, dass die Einladung an Walter Kolbenhoff und Alfred Andersch, der auf der Einladungsliste gestanden hatte, aber nicht anwesend war, auf seine Anregung zurückging. Kolbenhoff, der dabei war, widmete dem Ereignis in seiner Autobiografie später viel Raum. Am intensivsten war der Eindruck des Gesprächs mit Wolfgang Harich, das in Fortsetzungen stattfand. Er stand der Idee, das Protokoll zu veröffentlichen, ausgesprochen ablehnend gegenüber, weil er die Zeit für Bemühungen um die Einheit Deutschlands für abgelaufen hielt. Ich erfuhr, dass er aufgrund seiner Verurteilung und Haft, die er 1956-1964 wegen politischer Kontaktaufnahme zur SPD erleiden musste, seinen politischen Standpunkt vollkommen gewechselt hatte und alle Bemühungen für die Einheit Deutschland als Schnee von gestern ansah. Abgrenzung und Konsolidierung des sozialistischen Systems in der DDR war für ihn das Gebot der Stunde, alles andere hielt er für verhängnisvolle Illusionen. Aber abgesehen davon, geriet er ins Erzählen, gab Zeitcharakteristisches preis, berichtete über Zeitgenossen und über die eigene Rolle als junger Kritiker und polemischer Geist. Auch die brieflichen Auskünfte von Axel Eggebrecht, Walter Kolbenhoff u. a. gaben zusätzliche Informationen, alles Verwertbare, das von allgemeinerem Interesse war, haben wir in Anmerkungen oder in der Einleitung untergebracht. Inzwischen hatten wir uns längst zur sachlich informierenden Form durchgerungen. Als das Material 1991 endlich komplett war, befand sich der Aufbau-Verlag in Umstrukturierung. Der neue Eigentümer konnte sich nicht zur Produktion des absehbar kostspieligen Bandes entschließen. Auch die Einholung von Lizenzrechten erschien ihm zu kompliziert. Nun gingen wir in der westlichen Verlagslandschaft auf die Suche nach einem neuen Verleger. Wir fanden verschiedentlich Interesse, aber bis zu einer Veröffentlichung kam es bei den Kontakten nicht. Das Buch würde zu teuer, hieß es immer wieder. Wir waren erleichtert, als der Aufbau-Verlag das 50. Jubiläum des Kongresses dann doch zum Anlass für die Veröffentlichung der Materialien nahm, die eine große publizistische Aufmerksamkeit fanden. Auf einer Konferenz am Germanistischen Institut der Berliner Humboldt-Universität fanden sich Wissenschaftler und Zeitzeugen zum Gespräch zusammen. Das Deutsche Theater, eine der Tagungsstätten von damals, veranstaltete eine Matinee.
Читать дальше