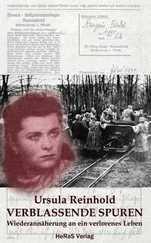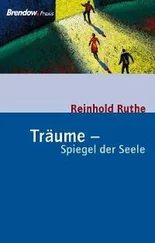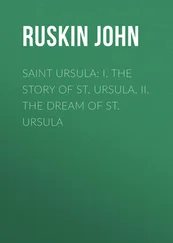Ursula Reinhold - Erlesene Zeitgenossenschaft
Здесь есть возможность читать онлайн «Ursula Reinhold - Erlesene Zeitgenossenschaft» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Erlesene Zeitgenossenschaft
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erlesene Zeitgenossenschaft: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Erlesene Zeitgenossenschaft»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Erlesene Zeitgenossenschaft — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Erlesene Zeitgenossenschaft», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Aber zunächst noch einmal zurück zu meinen Studien über Alfred Andersch. Von seinen Werken war in der DDR nur wenig gedruckt. Da er als Renegat der kommunistischen Partei angesehen wurde, tat man sich lange Zeit schwer mit der Herausgabe seiner Bücher. Erst 1973 brachte der Aufbau-Verlag eine erste Auswahl von Erzählungen mit dem Titel „Alte Peripherie“ heraus. 1976 erschien der damals neu entstandene Roman „Winterspelt“, während alle früheren Romane bis zum Jahr 1990 ungedruckt blieben. Als sie dann im letzten Jahr der DDR erschienen sind, gingen sie ganz und gar unter. Aber eine Auswahl von Reisebildern „Aus einem römischen Winter“ (1979) und einen Band mit Gedichten, „Empört Euch, der Himmel ist blau“ (1980) brachte der Aufbau-Verlag heraus, während er 1981 die Erzählung „Der Vater eines Mörders“ schon aus dem Nachlass drucken musste. Alfred Andersch war am 21. Februar 1980 verstorben. Sein früher Tod, er war erst 66 Jahre alt, forcierte mein Interesse, und leider begann ich erst dann zielgerichtet über den Weg des Autors und über sein Werk zu arbeiten. Zuvor hatte mich der Roman „Winterspelt“ zu einer euphorischen Besprechung angeregt. Mich faszinierte die erzählerische Eigenart und intensive Form der Nachfrage, mit der Andersch an das Sujet des Krieges ging, und wie er das vergangene Geschehen an die Gegenwart heranrückte. Er entwickelt hier eine Erzählform, die ein gedankliches Modell mitliefert, mit dem der historische Vollzug der tatsächlichen Geschichte die Frage nach ihren anderen Möglichkeiten, ihrem alternativen Verlauf entstehen ließ. Er arbeitet gegen eine Vorstellung von geschichtlichem Determinismus, weist auf die Geschichte als Ergebnis menschlichen Handelns und deutet so auf ihre Offenheit für Möglichkeiten, die ihrem Verlauf eine andere Richtung geben können. Ein wunderbar poetisches Kammerspiel um eine nicht stattgefundene Aktion, die, hätte es sie gegeben, den Krieg schneller hätte beenden können.
Meine Recherchen zu Alfred Andersch führten mich ins Literaturarchiv nach Marbach. 1982 bekam ich die Erlaubnis an seinem Nachlass zu arbeiten. Es waren erst grob geordnete Materialien, die in Kisten untergebracht waren. Aber ich konnte die Vorarbeiten zu „Winterspelt“ einsehen, konnte so genaueres über die Entstehungsgeschichte des Romans erfahren. Außerdem bekam ich das nicht völlig fertiggestellte Manuskript zu dem Hörspiel über die Flucht von Hans Beimler in die Hände, das davon zeugte, in wie starkem Maße Andersch sich am Ende seines Lebens mit den frühen Jugenderfahrungen beschäftigt hatte. Vor allem aber brachte mir der Aufenthalt dort auch eine Erfahrung mit mir selbst, die mir bestätigte, was ich schon ahnte. Zu den mutigsten Menschen gehöre ich nicht. Ich wusste und stieß bei meiner Suche auf die Tatsache, dass Alfred Andersch ein Verehrer und Leser von Ernst Jünger war. Nun entdeckte ich, dass es einen über Jahrzehnte währenden Briefwechsel mit dem Älteren gab. Natürlich wollte ich nun gerne die Jünger-Briefe sehen, die sich im Nachlass fanden. Ich hätte dazu die Genehmigung Jüngers einholen müssen. Man sagte mir, dass das keine Probleme mache, man könne mir den Kontakt vermitteln, da Kirchberg nicht weit entfernt sei und die Frau des Dichters als langjährige Mitarbeiterin des Archivs die Sache vermitteln würde. Ich war elektrisiert von der Möglichkeit, verbrachte eine schlechte Nacht wegen meiner Unfähigkeit, mich zu entscheiden, weil ich an die Folgen dachte. Was würde kommen, wenn ich zurückkehrte. Denn in der DDR galt Ernst Jünger als eine Unperson, als Militarist, dem man auch als Literat keine Reverenzen erweisen wollte. Ich unterließ es, mich um eine Genehmigung zu bemühen, und hatte lange das Gefühl von Versäumtem in mir. Nach der Wende habe ich den Briefwechsel eingesehen, um festzustellen, dass er eigentlich wenig substanziell war, vor allem aus freundlichen Grüßen und Gratulationen zu neuen Büchern besteht. Nur zu „Kirschen der Freiheit“ hatte sich Jünger ausführlicher geäußert, er sah hier Entsprechungen zum eigenen Positionswechsel, der sich nach dem Krieg vollzogen und sich auch in seinem Buch „Der Waldgang“ (1951) niedergeschlagen hat. Mich interessierte das nun nicht mehr. Viel neugieriger war ich darauf, was zwischen Andersch und Jean Amery brieflich ausgetauscht worden war. Der Freitod von Jean Amery lag erst kurze Zeit zurück.
Meine Arbeit über Andersch hat mich nach der Vereinigung in Kontakt zu der 1994 gegründeten Alfred Andersch-Gesellschaft gebracht, der allerdings keine lange Lebensdauer beschieden war. Aber immerhin gab es einige Zusammenkünfte, und es gab die Möglichkeit, mit Kollegen in Kontakt zu kommen, von denen ich bisher nur Publikationen kannte.
Mein spezielles Interesse an dem Autor war auch durch die Eigentümlichkeit bestimmt, mit der sich Leben und Werk im Schreiben von Andersch berühren. Vom frühen Bericht „Die Kirschen der Freiheit“ bis ins Spätwerk bleibt für sein Schreiben die existenzielle Grunderfahrung wesentlich, mit der er als junger Mann die faschistische Machtergreifung und ihre Stabilisierung erlebt hat. Als Sekretär des Kommunistischen Jugendverbandes von Südbayern verbringt man ihn für Monate ins Konzentrationslager Dachau. Angst und Wut, Isolation und Rückzug auf sich selbst, auf die Kunst und das eigene Überleben bestimmten seinen Weg in den folgenden Jahren. Die Anpassung ging so weit, dass er zeitweilig sogar einen deutschen Sieg für möglich hielt. Erst mit der mutigen Entscheidung zur Desertion von der Wehrmacht im Sommer 1944 wächst ihm die Selbstachtung zu, späterhin davon zu erzählen, denn Passivität, Anpassung und Fluchtbewegungen nach innen sind verbreitete Haltungen, über die er nun kritisch reflektierend erzählen kann. Der authentische Kern seiner Prosa ist es, der mich bewegt und natürlich die wachsende erzählerische Souveränität, die er sich über die Jahre erwarb. Darüber hinaus interessierte mich Andersch auch als Akteur des literarischen Lebens in Westdeutschland, das er als Studioleiter im Rundfunk bei der Entwicklung von Hörspielen und als Herausgeber der Zeitschrift „Texte und Zeichen“ in den Vierziger- und Fünfzigerjahren maßgeblich mitgeprägt hat.
Die Arbeitsjahre am ZIL brachten mir über die speziellen Arbeitsvorhaben hinaus Zuwachs an historischen und theoretischen Erkenntnissen. Dazu trug ein intensives Arbeits- und Diskussionsklima bei. Vor allem auch die theoretischen Arbeiten zu Problemen der Literaturrezeption, die im Theoriebereich des ZIL erarbeitet wurden, Diskussionen über Literatur im Exil, auch die Diskussionen zur Konzeptionsbildung für das „Lexikon Sozialistischer Literatur“ trugen dazu bei, mein Literaturverständnis zu entwickeln.
Die Absicht, das Protokoll des 1. Deutschen Schriftstellerkongresses zur Veröffentlichung zu bringen, entwickelte sich im Zusammenhang mit den erwähnten Arbeitsfeldern zur Nachkriegsentwicklung. Der im Oktober 1947 veranstaltete mehrtägige Kongress in Berlin blieb die einzige gesamtdeutsche Zusammenkunft von Schriftstellern aus den vier Besatzungszonen in der Nachkriegsgeschichte. Der Kongress fand in der Viersektorenstadt unter schwierigen materiellen Verhältnissen statt und vereinigte Autoren nicht nur aus Ost und West, sondern auch Schriftsteller unterschiedlicher weltanschaulicher Überzeugungen und politischer Haltungen. Autoren, die im Widerstand gestanden oder die Hitlerzeit in der Emigration überlebt hatten, manchmal aus ihr noch nicht wieder zurückgekehrt waren. Sie trafen auf solche, die die Zeit in Deutschland zurückgezogen überstanden oder mit mehr oder weniger Kompromissen erlebt hatten. Das Treffen war ein wichtiges, viel beachtetes Ereignis. Dennoch unterblieb die vollständige Veröffentlichung der Reden, Diskussionsbeiträge und Dokumente der Veranstaltung. Der beginnende Kalte Krieg, der schon während der Versammlung zu spüren war, brachte es mit sich, dass das stenografische Protokoll ungedruckt im Archiv des Schriftstellerverbandes in der Berliner Friedrichstraße liegenblieb. Es hatte Versuche gegeben das zu ändern, die allerdings ohne Erfolg geblieben waren. Sigrid Bock hatte sich um das Protokoll bemüht und einen Artikel über den Kongress geschrieben, auch betreute sie in den Siebzigerjahren eine Dissertation, die sich mit dem Kongress beschäftigte. Woran die Pläne zur Veröffentlichung des Protokolls gescheitert sind, war nicht so genau herauszufinden, niemand wusste mir die Gründe genau zu nennen. Daher versuchte ich nun, Einblick in die stenografische Mitschrift zu bekommen. Das war nicht so schwierig, wie ich es erwartet hatte. Zu meiner Überraschung bekam ich den Stapel Papier ausgehändigt und konnte mich darin vertiefen, lediglich verpflichtete man mich im Sekretariat des Schriftstellerverbandes zur Verschwiegenheit im Umgang mit dem Material. Das Manuskript war in keinem guten Zustand, dass graue Papier war bereits brüchig, es gab unlesbare Stellen. Dazu kamen Auslassungen, die wohl darauf zurückzuführen waren, dass die Stenografen dem Tempo des Wortwechsels mitunter nicht folgen konnten, auch Abbrüche gab es. Aber dennoch, das, was ich las, erregte mein höchstes Interesse. Ich fand, dass es veröffentlicht werden musste. Denn war es nicht allein schon bewundernswert, dass Menschen in einer so schwierigen, von Ruinen, Hunger und Not bestimmten Zeit den Gedanken fassten, ein Treffen von Schriftstellern zu organisieren, um sich zu verständigen, wie mit Geschriebenem zur Überwindung der geistigen Hinterlassenschaften des Faschismus beizutragen wäre. Dabei gingen gemäß unterschiedlicher Haltungen und Erfahrungen auch die Vorstellungen darüber weit auseinander. Aber hier ist nicht der Platz, erneut über den Kongress zu handeln. Denn der Band mit dem Protokoll und den vom Kongress verabschiedeten Dokumenten liegt seit 1997 gedruckt vor, der Aufbau-Verlag veröffentlichte das Material nach einem halben Jahrhundert, das seit dem Ereignis vergangen war. Jeder Interessierte kann sich in das Gesprochene vertiefen, die Bilder anschauen, die uns überliefert sind.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Erlesene Zeitgenossenschaft»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Erlesene Zeitgenossenschaft» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Erlesene Zeitgenossenschaft» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.