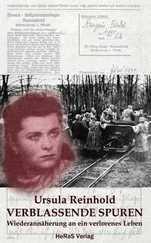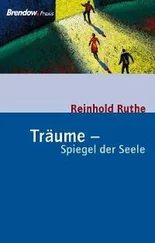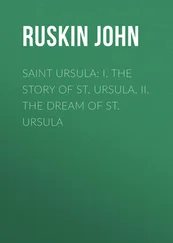Ursula Reinhold - Erlesene Zeitgenossenschaft
Здесь есть возможность читать онлайн «Ursula Reinhold - Erlesene Zeitgenossenschaft» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Erlesene Zeitgenossenschaft
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erlesene Zeitgenossenschaft: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Erlesene Zeitgenossenschaft»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Erlesene Zeitgenossenschaft — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Erlesene Zeitgenossenschaft», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Bei der Arbeit damals nahm niemand von meinen Kollegen Anstoß an meinen geringen Voraussetzungen. Wahrscheinlich war es so, dass keiner von ihnen eine genaue Vorstellung von meinen dürftigen Vorkenntnissen hatte. Denn alle anderen waren bereits gestandene Wissenschaftler, bei ihnen sah das jedenfalls durchaus anders aus als bei mir. Immerhin war Klaus Pezold ein Schüler Hans Mayers in Leipzig gewesen, hatte dort früh mit einer Arbeit über Martin Walsers Romanwerk promoviert. Das Thema der Dissertation ging noch auf den verehrten Lehrer zurück, und sie lag bereits veröffentlicht vor. Auch von Klaus Schumann, Spezialist für die Lyrik, gab es bereits Veröffentlichungen. Er hatte über Brechts Lyrik promoviert. Hans Joachim Bernhard hatte eine Habilschrift über die Romane von Heinrich Böll verfasst, auch deren Ergebnisse lagen gedruckt vor. Außerdem hatte er über die Kriegsbücher von Ernst Jünger gearbeitet und publiziert. Ich kannte seine Arbeiten aus meiner Studentenzeit. Mich beeindruckte der Kenntnisreichtum der Kollegen, aber ich war erleichtert, dass sie mich ohne Vorurteile in ihren Kreis aufnahmen. Denn ich war mir meiner geringen Voraussetzungen bewusst, war unsicher, aber eifrig bemüht, meine Lücken zu schließen, um an einer so wichtigen Arbeit, wie es eine Literaturgeschichte war, erfolgreich mitschreiben zu können. Viel Eifer und Fleiß brachte ich mit, die Arbeit machte mir Spaß, obwohl mich niemals das Gefühl von Überforderung verließ, das mich im Übrigen auf meinem gesamten Weg als Wissenschaftlerin begleitet hat.
Redakteurin bei den „Weimarer Beiträgen“
Zuvor, in der Zeit von 1970-1973 arbeitete ich als Redakteurin bei der Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Kulturtheorie, wie die „Weimarer Beiträge“ im Untertitel damals hießen. In den ersten Monaten meiner Tätigkeit dort promovierte ich zu dem schon genannten Thema am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Lehrstuhl Literatur und Kunst. Vorangegangen waren eine Ausbildung an der Fachschule für Bibliothekare, eine mehrjährige Berufsausübung, ein verkürztes Germanistikstudium in einer Kombination von Gasthörerschaft und einjähriger Immatrikulation an der Humboldt-Universität, ein Diplom im Fach Germanistik.
Obwohl die Redakteurstätigkeit nur eine kurze Lebenszeit ausmachte, brachte sie mir wichtige neue Erfahrungen. Als verantwortliche Redakteurin für Literaturgeschichte hatte ich die Möglichkeit, meine literaturgeschichtlichen Kenntnisse zu erweitern. Aber vor allem gab sie mir Gelegenheit, Schriftstellern leibhaftig zu begegnen, von denen mir bisher allenfalls die Namen oder einige ihrer Bücher bekannt waren. In dieser Zeit begann ich, mich als Literaturkritikerin zu versuchen, schrieb Beiträge in der kurz zuvor etablierten Reihe über Gegenwartsautoren. So begegnete ich manchem westdeutschen Schriftsteller. Die auffällige konzeptionelle Veränderung, die sich in „Literatur und Klassenkampf“ (1976) gegenüber der Anlage von „Antihumanismus in der westdeutschen Literatur“ (1972) zeigte, hing nicht zuletzt mit solchen Begegnungen zusammen. Das Zusammentreffen mit schreibenden Zeitgenossen von drüben und das lebendige Gespräch mit ihnen, hinterließ neue Eindrücke, löste abstrakt Begriffliches auf, das sich im Denken festgesetzt hatte. In den drei Jahren, in denen ich dort tätig war, gab es Treffen mit Schriftstellern, die ich für die Autorenreihe interviewt habe und über die ich auch noch Artikel schrieb, nachdem ich nicht mehr Redakteurin war. Diese Begegnungen mit Menschen und ihren Werken empfand ich als sehr bereichernd. Sie hinterließen mir unverlierbare Eindrücke. Es ist eine lange Liste von Namen, in der Reihenfolge ihrer Nennung, versuche ich die Chronologie zu wahren. Gespräche, die später gedruckt wurden, habe ich mit Hans Magnus Enzensberger, Peter Schütt, Rolf Hochhuth, Franz Xaver Kroetz, Günter Herburger, Uwe Timm, Klaus Konjetzky, Gerd Fuchs, Martin Walser, Günter Wallraff, Dieter Süverkrüp geführt. Darüber hinaus gab es damals und später Begegnungen und Gespräche mit Schriftstellern, aus denen mir ebenfalls nachhaltige Eindrücke geblieben sind. Dazu zählen Gespräche mit Heinar Kipphardt, Roman Ritter, Erasmus Schöfer, Ulla Hahn, Dieter Wellershoff, die ich zu ganz verschiedenen Zeiten traf. Auch Gespräche mit Oskar Neumann und Friedrich Hitzer als Herausgeber und Macher der Münchener Zeitschrift „Kürbiskern“ vermittelten mir ungewohnte Blickpunkte auf den anderen deutschen Staat, auf die Protagonisten der linken Szene in München und anderswo.
Dabei sind die mehr oder weniger bleibenden Eindrücke, die Mensch und Werk bei mir hinterlassen haben, ganz unterschiedlich geartet. Episodisches steht neben Konzeptionellem, das mir manches Streitgespräch vermittelt hat. Aktuell Politisches oder Literarisches steht neben essenziellen Einsichten in Menschheitsfragen, Kurioses neben Alltäglichem. Am lebhaftesten erinnere ich mich an Situationen, in denen ich Autoren in ihrem eigenen Wohnumfeld erleben durfte. Zugegebenermaßen haftet der Auswahl der Begegnung, die hier zusammengestellt ist, etwas Zufälliges an. Die Begegnung mit Hans Magnus Enzensberger war eine Premiere für mich, Peter Schütts Weg verweist mich auf die blinden Flecke eigener Einsichten und Vorstellungen. Uwe Timm blieb mir am nachdrücklichsten von den Münchner Begegnungen, Walser-Lektüre gehört zu meinem Leben, Dieter Wellershoff entdeckte ich erst spät. Sehr verschiedene Gründe sprechen dafür, sich ihrer zu erinnern und den Eindrücken nachzugehen, die ich von ihren Büchern empfing.
ZIL - Jahre
Alfred Andersch wäre ich damals auch gern begegnet, aber es sollte sich nicht mehr ergeben. Sein Werk interessierte mich seit Jahren, auch seine Biografie, die Umstände seines Weges als Autor nach dem Krieg und die Gruppe 47, deren Gründung auch mit seinem Namen verbunden ist. Nachdem ich 1973 zum Zentralinstitut für Literaturgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR (kurz: ZIL) überwechseln konnte, dort zunächst in einer Forschungsgruppe über den Vormärz arbeitete, einer dann neu gegründeten Gruppe DDR-Literatur zugeteilt wurde, begann ich mich intensiv mit der literarischen Situation in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg zu beschäftigen. Recherchen zu den Verlagslizenzen, die von den vier Alliierten in den Zonen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten vergeben wurden, über das literarische Leben, wie es sich daraus zu entwickeln begann, fand ich spannend. Das Interesse an dieser Zeit entwickelte sich aus dem Bewusstsein, dass die gegenwärtige Situation, wie sie geworden war, mit den zwei deutschen Staaten nur von diesen Voraussetzungen her begriffen werden konnte. Denn das war die unmittelbare Vorgeschichte der Gegenwart. Dabei wurde mir klar, dass ich eine sinnvolle Forschungsarbeit über die Nachkriegszeit nur als wechselseitig aufeinander bezogenen Vorgang in Ost und West behandeln konnte. Hierzu wurde ich auch durch meinen familiären und persönlichen Hintergrund inspiriert, denn ich hatte die Teilung Berlins unmittelbar erlebt. Bestärkt wurde ich darin durch Bücher, die ich von meinem Vater übernahm, der nach 1945 eifriger Leser der „Weltbühne“ war und auch Hefte der von Alfred Kantorowics´ herausgegebenen Zeitschrift „Ost und West“ besaß. In seinem Bücherschrank gab es Romane, die kurz nach dem Krieg erschienen und später für lange Zeit in der DDR nicht mehr greifbar waren. Dazu gehörten z. B. Theodor Plieviers „Stalingrad“, auch Heinz Reins „Finale Berlin“ war darunter, und ich fand großformatige Exemplare von RoRoRo im Zeitungsformat, darunter einen Titel von Ignazio Silone, einem Autor, der in späteren DDR-Zeiten als Renegat galt. Damals regte mich von wissenschaftlichen Arbeiten besonders Christian Volker Wedekings Untersuchung „Der Nullpunkt. Über die Konstituierung der deutschen Nachkriegsliteratur 1945-1948 in den amerikanischen Kriegsgefangenenlagern“ an. 1971 erschienen, gab mir das Buch bis dahin nicht bekannte Einblicke in die Vorgeschichte der westdeutschen Literaturentwicklung. Was mich an dieser Darstellung vor allem beschäftigte, waren die Auskünfte darüber, wie sich die späteren Gründer der Gruppe 47 bereits im amerikanischen Gefangenenlager zusammengefunden hatten. Im Falle von Alfred Andersch, Hans Werner Richter und Walter Kolbenhoff handelte es sich um Männer, die vor 1933 zur kommunistischen Bewegung gehört hatten. Solche Gegebenheiten machten mir bewusst, wie verschieden die Wege von Antifaschisten waren, in welchem Maße viele von ihnen durch die Machtergreifung der Faschisten in die Isolation geraten und auf andere Wege gekommen waren als die Schriftsteller, die nach dem Ende des Krieges aus dem Exil in die sowjetische Besatzungszone zurückgekommen waren. Zu meiner großen Überraschung gehörte zur Vorgeschichte der Gruppe 47, zum Kreis derer, die bereits in Fort Devens an einer Zeitung für deutsche Kriegsgefangene mitgearbeitet hatten, aus der später „Der Ruf“ hervorging, auch der DDR-Autor Ernst Rudolf Greulich. Da er aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft in den Osten zurückgekehrt war, blieb seine Rolle unbeachtet, weil es mit der weiteren Geschichte, die sich mit dem Münchener „Ruf“ fortsetzte und zur Gründung der Gruppe 47 führte, keine Berührungen mehr gab. Im Gefangenenlager war er seinem Jugendfreund aus der weltlichen Schule in Berlin-Adlershof wiederbegegnet, der nun allerdings nicht mehr Walter Hoffmann hieß. Das war der Name, unter dem der Freund früher seine Erzählungen in der „Roten Fahne“ veröffentlicht hatte. Im dänischen Exil nahm er den Namen Kolbenhoff an und wurde unter diesem Namen nach dem Krieg als Romanautor bekannt. Auch als Mitbegründer der Gruppe 47 sollte er in die Literaturgeschichte eingehen. Walter Kolbenhoff war 1933 ins Ausland geflüchtet und wegen seiner Kontakte zu Wilhelm Reich 1934 im dänischen Exil aus der KPD ausgeschlossen worden. Er trat mit der Absicht in die Wehrmacht ein, dort antifaschistisch zu arbeiten, und kam nach Einsätzen in Jugoslawien und Italien in amerikanische Gefangenschaft. Im Kriegsgefangenenlager war er als Dolmetscher tätig und hier begegneten sich die Jugendfreunde wieder. Alfred Andersch war es in Italien gelungen zu desertieren und auch Hans Werner Richter wurde dort von den Amerikanern gefangen genommen, während Ernst Rudolf Greulich als politischer Häftling dem Strafbataillon 999 zugeteilt war. Beim Fronteinsatz in Nordafrika gelang ihm der Weg in die Gefangenschaft. Dieser Erfahrungshintergrund von Menschen, die sich in der Weimarer Republik von ihren politischen Überzeugungen und Haltungen nahe waren und später unterschiedliche Wege einschlugen, interessierte mich sehr. Was hieß schon Verrat, wenn die Geschichte doch die Menschen trennte?, fragte ich mich. Die Forschungen zur Nachkriegsgeschichte banden längere Zeit mein Interesse und meine Kräfte, und es ergaben sich daraus mehrere Arbeitsfelder. Die Beschäftigung mit der Biografie von Alfred Andersch regte mich dazu an, eine Gesamtdarstellung des Autors zu versuchen, als Ergebnis entstand die Monografie „Alfred Andersch. Politisches Engagement und literarische Wirksamkeit“. Weiterhin ergab sich aus diesen Untersuchungen eine Reihe von Porträts über Verleger (Rowohlts RoRoRo und, Suhrkamps „Beiträge zur Humanität“) und über ihre literarischen Nachkriegsprogramme. Auch Porträts über Schriftsteller entstanden, die wie Elisabeth Langgässer, Horst Lange, August Scholtis, Wolfgang Koeppen u. a. in Deutschland in der inneren Emigration gelebt hatten und für die Nachkriegsliteratur kürzere oder längere Zeit eine Rolle spielten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind z. T. erst 1995 in „Unterm Notdach“, einem Band über die Berliner Nachkriegsliteratur veröffentlicht worden, der unter der Regie von Ursula Heukenkamp erarbeitet wurde. In den Achtzigerjahren war aus dieser Arbeit der Plan erwachsen, das Protokoll des ersten deutschen Schriftstellerkongresses aus dem Jahre 1947 zu veröffentlichen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Erlesene Zeitgenossenschaft»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Erlesene Zeitgenossenschaft» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Erlesene Zeitgenossenschaft» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.