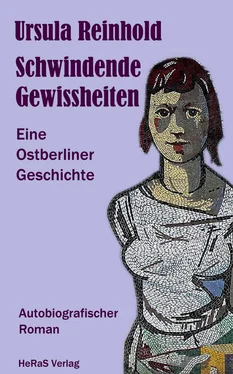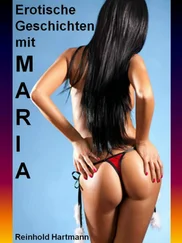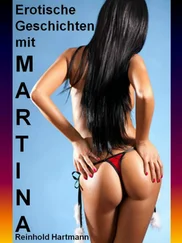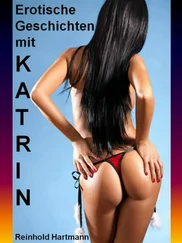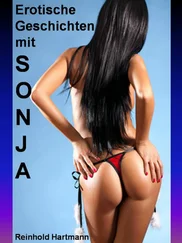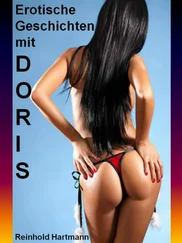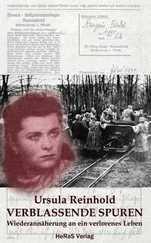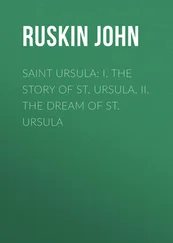Vollkommen fremd sind ihr dagegen die Wohnsilos, die während der Grenz-zeit gebaut wurden. Die lernt sie erst jetzt kennen. In ihrer Kindheit gab es, sowohl im Gebiet zwischen Sonnenallee und Neuköllnischer Allee, als auch in dem zwischen Sonnenallee und Kiefholzstraße, ausgedehnte Laubenareale. Über die Neuköllnische Allee hat ihr Schulweg geführt, bei dem sie zweimal über die Grenze musste. Einmal, wenn sie über die Brücke im Verlaufe der Britzer Allee ging. Das zweite Mal, wenn sie nach einem weiten Weg über die Neuköllnische Allee, den Schwarzen Weg entlang über die Sonnenallee, den Heidekampgraben erreicht hatte. Dort betrat sie dann wieder den sowjetischen Sektor, in dem ihre Schule stand. In der Kiefholzstraße, wo sie heute noch steht, weithin sichtbar.
Den Schwarzen Weg gibt es heute überhaupt nicht mehr. Sie könnte, auf der Sonnenallee stehend, nicht einmal mehr die Stelle angeben, wo der einst verlief. Zwischen Jupiterstraße und Grenze setzte man in den Sechzigerjahren einem ausgedehnten Häuserkomplex, der ihren Schulweg verschwinden ließ. Auf der anderen Seite der Grenze baute die DDR Wohnhäuser nach dem damaligen Standard. Später geborene, die die Häuser bewohnten, mögen die Sonnenallee immer nur als dieses kurze Ende bis zur Grenze gekannt haben. Ihre Sonnenallee ging immer bis zum Hermannplatz. Denn oft genug war sie mit der Straßenbahnlinie 95 bis nach Neukölln oder Tempelhof gefahren. Später freilich war die Fahrt zwischen der Haltestelle Schwarze Weg und Baumschulenstraße unterbrochen, man musste aus der 95 West aussteigen und an der Ecke Baumschulenstraße in die 95 Ost einsteigen, die dann bis zum Krankenhaus Köpenick fuhr. Erst konnte man noch den gleichen Fahrschein benutzen. Das änderte sich bald, man brauchte Westgeld und so wurden ihre Straßenbahnfahrten nach Neukölln hinein immer weniger.
Später, nach dem Mauerbau, war sie nur noch selten hier vorbeigekommen. Flüchtig nur schaute sie dann aus dem Busfenster auf das Ende ihrer Welt. Längst hatte sie sich angewöhnt, den Schlagbaum und die Sichtblenden über der Baumschulenbrücke als politische Unabdingbarkeiten hinzunehmen. Sie wollte die Szenerie gar nicht so genau sehen, war froh, wenn sie schnell vorbeifuhr. Die Situation war ihr das Ergebnis einer politischen Entwicklung, die sie nicht beeinflussen konnte, nur akzeptieren. Dabei fühlte sie sich auf der Seite derer, die diese Spaltung nicht gewollt hatten.
Sie trägt diese Trennung als Phantomschmerz immer noch in sich. Sie begegnet ihr auf Schritt und Tritt in ihrem vertraut, fremden Gelände. So, wenn sie die Wohnsiedlungen durchstreift, denen die Laubenareale ihrer Kindheit weichen mussten.
Der Häuserkomplex auf der Neuköllner Seite galt bei seinem Bau als Nonplusultra moderner Architektur. Nicht ganz zu Unrecht, wie sie sich bei ihren Radfahrten durchs bebaute Gelände überzeugen kann. Ein Operettenviertel, denkt sie, wenn sie von der Neuköllnischen Allee kommend, die nach Opern-, Lied- und Operettensängern benannten Straßen durchfährt. Heinrich Schlusnus, Leo Slezak, Fritzi Massary, Joseph Schmidt, Michael Bohnen haben hier ihre Straßen. Sie sind nun jetzt alle Trabanten der Sonne, die der breiten Allee ihren Namen gibt und die sich darüber nur wundern kann.
Das Viertel mit ihrem alten Diamant-Damenrad vermessend, sieht sie das Bemühen der Planer, durch Gesamtgliederung der Anlage, durch Fassaden-gestaltung und unterschiedliche Höhe die übliche Monotonie zu vermeiden, einen bewohnbaren Raum zu schaffen. Ob das wirklich gelungen ist, wagt sie zu bezweifeln. Ihr als Kleingärtnerkind fehlt natürlich der Maßstab, moderne Architektur zu beurteilen. Ihr Urteil zählt nicht, wenn sie zugibt, dass es für ihr Wohlgefühl hier zu viel Beton gibt. Dabei gibt es Grün: Bepflanzungen zwischen den Häusern, Kletterpflanzen an den Fassaden, transportables Grün in Kübeln, Hochbeete. Der dominierende Eindruck der Betonstadt entsteht durch eine zusammenhängende Ebene, die für Autos da ist. Sie sind mit Zubringerstraßen zur Sonnenallee verbunden, die nahe den Häusern zu über-dachten Autostellplätzen führen. Die Straßenzüge haben in Abständen Über-gänge, die die eine Seite der Häuserfront mit der anderen verbinden. Sicherlich wollten die Planer, dass die Leute gefahrlos die Straße überqueren können. Aber sie sieht dort oben niemanden. Bäume stehen mit den Wurzeln im kleinen Erdgeviert inmitten von Beton. Ihre Stämme dürfen nicht dicker werden, sonst müssten sie die Mauern sprengen, die sie umgeben. Die Kronen können sie erst auf den hoch gelegenen Übergängen ins Licht recken, alles andere bleibt im Dunkel. Auch hoch über der Sonnenallee führt ein Übergang von der einen Seite der breiten Straße zur anderen. Er ist zugebaut, besitzt Fenster. Die Autos und Busse fahren durch diese Straßenüberbrückung. Als sie das erste Mal nach der Grenzöffnung mit dem Bus darauf losfuhr, zog sie unwillkürlich den Kopf ein.
Sie war nicht überrascht, als sie in der Berliner Abendschau erfuhr, dass diese Wohnsiedlung als Notstandsgebiet gilt. Viele Wohnungen stehen leer, auch war längst der erste Glanz von den Fassaden.
Sie vermisst den weiten Blick über die Gärten, den sie auf ihrem Schulweg hier hatte. Dort, wo die Sonnenallee vom Schwarzen Weg gekreuzt wurde, gab es damals einen aus Brettern gezimmerten Laden, der ein Kioskfenster zur Straßenseite hin offenhielt. Dort hingen bunte Zeitungen, Kaugummis und Bonbons gab es dort. Manchmal konnte sie sich einen Schokoladenriegel kaufen. Die zehn Pfennige (West) hatte sie, wer weiß woher, bekommen.
Aber die Sonnenallee war jetzt wirklich eine andere geworden, Betonallee fand Gisela passender. Nur am Heidekampgraben entlang, der die Grenze bildete und die beiden Wohnareale Ost und West voneinander trennt, hat sich auf der westlichen Seite am trüben Wasser des schmalen Grabens ein Streifen breiten Buschwerks erhalten, das den Spazierweg wie eine Kuppel überwölbt. Auf der östlichen Seite gibt es die übliche Busch- und Goldrutenvegetation, die den ehemaligen Mauerstreifen inzwischen begrünt hat. Dahinter beginnen die DDR-Plattenbauten in ihrer schlichten Monotonie. Die Blöcke stehen so zueinander, dass sie offene und geschlossene Quadrate bilden. Sie stehen großzügig im Gelände, lassen viel Raum für Grün, die herangewachsenen Bäume und Sträucher geben ihnen menschliche Maße. Sie sind jetzt, nachdem sie, großzügig durch Senatsfördermittel unterstützt, saniert und modernisiert sind, kein schlechtes Quartier. Aber natürlich nur für solche Modernitätsverweigerer wie diese Spaziergängerin hier. Die das westliche Wohnareal nicht nur der Straßennamen wegen operettenhaft findet.
Dagegen hatte man die schnurgeraden Straßen auf der gegenüberliegenden Seite der Neuköllnischen Allee zum Teltower Stichkanal hin, wo sie ihren Schulweg heimwärts fortsetzen musste, nach Wissenschaftlern und Industriellen benannt. Das Laubenareal auf dieser Seite war hier Industrie- und Gewerbeansiedlungen gewichen. Bosch hat hier seine Straße, Haber, auch Alfred Nobel, der den Sprengstoff entwickelt hat, mit dem man ihre Brücke am Ende des Krieges in die Luft sprengte. Sie saßen auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals wie in einer Falle. Alle Brücken waren kaputt.
Sie sitzt in ihrer Q3A-Wohnung, sortiert die Erinnerungen an die Brücken ihrer Kindheit. Aber eigentlich will sie den Zumutungen nachfragen, zu denen sie sich bereitgefunden hat in ihrem Staat, der DDR. Dem Zusammenhang nachgehen, der zwischen beidem besteht, oder gibt es ihn nicht?
Und wieder gibt es neue Zumutungen, die sie erträgt, fraglos.
Längst schon hat sich herausgestellt, dass die DDR Bevölkerung nicht nur aus Tätern und Opfern bestand. Auch sie ist weder noch, jedenfalls scheint es ihr so. Um als Täter in Frage zu kommen, war ihre Reichweite wohl zu gering. Sie hatte meistens mit den Kindern zu tun, wenn es um Wesentliches ging in ihrem Land. Da sie auf Harmonie aus war, unterließ sie Widerspruch. Als Opfer kommt sie deshalb auch nicht in Frage. Sie will jetzt keine nachgetragene Dissidenz liefern, auch bloße Mitläuferschaft wollte sie für sich nicht veranschlagen. Sie kennt solche Mitläufer zur Genüge, die jetzt angeben, sich nur aus Angst oder Anpassungszwang ins Unrechtsregime geschickt zu haben. Manche hatten die Faust des Widerstands in der Tasche geballt. Prominente Leute unter ihnen heute, einige hat sie sogar in ihrer unmittelbaren Umgebung erlebt. Natürlich blieb deren Opposition damals verborgen. Aber auch zu diesen Leuten will sie sich nicht gesellen. Sie kann schwer ausmachen, wozu und wohin sie gehört und wem sie sich zugesellen möchte. Mitläuferin nicht, eher Mitmacherin mit beschränkter Befugnis. Sie besaß durchaus eine Vorstellung von Verantwortung mit der sie in ihrem Staatswesen gelebt hat. Sie will die jetzt nicht auf die Führung abwälzen. Gisela wollte und wusste, was sie dachte und tat. Großenteils jedenfalls. Spät erst nahm sie an sich selbst die Beschwichtigungen wahr, mit denen sie sich erträglich gemacht hatte, was sie eigentlich nicht hätte ertragen wollen. Der Sozialismus, eine durch die Praxis für lange Zeit diskreditierte Idee. Daran hatte sie ihren Anteil. Dabei standen nun all die Widersprüche wieder dringend im Raum, um derentwillen nicht nur der Vater auf die Idee einer anderen Gesellschaft verfallen war.
Читать дальше