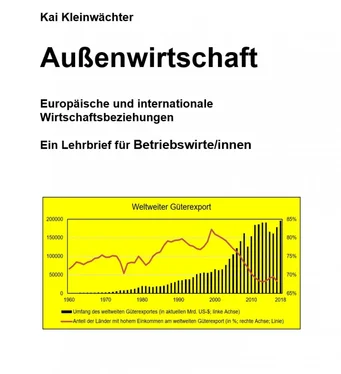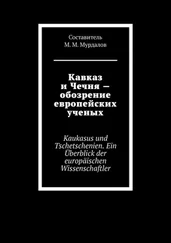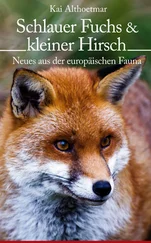Die Ursachen der Globalisierung sind vielfältig und haben starke Wechselwirkungen.
A) Politik
B) Ökonomie
C) Technik / Infrastruktur
D) Mobilität von Personen
A) Politik
Die in den hochentwickelten Industriestaaten dominanten politischen Strömungen traten seit den 1950er Jahren für eine (gesteuerte) Globalisierung ein. Die Staaten betreiben dabei eine Internationalisierung ihrer politischen Strukturen – sei es in der Wirtschaftssphäre (IMF, Weltbank, OECD…), in der Außen- und Sicherheitspolitik (NATO, OSZE, ICAN…), im Gesundheitswesen (WHO…) oder im Infrastrukturbereich (SWIFT, ICANN…). Ziele sind vor allem eine Stimulierung von Wirtschaftswachstum und Wohlstand sowie die friedlichere Gestaltung der Außenpolitik.
Mit dieser politischen Globalisierung einher, geht der forcierte Aufbau internationaler Infrastrukturen (Flugwesen, Hafenanlagen, Autobahnen, Strom- und Energiesysteme, Eisenbahnen…) sowie die Durchsetzung anerkannter Regeln.
Auch die sozialistischen Systeme bekannten sich zu einem globalisierten System. Allerdings sollte dieses unter umfassender Kontrolle der Staaten bleiben. Nicht-staatlichen Akteuren wie Wirtschaftsunternehmen wurde eine weniger selbstständige Rolle zugedacht, als in den kapitalistischen Ordnungsvorstellungen.
B) Ökonomie
Durch die Verzahnung regionalen Märkte bildete sich für viele Güter ein Weltmarkt heraus - insbesondere im Industrie-, Finanz- und Rohstoffsektor. Angebot und Nachfrage wird weniger durch die lokalen Bedingungen bestimmt, sondern durch die Marktprozesse auf globaler Ebene. Die Wirtschaftsakteure stellen sich darauf ein und treiben ihrerseits die Internationalisierung der Märkte und die globale Spezialisierung voran (vgl. transnationale Konzerne).
C) Technik / Infrastruktur
In Folge neuer Techniken sanken in den letzten 200 Jahren die Kosten für Kommunikation und Transport auf einen Bruchteil des ursprünglichen Niveaus. Große Durchbrüche waren v.a.: Schifffahrt (Große Segelschiffe, Dampfschiff, Eisen-/Stahlschiffe, Schiffe mit Dieselmotor), Eisenbahn (Dampf-, Diesel- und E-Log), Flugzeuge, Telekommunikation (Modernes Postwesen, Telegrafen, Telefon, Radio, Fernsehen, Internet). Diese Techniken ermöglichten einen deutlich kostengünstigeren und schnelleren Transport von Waren bei höherer Qualität und Quantität sowie die Kommunikation über globale Entfernungen.
Die Technikentwicklung steht in Wechselwirkung mit der Politik und der Ökonomie. Deren Anforderungen treiben ihre Dynamik voran. Gleichzeitig erhöht die Durchsetzung eines Technikniveaus die Anforderungen in den Sektoren. Es entstand ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der zu einer dynamischen Epoche der Menschheit führte.
Die meisten Techniken basieren auf sogenannten Netzinfrastrukturen (Häfen, Eisenbahn, Autobahnen, Stromnetze…). Diese entstanden in den hochentwickelten Staaten durch umfassende staatliche Investitionen.
D) Mobilität von Personen
In Folge sinkender Transportkosten und Abschwächungen der Grenzregime stieg die Mobilität der Bevölkerung deutlich. Das zeigt sich sowohl in vielfältigen Migrations-Formen (vom Auslandsstudenten, Gastarbeitern über Projektmanager/innen bis zu Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen) als auch im Aufstieg der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Letzteres ist inzwischen einer der bedeutendsten Wirtschaftssektoren. Die entsprechenden staatlichen Förderungen stimulieren seine weitere Zunahme. Dafür nehmen Regierungen auch Veränderungen ihrer nationalen Kultur in Kauf.
Beispiel: Japan und der Tourismus (Lill 2018)
Selbst das verschlossene Japan erwartet inzwischen mehr als 40 Mio. ausländische Gäste pro Jahr. Es beginnt zumindest eine partielle kulturelle und sprachliche Öffnung. In den großen Kultur-Magneten erfolgt eine Ausschilderung in mehreren Sprachen und das Servicepersonal beherrscht zunehmend Englisch. Auch stellt sich die Bevölkerung in den angesagten Hot-Spots auf die Touristen ein.
Ökonomische Herausforderungen der Globalisierung
A) Differenzierung der Lohneinkommen
B) Auseinanderentwicklung der Arbeits- und Kapitaleinkommen
A) Differenzierung der Lohneinkommen
Die internationale Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten wirkt unterschiedlich auf einzelnen Berufsfelder und Qualifikationen. Tendenziell sind niedrige Qualifikationen und (Massen-)Berufe einer höheren Konkurrenz durch Einwanderer bzw. der Bedrohung durch Arbeitsplatzverlagerungen ausgesetzt. In Folge stagnieren bzw. sinken hier eher die Löhne. Die politische Schwächung der Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten verstärkt diese Entwicklung. Gleichzeitig können Spezialisten (bei internationaler Mobilität) von der global wachsenden Nachfrage profitieren. Ihre Gehälter steigen tendenziell.
Auf den globalisierten Arbeitsmärkten verschärft sich die Konkurrenz unter den Arbeiter- und Angestellten deutlich. Prof. Nils Ole Oermann fasst es prägnant zusammen: „Der hochpreisige Verkauf von Arbeitskraft wird angesichts der größer werdenden internationalen Konkurrenz immer schwieriger. [In Folge] klafft in vielen Ländern die Lohnschere derart auseinander, dass […] der Begriff ´unfair´ oftmals tatsächlich angemessen erscheint.“ (Schnaas und Schwarz 2018)
Unterläuft die Arbeitsmigration darüber hinaus gesetzliche Standards wie Mindestlöhne oder Versicherungszwang, verschärft sich die soziale Spaltung deutlich. Vor allem in Dienstleistungsberufen mit Projektcharakter (Bauwirtschaft, Fernfahrer, Saisonarbeitskräfte…) erleichtern die instabilen Arbeitsverhältnisse die Umgehung der Gesetze. Bevor Kontrollen greifen, befinden sich Arbeiter und Firmen im Ausland. Da die Migranten oft nur vorübergehend in Deutschland bleiben, liegen ihre Kosten für die Lebenshaltung unter dem deutschen Niveau. Bei dauerhaften Aufenthalt wäre das niedrige Lohnniveaus nicht durchhaltbar.
Beispiel: Mindestlohn in Deutschland (Kirchgeßner 2018)
Ab Grenzübertritt gilt für ausländische Fernfahrer der deutsche Mindestlohn. (2018 8,84 € pro Stunde) In Tschechien hingegen liegt er bei ca. 73 Kronen, umgerechnet etwa drei Euro. Bei diesen Unterschieden zahlt kaum ein Spediteur das deutsche Niveau. Da die Abrechnung der Gehälter im Herkunftsland erfolgt, finden kaum Kontrollen statt. Die Fahrer müssen selbst ihre Gehälter einklagen. Im Mai 2018 einigte sich erstmal ein tschechischer Fernfahrer vor dem Bonner Arbeitsgericht mit seiner Spedition auf eine Lohnnachzahlung von 10.000 €. Weitere Klagen laufen. Allerdings weist der Vorsitzender des tschechischen Bündnisses der Transport Gewerkschaften (KDOS): „Wenn die tschechischen Spediteure den deutschen Mindestlohn zahlen, versuchen Bulgaren und Rumänen in die Lücke vorzustoßen.“
Befinden sich in der Volkswirtschaft größere Kontingente an Menschen ohne gesetzlichen Aufenthaltsstatus, spitzt sich die Situation noch weiter zu. Sie sind sowohl von den Sozialsystemen als auch den Arbeitsgerichten ausgeschlossen. Würden sie fehlende Löhne einklagen, droht ihnen die Abschiebung. In Folge sind sie gezielter Ausbeutung bis ins Existenzminimum ausgeliefert.
Beispiel: Arbeitsmarkt USA
In den USA halten sich nach Schätzungen über 11 Mio. Illegale auf – die meisten in den südlichen US-Bundesstaaten entlang der mexikanischen Grenze. (Rötzer 2018a) Gleichzeitig kommen immer weitere Arbeitskräfte aus Latein- und Südamerika nach. Isolierte Versuche der Bundesstaaten des Südens, die Mindestlöhne anzuheben, Krankenversicherungen ausdehnen o.ä. führen in den einfachen Berufsgruppen zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit von US-Amerikanern. Sie werden ersetzt durch illegale Ausländer. Parallel zu den sozialen Verbesserungen müsste die Anzahl der Illegalen reduziert werden - sei es durch Legalisierung, sei es durch Ausweisung und durch Kappung weiterer Einwanderung. Die konservativen Strömungen haben das wahrscheinlich besser erkannt, als die meisten „linken“ Kritiker.
Читать дальше