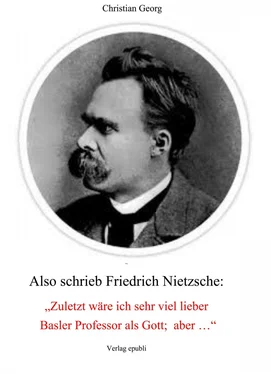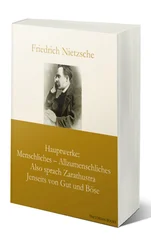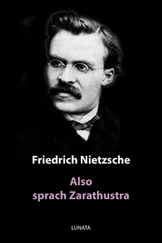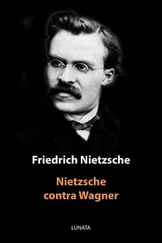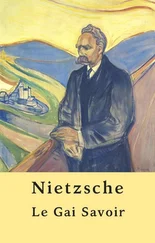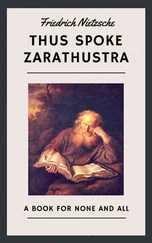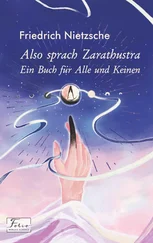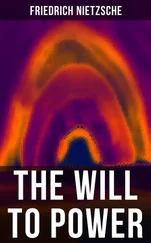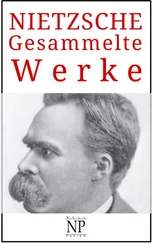Eine Beeinflussung Ns durch den Mitschüler Guido Meyer war im Jahr 1862 durchaus gegeben. Paul Deussen, bis dahin der beste Freund von N, berichtete, wie sehr er darunter gelitten und wie wenig ihm dies gefallen hatte. Aber sonstige Hinweise auf diesen Namen blieben in den Dokumenten über das Jahr 1862 aus. Was N hier der Mutter schrieb, war der Brief eines gut achtzehnjährigen, aber im Vergleich zu heute längst noch nicht volljährigen jungen Mannes! Seinerzeit wäre kein Mensch in der Lage gewesen, in diesen Vorfällen und hinter diesen Stimmungsschwankungen frühe Anzeichen eines Krankheitsbildes zu erkennen. Wegen seines vorwitzig unternommenen, aber tief in seiner Natur verankerten „Ausbruchs aus dem Gewöhnlichen“, d. h. seiner Lust , es anders zu machen als „die Anderen“ - was bisher ja immer „durchgegangen“ war, denn die Mutter kannte diese Neigungen ihres Sohnes! - sah N sich zum ersten Mal in seinem Leben massiver Kritik und spürbaren, fraglos auch ehrenrührigen Strafen ausgesetzt: Und das ausgerechnet in einer Angelegenheit, die weit außerhalb der Möglichkeiten seiner eigenen, ansonsten ja durchaus nicht zu knapp ausgebildeten Kritikfähigkeit lag: Nämlich in seinem zur Selbst kritik eher unfähigem Wesen und „herrscheramtlich“ veranlagten Sein! Darin lag unbestreitbar ein gerütteltes Maß an „Tragik“, weil ihm die Einsicht in die für „die Anderen“ geltende Logik der Angelegenheit - ihrer ganzen Tragweite gemäß - wie demonstriert, vollkommen verschlossen blieb und mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit zu vermuten steht, das es etliche andere - nicht „aktenkundig“ gewordene! - Anlässe dieser Art für Ns inzwischen fest in Emerson gebettetes Gefühlsleben gab und er sich in etlichen Punkten an den Realitäten des Lebens erheblich gerieben haben dürfte.
Mit dem Erreichen der Unterprima begann, zaghaft, Ns Freundschaft mit Carl von Gersdorff, der in späteren Jahren, Rückblickend auf den „wahnsinnig berühmt“ gewordenen N über seine Beziehung zu diesem schrieb:
Über meinen Aufenthalt in Schulpforta besitze ich leider keine schriftlichen Aufzeichnungen; doch weiß ich aus lebhafter Erinnerung, wie sehr N meine Aufmerksamkeit schon in Untersekunda erregte, wohin man mich Ostern 1861 versetzt hatte. Er war mir ein halbes Jahr voraus, so dass wir immer nur ein Halbjahr in jeder Klasse zusammen sein konnten ….. häufig und innig wurde unser Verkehr erst von Prima an. Nicht wenig trug die Musik dazu bei. Allabendlich zwischen 7 und ½8 Uhr kamen wir im Musikzimmer zusammen. Seine Improvisationen sind mir unvergesslich; ich möchte glauben, selbst Beethoven habe nicht ergreifender phantasieren können, als N, namentlich wenn ein Gewitter am Himmel stand. KGBI/4.577
Allerdings hatte Gersdorff Beethoven nie spielen hören, - wegen dem auch von seiner Seite zum Superlativ greifenden Vergleich, der zwangläufig schief liegen musste. Es gibt allerdings auch sehr anders lautende Urteile und Eindrücke, die schließlich unvermeidbar auch vom Stand der Kennerschaft des jeweiligen Hörers beeinflusst sind. Davon später.
Am 27. November 1862, nach dem durch Ns Verhalten verpatzten Geburtstagstreffen schrieb Gustav Krug an N:
Lieber Fritz! Endlich komme ich dazu, Deinen lieben Geburtstagsbrief zu beantworten ….. Vor allem habe Dank für Deine herzlichen Glückwünsche, die Du leider nicht mündlich anbringen konntest. Diesmal war mein Geburtstagtisch sehr stark besetzt, unter anderen Dingen nenne ich Dir „Giesebrechts Kaisergeschichte“, die ich mir gewünscht habe ….. Jedoch um jetzt auf ein anderes Thema zu kommen, so muss ich Dir gestehen, dass ich noch nichts für die Oktobersendung [eine Pflicht aus dem und für den Geistesverein „Germania“] habe. Es ist so schwer, während der Schulzeit und während man mit vielen andern Studien sich beschäftigt, auch noch ans Komponieren zu gehen ….. Von Paradies und Peri [ein weltliches Oratorium, ein Werk des auch von N sehr geschätzten Komponisten Robert Schumann, 1810-1856, op. 50 aus dem Jahr 1843] bin ich ganz entzückt ….. Übrigens möchte ich Dir doch nicht raten, Dir es zu kaufen. So schön und vollendet es auch ist, fehlt doch oft das Eigentümliche, wonach Du strebst und ich glaube an Tristan und Isolde könnten wir noch mehr haben, indem wir als an einem tieferen Werke, daran länger studieren könnten, um es vollständig zu begreifen und zu erfassen. Jedenfalls wollen wir uns die wichtige Beratung, ob wir uns das letztere anschaffen wollen, bis Weihnachten aufsparen, da man über diesen wichtigen Gegenstand keinen voreiligen Entschluss fassen darf [und da soll es im April einen statutenwidrigen Entschluss von Krug gegeben haben? Der April-Termin diente wohl eher dem offiziell konstruierten Bedürfnis, Ns möglichst frühe Bekanntschaft mit „dem Tristan“ zu legitimieren?]. Wagner befindet sich noch immer in Wien, um Tristan einzustudieren. Alle erforderlichen Mittel sind zur Aufführung vorhanden, nur der Tenor fehlt, indem Ander [ein damals wichtiger Wagner-Sänger] nach seiner langen Krankheit diese schwierige und anstrengende Rolle nicht übernehmen kann ….. [Von Alldem hatte N keine Ahnung und eigentlich auch kein merkliches Interesse daran. Die Wagnerei war derzeit vor allem Gustav Krugs Angelegenheit. Die „Germania“ lief nebenher und in dieser war - nach gleichlautenden Bemerkungen - N die treibende und verpflichtende Kraft.]
Die geliebte Weihnachtszeit rückte näher. Ende November 1862 schrieb die Schwester an N:
Mein innig geliebter Fritz! Endlich komme ich einmal wieder dazu an Dich zu schreiben, aber bitte erlass mir Dir französisch zu schreiben, da ich jetzt zu wenig Zeit habe, wie das ja immer so vor Weihnachten ist. [Da hatte N also der Schwester gegenüber wieder den bildungsbürgerlichen Lehrmeister spielen wollen!] O freue ich mich darauf das kannst Du Dir lebhaft vorstellen nicht wahr? Sonnabend über 3 Wochen kommst Du schon zu uns; Das wird zu reizend, denn die Zeit vor Weihnachten ist die schönste. Schreibe nur Deinen Wunschzettel mein lieber Fritz denn die Tanten haben schon darnach gefragt. Ich habe natürlich ziemlich materielle Wünsche, wie z.B. Ballgarderobe usw. In den Ferien wird Mamachen natürlich eine kleine Gesellschaft geben, ob getanzt wird, weiß ich noch nicht, aber sicherlich sehr hübsch gespielt. Jetzt hat Herr Rat Pinder ein reizendes Versspiel in Anregung gebracht, was auch bei Pinders letzter Gesellschaft gespielt worden ist. Da hat z.B. Gustav Krug gefragt: Sagt mir, was soll es bedeuten Dass ich so verslos bin? Kein Verschen aus alten Zeiten Kommt heute mir in den Sinn. Ein Referendar [am Naumburger Appellationsgericht, denn auch der Vater von Wilhelm Pinder war Appellationsgerichtsrat] hat darauf, indem er glaubte [die Zeilen in Anlehnung an Heinrich Heines Loreley-Gedicht kämen von] einer Dame: Was willst Du Dich quälen Du schönes Gesicht? Du bist ja selbst schon ein Gedicht! Ist das nicht nett? Pinderchens haben mir noch vielerlei erzählt. Ich war natürlich nicht dabei. Doch nun vor allen Dingen muss ich Dir noch sagen, dass Du recht bald schreibst, da ich mich sehr darüber freuen werde ….. Doch nun adieu, ich muss in die englische Stunde. Auf Wiedersehen den Sonntag bei schönem Wetter in Almrich. Denke manchmal an Deine Dich zärtlich liebende Schwester. Verzeih meine Schmiererei aber ich bin sehr in Eile.
Die Mutter fügte diesem Geschnatter hinzu:
Einen herzlichen Gruß und Kuss und die Bitte doch diese Woche noch alle und jede schmutzige Wäsche zu senden, da Montag große Wäsche ist. Lieschen Pinder hat ein rheumatisches Fieber. Ein Stück Apfelkuchen folgt, da ich heute zu Amalies Geburtstag [gemeint war das Hausmädchen] ihr einen gebacken habe. Schreibe doch öfter mein lieber Fritz, wir hören jetzt fast nur durch andre von Dir. Theobaldchen [der nur 6 Jahre ältere „Onkel“ Theobald Oehler, jüngster Bruder der Mutter, der sich 1881 das Leben nehmen sollte] grüßt herzlich mit Deiner Mutter. Sonntag bei gutem Wetter doch in Almrich.
Читать дальше