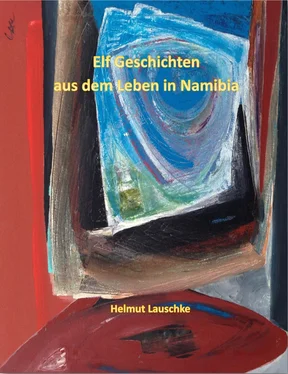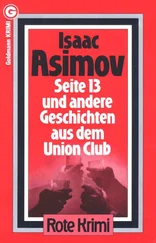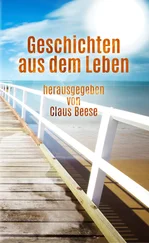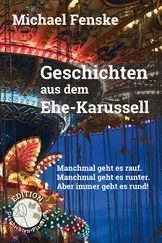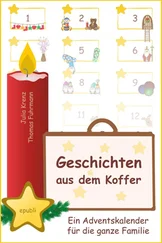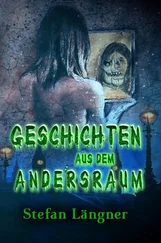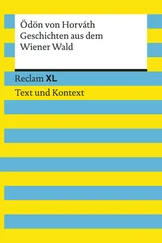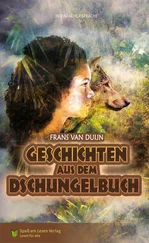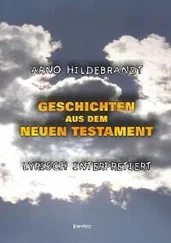Doch entwickelte sich gerade bei diesen Kollegen der Wunsch nach einem 'Office' mit gutgehender Klimaanlage. Sie wollten mehr administrativ als direkt am Patienten arbeiten. Das Administrative hatte für sie und ihre berufliche Karriere offenbar die größere Bedeutung. Diese Einstellung zur ärztlichen Tätigkeit erklärte mitunter manuelle Ungeschicklichkeiten mit linkischen Bewegungselementen, als gäbe es keinen rechten, sondern nur zwei linke Daumen. Das drückte sich in den Operativen Fächern besonders negativ aus, wenn es darum ging, eine spritzende Blutung zum Stehen zu bringen oder andere lebensrettende Massnahmen in Notsituationen zu ergreifen, die grundsätzlich keinen Raum zur Überlegung geben, ob der Arzt sich dabei "schmutzig" macht oder nicht. Für diese Art von Überlegungen, die meist nichts anderes als unethische Saubermannsvorbehalte sind, sich die Hände und Kleidung weder blutig noch anderweitig schmutzig zu machen, ist für einen Arzt in der Wirklichkeit des Helfens weder Raum noch Zeit, besonders dann nicht, wenn es um die Rettung eines Lebens geht. Dr. Ferdinand stellte sich bei solchen Beobachtungen oft die Frage, wie denn diese Kolleginnen und Kollegen im Exil ihr ärztliches Handwerk verrichteten, wenn da Not am Mann oder ein Freiheitskämpfer vor dem Verbluten zu retten war. Da musste doch schnell gehandelt werden. Sicherlich waren die meisten der jungen Kollegen noch an den Universitäten in der Sowjetunion und den anderen Ostblockländern, um das medizinische Handwerk zu erlernen. Einige von ihnen studierten sogar in den skandinavischen Ländern oder den USA. Sie alle wollten Ärzte werden, um am kranken Menschen zu arbeiten und in Notfällen das Leben zu retten. Da musste doch Hand an den Patienten gelegt werden, besonders wenn ein PLAN-Kämpfer (People’s Liberation Army of Namibia) mit einem abgerissenen Arm oder Bein oder sonst einer blutenden Wunde ins Lazarett gebracht wurde. Oder waren es die Ärzte aus der DDR und den anderen sozialistischen Bruderländern, die in Angola diese Arbeit taten, wenn es um schwere Verwundungen und das hohe Lebensrisiko ging?
Mit diesen Gedanken ging Dr. Ferdinand zum 'theatre 2' zurück, um die folgende Operation, eine Amputation des rechten Oberschenkels durchzuführen. Es war ein noch jüngerer Mann, der bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und dabei das rechte Bein abgequetscht hatte. Die Durchblutung des Beines war hochgradig gestört. Der Haut des Unterschenkels war dunkel und fühlte sich kalt an. Eine Rekonstruktion der gebrochenen Knochen kam somit nicht mehr in Frage. Der Patient war bereits intubiert und an den Narkoseapparat angeschlossen. Die OP-Schwester hatte das Bein mit der braunen Desinfektionslösung gesäubert und deckte den Körper mit den sterilen grünen Tüchern so ab, dass nur das rechte Bein sichtbar war, dessen Unterschenkel bis zum Knie in ein grünes Tuch eingewickelt war. Dr. Ferdinand trocknete sich Hände und Unterarme ab und ließ sich den grünen OP-Kittel überziehen. Er trat an den OP-Tisch heran, als er den Handschuh über die rechte Hand streifte. Der philippinische Kollege stand ihm gegenüber. Die OP-Schwester reichte das Skalpell für den Hautschnitt, als ein junger Kollege, der an der Lumumba-Universität in Moskau sein Arzt-Diplom bekam, den Grund der Beinamputation wissen wollte. Dr. Ferdinand erklärte es ihm in kurzen Zügen, während er den Fischmaulschnitt setzte. Der junge Kollege hatte Schwierigkeiten, das Ausmass der Durchblutungsstörung zu verstehen. So fragte er, ob es zur Amputation keine Alternative gab, die zur Wiederherstellung einer ordentlichen Durchblutung führte. Dr. Ferdinand strengte sich an, ihm die Gründe plausibel zu machen, warum es für die Amputation keine Alternative gab. Der junge Kollege machte noch einige theoretische Bemerkungen, aus denen recht mangelhafte Kenntnisse auf dem Gebiet der Physiologie und Pathologie des Blutkreislaufs herauszuhören waren. Da entschuldigte sich Dr. Ferdinand damit, dass er sich nun auf die Operation konzentrieren müsse, wo er dabei war, die großen Blutgefäße unterhalb der Leiste abzubinden und zu durchtrennen sowie die großen Beinnerven zu kürzen. Der assistierende Kollege und die OP-Schwester mühten sich ab, um die Operation zum baldigen Abschluss zu bringen. Beim Ansetzen der oszillierenden Säge zum Durchtrennen des Oberschenkelknochens versagte der nötige Luftdruck in der großen Stahlflasche, so dass eine volle Druckluftflasche gebracht und angeschlossen wurde. Dr. Ferdinand befürchtete aufgrund seiner wiederholt gemachten Erfahrung, dass es keine volle Flasche mehr gäbe und die Knochendurchtrennung mit der Handsäge zu erfolgen hatte, wobei er schon einige Male ins Schwitzen kam, weil es keine vernünftige Knochensäge zur Handbedienung gab. Nach Anschluss an die neue Flasche setzte er die oszillierende Säge an und durchtrennte den langen Röhrenknochen problemlos am Übergang vom oberen zum mittleren Schaftdrittel. Die letzten Hautnähte waren gesetzt. Dr. Ferdinand wickelte den Verband über den Beinstumpf und hob den Operierten mit dem philippinischen Kollegen und einer Schwester vom OP-Tisch auf die Trage. Der junge Kollege mit dem Moskauer Arzt-Diplom sah sich die ganze Prozedur bis zum Ende an. Dabei kam ihm nicht der Gedanke, seine Hände und Muskelkraft zum Rüberheben des Patienten zur Verfügung zu stellen oder zumindest anzubieten.
Es war Mittagszeit. Dr. Ferdinand dankte dem Team für die gute Zusammenarbeit und verließ das 'theatre 2'. Im Umkleideraum zog er das durchschwitzte OP-Hemd von der klebrigen Haut, warf es zusammengeknüllt in den schon vollen Wäschesack, rieb sich den Schweiß von der Haut und zog sich das Zivile an. Im 'Nurses tea room' saßen einige der OP-Schwestern und Hilfsschwestern und assen ihr Fleisch mit Reis oder Mahangu-Papp und einem Ei. Andere waren frühzeitig genug in die Kantine gegangen, um dort die warme Mahlzeit einzunehmen. Nach der Unabhängigkeit wurde darauf geachtet, die Mahlzeiten pünktlich und ausführlich einzuhalten. Da mussten Operationen von der Liste gestrichen und auf den nächsten Tag verschoben werden, wenn sie mit den Pausenzeiten kollidierten oder die Möglichkeit einer solchen Kollision bestand. Die Einstellung zur Arbeit war auf dieses Mass abgerutscht, um pünktlich die Tee- und Mittagspause anzutreten. Diese Einstellung sicherte auch die pünktliche Beendigung der Arbeit innerhalb der offiziellen Schichtzeit. Es waren meist dieselben Schwestern, die schon während der letzten Stunde die Arbeit einstellten und irgendwo unauffällig im Saal auf die Ablösung warteten. Im Wandel der Zeit war das einst Großartige verlorengegangen. Es gab es nicht mehr: die hohe Motivation und Selbstlosigkeit, dem Menschen in der Not zu helfen. Nun schauten die Krankenpfleger und Schwestern, und mit ihnen die Matronen, auf die Uhr, um es mit der Arbeit nicht zu "übertreiben". Da hat es menschlich einen Knacks gegeben, von dem sich der Pflegeberuf nicht mehr erholt hat. Und die Patienten spürten es. Mit der ethischen Verkümmerung ging eine allgemeine Zunahme der Körpergewichte einher, die in einigen Fällen so extrem war, dass das Bücken beschwerlich und das zügige Gehen unmöglich wurde. In Einzelfällen kam es zu derartigen Verfettungen, dass über Rücken-, Hüft- und Kniegelenksschmerzen geklagt wurde. Diese Schmerzen waren zweifellos glaubhaft und führten in einigen Fällen zur Arbeitsuntauglichkeit. Da gab es mitunter Versetzungen in eine sitzende Tätigkeit. Der vakante Pflegeposten im Krankensaal wurde dann mit einer jungen Schwester aufgefüllt, die gerade ihr letztes Examen in der Krankenpflegeschule bestanden hatte. In anderen Fällen, wo eine Versetzung von der stehenden Pflegetätigkeit am Patienten in eine sitzende Kontrolltätigkeit über die arbeitenden Pflegekräfte und die Utensilien nicht möglich war, weil die Sitzstellen erschöpft waren, traten dann eine Vielzahl von Problemen auf, die von Krankmeldungen und den ständigen Verlängerungen bis zum Antrag auf Frührente reichten. Da verwunderte es in einigen Fällen, dass es Schwestern gab, die die Rücken-, Hüft- und Knieschmerzen ausschließlich auf ihre Pflegetätigkeit zurückführten und vom eigenen Übergewicht nichts wissen wollten. Dass mit zunehmendem Appetit die Leistung und Qualität der Arbeit am Patienten sank, das war ein bedenkliches Phänomen der Zeit. Es war Ausdruck der Schwäche und Zügellosigkeit, wo Disziplin auch beim Essen gefordert war. Das hatte nicht nur ernste Folgen für die Patienten, sondern auch für die betroffenen "Übergewichtler" und ihre Familien. Bei den meisten der Betroffenen kamen die Kreislaufprobleme mit dem hohen Blutdruck, dem Schwindelgefühl und Kopfschmerz noch dazu.
Читать дальше