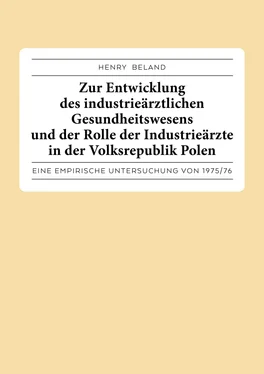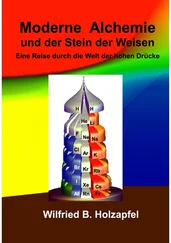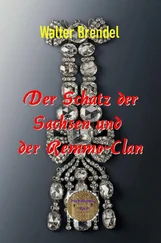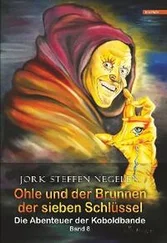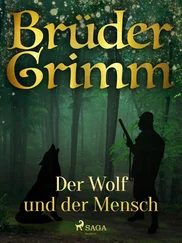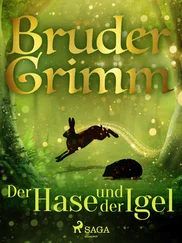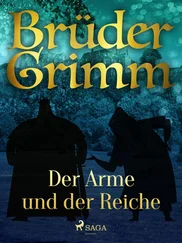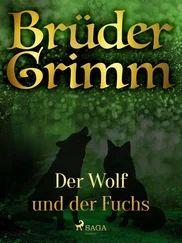Nach der marxistischen Gesellschaftstheorie müssten die neuen Institutionen und die Vergesellschaftung der Wirtschaft letztlich „notwendig zu neuen Mikrostrukturen und neuen kulturellen Inhalten führen.“{151} Dieser Prozess könne durch verantwortlich durchgeführte Erziehung – wobei eine Umerziehung der Erwachsenen durch Propaganda und Agitation mit eingeschlossen ist – beschleunigt werden.
Dem hält Szczepański entgegen, dass „diese Theorie die Möglichkeit eines ‚Circulus vitiosus‘ in sich berge. Dies in dem Fall, dass die sozialistischen Institutionen, insb. die politischen, die die beherrschenden Institutionen des neuen Systems sind, aber auch die ökonomischen, die ihre materielle Basis bilden, von unsozialistischen Persönlichkeitstypen geleitet werden (…), so dass die Entwicklungsbedingungen, unter denen sich die Persönlichkeit des sozialistischen Menschen gewissermassen natürlich entwickeln kann, verzögert oder gar gänzlich verhindert wird. Die zweite Gefahr liegt in den Folgen einer psychologisch falsch geführten Propaganda, welche statt der beabsichtigten eine entgegengesetzte Wirkung hervorrufen kann.“{152}
Die von Szczepański genannten Einflussfaktoren, die der Bildung eines sozialistischen Persönlichkeitstypus – und damit der Entwicklung des Sozialismus –entgegenwirken -, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1 Persönlichkeitsmuster der Vorkriegszeit, die dem sozialistischen Ideal konträr entgegengesetzt sind und nur langsam verschwinden bzw. an Einfluss verlieren.
2 Die Eigenmechanismen insbesondere der politischen und ökonomischen Institutionen. Diese können sich aus verschiedenen – objektiven wie subjektiven – Gründen in bürokratische Systeme verwandeln, die im Namen einer Rationalität des Allgemeinwohles „willkürlich und rücksichtslos“ in das Leben des Einzelnen eingreifen.{153}
3 Werden die politischen Institutionen von nicht-sozialistischen Persönlichkeitstypen geleitet, besteht die Gefahr, dass die Erzielung eines sozialistischen Persönlichkeitstypus gänzlich unmöglich gemacht wird, da diese Institutionen die beherrschenden in der Gesellschaft sind und „jede ideologische Verzerrung (…) ebenso den Erziehungsprozess deformiert.“{154}
4 Ähnliches gilt für die ökonomischen Institutionen und die „Ideologie der Direktoren“: erst die Produktion, dann die Ideale des Sozialismus.{155} Dazu kommt das Problem der Entfremdung. Untersuchungen haben gezeigt, „dass das Problem der Eliminierung der entfremdeten Arbeit in der vergesellschafteten Wirtschaft komplizierter ist, als die Klassiker es sich vorgestellt haben.“{156}
5 Die Auswirkungen einer psychologisch falsch geführten Propaganda. Diese vor allem ist es und nicht der Kampf der antisozialistischen Kräfte, die mystizistische und religiöse Tendenzen unter der Jugend hervorrufen. Das Verhalten dieser Jugend kann daher als natürliche Protesthaltung angesehen werden, vergleichbar der einer klerikal erzogenen Jugend, die atheistisch und antiklerikal reagiert.{157}
Diesen Störfaktoren steht nach Meinung des Autors nur die neue Makrostruktur gegenüber.{158} Im Vergleich zu den nur langsam sich wandelnden Mikrostrukturen ist deren Einfluss aber gering.
Als einen Ausweg aus diesem Dilemma sieht Szczepański vor allem das vorbildliche Verhalten der regierenden Schicht. Von ihrer moralischen Integrität und ihrer psychologischen Struktur hänge weitgehend das Funktionieren der politischen Institutionen, die, wie gesagt, dominierenden Einfluss haben, ab.{159} Szczepański lehnt sich hier an die Position des humanistischen Soziologen F. Znaniecki an, nach dem die neue Gesellschaft vor allem das Werk der Wissenschaft und „guter“, „kluger“ Leute sein wird.{160}
Die obigen Ausführungen zur Vorkriegsgesellschaft, Krieg und Okkupation, sowie zum Nationalcharakter dienten dem Zweck, die spezifischen polnischen Bedingungen, den „Schoß der alten Gesellschaft“{161} aufzuzeigen und damit die nachfolgende gesellschaftliche Entwicklung verständlich zu machen. Auf die wichtigsten Veränderungen, die sich aus den sozialen Auswirkungen des umfassenden sozialistischen Industrialisierungsprozess{162} und der ihn begleitenden Urbanisierung ergaben, soll im Folgenden näher eingegangen werden.
5. Zu den gesellschaftlichen Folgen und Begleiterscheinungen des Industrialisierungsprozesses in der Volksrepublik Polen.
5,1 Zu einigen Darstellungsweisen der gesellschaftlichen Entwicklung in Polen.
Arbeiten wie die Peter Ungers{163} zu den Unruhen im Winter 1970/71, die die Ursachen aller Schwierigkeiten in der Nachkriegsentwicklung Polens vor allem im System sehen, bzw. im Fehlen der „freien Marktwirtschaft“, der „neuartigen Diktatur des Kremls, (die) ihre Alleinherrschaft um jeden Preis erhalten will“{164} oder die das Übel in der „totalen Bürokratie“{165}, dem „kommunistischen Leviathan“{166}, der in alle Bereiche des sozialen Lebens dringt und alle Aktivitäten ausserhalb der Partei eliminiert oder die, wie der „Kultura“-Autor, Władysław Bieńkowski,{167} zu dem Schluss kommen, dass die politische Diktatur des Proletariats (der Stalin-Ära) sich in eine polizeiliche Diktatur verwandelt, die, wie die bisherige Geschichte der meisten sozialistischen Staaten zeige, sich zyklisch verschärft und entspannt{168} - nach Unger ist es sogar wahrscheinlich, dass „die Grausamkeit in den Methoden (…) (sich) kontinuierlich steigern werden“{169} – kurz, all diese Arbeiten zielen m. E. ebenso an der gesellschaftlichen Wirklichkeit - und ihren Möglichkeiten im Hinblick auf die forcierte Durchsetzung sozialistischer Ziele – vorbei, wie die moralischen Appelle eines Leszek Kołakowski.{170} Letzterem warf Gomułka bereits nach den Oktoberereignissen von 1956 (m. E. zu Recht) vor, es fehle die Alternative.{171}
Alle diese Arbeiten, die von unterschiedlichem Niveau und verschiedenen, teilweise entgegengesetzten politischen oder wissenschaftstheoretischen Standpunkten ausgehen und deren Aufzeigen oder auch Polemik gegen Auswüchse des Systems dem Aussenstehenden so eingängig und berechtigt erscheinen, vernachlässigen in ihren Analysen die Schwierigkeiten, die jede Industrialisierung, „ihre unvermeidlichen und harten Gesetze“, begleiten, so der Warschauer marxistische Philosoph und Soziologe Stanisław Rainko. „Nirgends war ihr Weg auf Rosen gebettet. […] Die Notwendigkeit der Beförderung einer ungeheuren Masse der Bevölkerung in mehr oder weniger brutaler Form aus den traditionellen Dorfgemeinschaften in die Metropolen zur Schaffung der Industrie, ihre Gewöhnung an das Fliessband und die Technik der Maschinen, die Beschränkung des Konsums, die Zerstörung der natürlichen Umwelt – das sind nur einige Erscheinungen, die den Prozess der Industrialisierung begleiten.“{172}
Weiter vernachlässigen diese Arbeiten, indem sie die historische Bedeutung der Umwälzungsprozesse und die sie beeinflussenden Faktoren aus den Traditionen und der Geschichte des Landes entweder nicht zur Kenntnis nehmen oder von falschen Voraussetzungen ausgehen, die Auswirkungen auf das Bewusstsein der unter ihrer Problembewältigung leidenden Gesellschaftsmitglieder. D. h. die Suche nach den Schuldigen für die Knappheit der Konsummittel, die Disziplinierung der Arbeit, die Umgestaltung der traditionellen Lebensweise und der gesellschaftlichen Verhältnisse durch die grosse Industrie – die andererseits nachweisbar zu einer enormen Steigerung des Lebensstandards und der sozialen Sicherheit in Polen führte – wirkt sich häufig deformierend auf das Bewusstsein der an diesem Prozess Beteiligten aus.{173} Doch soll hier nicht auf dieses Bewusstsein, wohl aber auf den Prozess der Industrialisierung selbst, den Widersprüchen und Veränderungen, die dieser im täglichen Leben erzeugte, eingegangen werden.
Unter den zahlreichen empirischen Untersuchungen, Artikeln etc.{174} zu dem Themenkomplex werden die sozialen Auswirkungen des Industrialisierungsprozesses wiederum am gründlichsten und umfassendsten von Jan Szczepański analysiert. Auf seine Ausführungen in der 1973 publizierten Arbeit „Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia“ (Die Veränderungen der polnischen Gesellschaft im Industrialisierungsprozess) werde ich mich vor allem im Folgenden beziehen.
Читать дальше