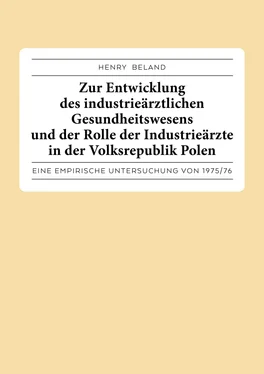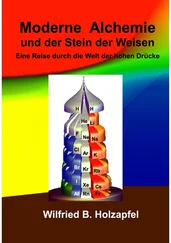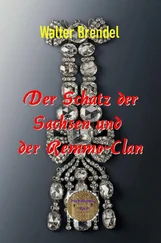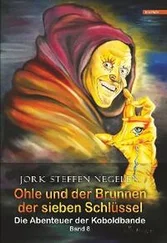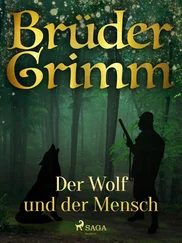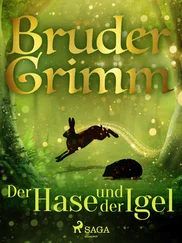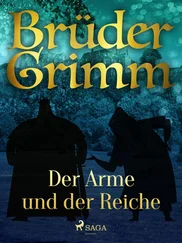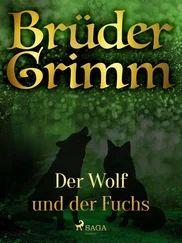Doch Einsicht in die Notwendigkeit der Umstrukturierung von Staat und Gesellschaft, der Notwendigkeit einer forcierten Industrialisierung, der Notwendigkeit einer neuen Moral, neuer Wertmassstäbe, Denkstrukturen und kultureller Inhalte, schafft noch nicht diese anvisierten neuen Strukturen, behebt nicht die mit der Entwicklung verbundenen Schwierigkeiten, Mängel und Probleme, sondern ist nur eine, wenn auch grundlegende, Voraussetzung. Der Sozialismus soll, wie bekannt, die Entfaltung der Persönlichkeit, die Freiheit des Individuums etc. ermöglichen{94}. Nun ist es zwar eine „schülerhafte Eselei!“, wie Marx in einer sehr scharfen Polemik gegenüber „Herrn Bakunin“ bemerkt{95}, nämlich nicht zu sehen, dass „eine radikale soziale Revolution (…) an gewisse historische Bedingungen der ökonomischen Entwicklung geknüpft (ist); letztere sind ihre Voraussetzung.“ Nicht der Wille, sondern die ökonomischen Bedingungen sind nach Marx die Grundlage der sozialen Revolution. Doch andererseits ist zum Verständnis des Geschichtsprozesses nach der von Marx und Engels entwickelten Auffassung nicht nur die viel zitierte Beachtung der ökonomischen Bedingungen, sondern ebenso die Beachtung der „wirklichen Individuen“ notwendig.{96} Also auch ihre Traditionen etc., in denen sie stehen, sind zu beachten, denn ebenso sehr wie die Umstände die Menschen, machen die Menschen die Umstände{97}. Auf die Charakterisierung dieser „wirklichen Individuen“ soll im Folgenden eingegangen werden, d. h. ich will diskutieren, was sich unter dem Begriff „Nationalcharakter“ zusammenfassen lässt.
4. Tradition und Nationalcharakter
- nationale Tradition
- der „neue Persönlichkeitstyp“
- langsame Umwälzung des Überbaus
- Kampf um die nationale Freiheit
- „Nationalcharakter“
„Die Polen“, schrieb Heinrich Heine in den 20-er Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, „… scheinen durch ihre Lage schon ganz besonders dazu bestimmt, gewisse Zwecke in der Weltbegebenheit zu erfüllen. Ihr moralischer Kampf gegen den Untergang ihrer Nationalität rief stets Erscheinungen hervor, die dem ganzen Volke einen anderen Charakter aufdrücken…“{98} Und ähnlich hebt 150 Jahre später Jan Szczepański hervor, dass in Fragen ihrer Nation die Polen „vielleicht empfindlicher reagieren als andere Nationen (…), zu viele Wunden verhindern eine ruhige und sachliche Diskussion…“. Mit dieser Empfindlichkeit in Fragen der Nation hängt u. a. zusammen, dass der kulturelle Einfluss des polnischen Adels, der Schlachta, und anderer Persönlichkeitstypen der Vorkriegszeit, die „in ihrer überwiegenden Mehrheit Anti-Typen“ darstellen, über die Zerstörung der ökonomischen Basis dieser Klassen und Schichten hinaus, so nachhaltig wirksam bleiben konnte.{99}
Bekanntlich wälzt sich der ganze ideologische Überbau – und dazu gehören die Verhaltensmuster – nach Änderung der ökonomischen Basis nur langsamer oder rascher um.{100} Dass für Polen ersteres gilt, hat seine Ursache wohl nicht nur in der relativen Schwäche der Traditionen der polnischen Arbeiterklasse, sondern vor allem in diesem jahrhundertelangen Kampf des Volkes um die nationale Freiheit. Zur Erreichung dieses Zieles konnte es keine Klassenunterschiede geben. D. h. eine Identifikation der unterdrückten Klassen mit der herrschenden Klasse, dem Schlachta, war notwendig.{101} So war dann eine aus dem Unglück entsprossene Vaterlandsliebe „das erste Wort des Polen“{102}, dessen Legionen unter der Losung „For your and our freedom and for future brotherhood“{103} überall in Europa gegen die Reaktion und für ihre eigene Sache kämpften.{104} Nach 1815 initiierte jede Generation in Russisch-Polen bewaffnete Aufstände: 1830, 1846, 1848, 1863 und 1905.{105} Allerdings gab es in der polnischen Geschichte, wie der polnische Soziologe Zygmunt Baumann feststellte, weder eine bürgerliche, noch eine politische oder industrielle Revolution – „nothing that could reveal the fundamental flexibility of the framework of human existence and emphasize the secular potential of social readjustment“.{106}
Wie sieht nun also dieser spezifisch polnische „Nationalcharakter“, wie sehen die „grundlegenden Charaktermerkmale“ des „typischen Polen“ aus?
Zwar wird sich in der polnischen Öffentlichkeit, in der Presse und in wissenschaftlichen Diskussionen häufig auf das „nationale Erbe“, den Nationalcharakter etc., berufen und es gibt eine Reihe von empirischen Einzeluntersuchungen, jedoch keine systematische Analyse dieser Thematik.{107}
In „Naród i Państwo“ (Volk und Staat) stellt der Warschauer Soziologe Jerzy J. Wiatr fest, „dass wir nur wenig davon wissen, wie eigentlich die geistige Gestalt des polnischen Volkes als Gesamtheit aussieht.“{108} Zu Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Roman Dmowski, Publizist und führender Politiker der nationalen Rechten{109}, in seiner Arbeit „Myśli nowoczesnego Polaka“, Lwów 1903 (Die Gedanken eines modernen Polen, Lemberg 1903), geschrieben: „Bei uns hat sich als Nationalcharakter der Charakter des polnischen Schlachta verbreitet – denn der Schlachta stand noch bis vor kurzem fast ausschliesslich für die Nation.“{110} So werde der Charakter einer besonderen Schicht, der unter bestimmten historischen Bedingungen entstanden sei und mit dieser auch wieder verschwinde, für den Charakter der Nation genommen. Und um das, „was wir für unseren Nationalcharakter halten“, besser zu verstehen, so Dmowski, brauche man sich lediglich tiefer mit den Lebensbedingungen des Schlachta und seiner Psyche zu befassen.{111}
Dieser Einschätzung Dmowskis stimmt Wiatr für die Vergangenheit zu, doch mit dem 20. Jahrhundert sei ein neues Element hinzugekommen, kurz: die Intelligentsia.{112}
Nach Józef Chałasiński, der zu den grossen Vertretern der von Florian W. Znaniecki{113} Anfang der 20-er Jahre in Posen gegründeten humanistischen Soziologie gehört, bildete sich die polnische Intelligentsia aus dem polnischen Adel in einer Zeit „neuer ökonomischer, gesellschaftlicher und politischer Degradierung (…). Man flüchtete in die Stadt, um Ruhe zu suchen, mit einem Gefühl der Ohnmacht angesichts der neuen sozialen Prozesse (…). Für viele (…) bedeutete die Flucht in die Stadt ein Übergang in den Ruhestand.“{114}
Nach Wiatr ist dies nicht ganz richtig, denn „es gab auch andere – und sehr starke – Reservoirs, aus denen die intellektuelle Schicht ihr menschliches Material entnahm.“{115} Dagegen sei Chałasiński zuzustimmen, wenn er ausführt:
„In der Kultur der polnischen Intelligentsia fehlt das grundlegende Element, welches für die westeuropäische Kultur charakteristisch ist. Dies ist das Element der Treue zum entstehenden objektiven Werk, der Treue zur geregelten Betriebsarbeit.{116} Im gesellschaftlich-genealogischen Charakter des polnischen Intellektuellen kämpfen noch immer der ehemalige Schlachta – der Mensch ohne Beruf und Liebhaber der Zerstreuungen – gegen den modernen Menschen der gewerblichen Berufsarbeit. Hier liegt einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der sogenannten Psyche des Intellektuellen, der Psyche „Pan“ (Herr) und der Psyche des Bauern oder des Arbeiters. Die Psyche des Bauern und des Arbeiters ist stärker von ihrer beruflichen Arbeit geprägt als die Psyche des Intellektuellen.“{117}
Diese Psyche des „Pan“ wurde bereits 1930 von dem humanistischen Soziologen Kazimierz Dobrowolski in scharfer Form kritisiert.{118} Danach ist die adlige Elite leicht reizbar und launisch. Auf Anregungen reagiert sie schnell – doch verliert sie ebenso schnell wieder das Interesse daran. Es fehlt ihr der Sinn für die Realität, das Verständnis für die Tradition und die Ausdauer, die Werke ihrer Vorfahren fortzusetzen. Und endlich ist sie noch durch einen starken Hang zum Individualismus geprägt. Eines Individualismus‘, den Dobrowolski als anarchisch bezeichnet und der seinen Ursprung in einer exaltierten Egozentrik hat.{119}
Читать дальше