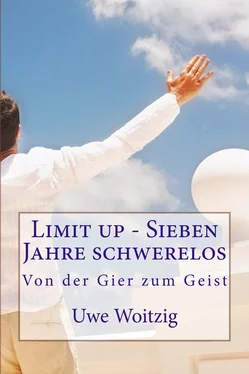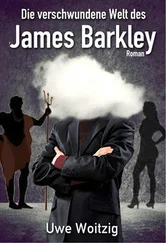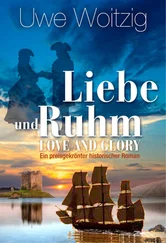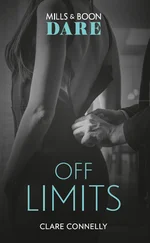Als ich in das Schlafzimmer zurückkam, stand Clinton grinsend neben dem zerwühlten Bett und hielt einen Ohrring hoch, den eines der Girls verloren haben musste.
„So this is your “Jetlag”, right? You bastard have obviously screwed your brains away last night!”
Lachend fielen wir beide aufs Bett. Dieser Augenblick war der Beginn einer tiefen Freundschaft und „Jetlag“ wurde unser Code für wilden Sex außerhalb unserer Beziehungen und Ehen.
Bei unserem gemeinsamen Mittagessen im „La Grenouille“, einem der besten Restaurants der Stadt, fragte ich Clint, ob wir seine Adresse auf unseren Briefbogen einsetzen könnten.
„Sure“, erwiderte er.
Damit hatte unsere Firma dank Clinton eine Anschrift auf der Park Avenue in Manhattan, einer der feinsten Adressen New Yorks, und wir waren unabhängig von unserem ehemaligen Brokerhaus. Nichts stand unserem kometenhaften Aufstieg mehr im Wege. Das Motto hieß: limit up.
Wenn der Sturm am meisten braust,
Kommt stets ein Vogel herbei,
Um uns zu beruhigen.
Ein unbekannter Vogel.
Er singt, bevor er sich wieder in die Lüfte erhebt.
(Rene Char)
Während meines diesmaligen Aufenthaltes im Big Apple hatte ich vergeblich versucht, Clintons Witwe Jessie zu treffen. Die New Yorker Telefonauskunft konnte sie nicht finden. Deshalb war ich zu ihrer letzten mir bekannten Adresse gegangen, aber sie war verzogen. Ihre Nachbarn hatten keine Ahnung wohin. So stand ich an einem regnerischen Nachmittag alleine an Clintons Grab. Er war auf einem kleinen Friedhof im Schatten einer düster wirkenden Kirche Downtown Manhattan beerdigt worden. Es war unfassbar für mich, dass dieser vor Lebenslust strotzende Mann, der in jeder schwierigen Situation noch ein Kaninchen aus dem Ärmel gezogen hatte, das ihn und andere rettete, seinen persönlichsten Kampf verloren hatte.
Ich hatte ihn um Rat gefragt, als Thassou, mein griechischer Partner in Monte Carlo, ein Problem mit einer Boeing 747 hatte. Ein arabischer Scheich hatte ihn gebeten, die mit allem Luxus dieser Welt ausgestattete Maschine, die nach den ausgefallenen Wünschen des Emirs umgebaut worden war, für 140 Millionen Dollar zu verkaufen. Tatsächlich fand Thassou einen Käufer, aber plötzlich wollte der Araber nicht mehr verkaufen. Thassou war darüber verständlicherweise stocksauer, weil ihm die Riesenprovision entging.
„Warum stehlt ihr das Ding nicht einfach?“ hatte Clint grinsend geantwortet, als ich ihm den Fall geschildert hatte.
„Ihr liefert es bei dem Käufer ab, kassiert den Kaufpreis und überweist das Geld abzüglich der Provision an den Araber. Er kann juristisch vermutlich gar nichts machen, weil ihm kein Schaden entsteht. Ich kenne da übrigens einen Typen, der einen Jumbo fliegen kann …“
Clinton kannte immer einen Typen, der genau das konnte, was gerade benötigt wurde. Nicht nur wegen seiner exzellenten Kontakte in alle Bereiche der menschlichen Gesellschaft fehlte er mir sehr. Nie wieder würde ich mit ihm in einem erlesenen Restaurant sitzen, wo er genüsslich die feinsten Speisen vertilgte und mich dabei mit seinen geistreichen Bonmots zur Weltlage, über unsere Geschäftspartner und über Frauen zum Lachen brachte. Er war der Einzige gewesen, den ich während meiner Flucht aus angerufen hatte. Sofort schlug er mir vor, nach Kanada zu kommen. Er würde mich mit seinem Porsche abholen, in die Vereinigten Staaten schmuggeln und in seinem Haus in Greenwich verstecken. Ich lehnte sein Angebot damals ab, weil ich ihn nicht in Gefahr bringen wollte. Aber natürlich fand ich es großartig.
Durch Clinton hatte ich viele außergewöhnliche Menschen kennen gelernt, aber auch eine besonders bemerkenswerte Begegnung gehabt. An einem Sonntag hatte er mich zum angesagtesten Brunch der City ins „River Café“ eingeladen. Wir standen an einem der Stehtische mit Blick auf die Brooklyn Bridge und den Hudson River und genossen die köstlichen Snacks vom Büfett, als ich plötzlich von hinten geduscht wurde. Jemand hatte mir etwas Kaltes ins Genick geschüttet. Ich drehte mich um und vor mir stand eine zierliche Frau mit kurzen roten Haaren und den schönsten blauen Augen, die ich je gesehen hatte. Sie entschuldigte sich vielmals bei mir und lud mich als Entschädigung zu einem Glas Champagner ein. Ich nahm an und drehte mich wieder zu Clint.
„Weißt du nicht, wer sie ist?“ fragte er mich.
Sie kam mir bekannt vor, aber ich hatte keine Ahnung, wer sie war. Also schüttelte ich den Kopf.
„Das ist Julie Christie. Die ´Lara` aus ´Doktor Schiwago`. Dein großer Schwarm deiner Jugend wie du mir erzählt hast.“
Sofort drehte ich mich wieder zu ihr um.
„Ich habe es mir überlegt. Ich möchte keinen Champagner, ich möchte einen Kuss von Ihnen“, sagte ich frech. Sie runzelte die Stirn und sah mich entrüstet, doch interessiert an. Begeistert erklärte ich ihr, wie sie in der Rolle der Lara mein Frauenbild geprägt hatte. Und dass ich mir ihretwegen den Film dreimal hintereinander angesehen hätte.
Sie lächelte mich an, aber es war das professionelle Lächeln einer Stewardess. Dann legte sie ihre Hände auf meine Schultern, zog mich zu sich herunter und küsste mich leicht auf beide Wangen. Ich überlegte kurz, ob ich sie an unseren Tisch einladen sollte. Aber dann sah ich sie mir genauer an. Diese zierliche, manierierte und sicher auch neurotische Frau hatte nicht das Geringste mit der von mir idealisierten Filmfigur gemeinsam, mit der sie nichts mehr zu tun haben wollte, wie auch die radikale Veränderung ihrer Frisur bewies. Sie war leider überhaupt nicht mein Typ. Wieder erfüllte sich ein Jugendtraum. Wieder zerplatzte eine Illusion.
*
Ich kniete an Clints etwas verwahrlost wirkendem Grab nieder und grub mit bloßen Händen ein Loch in die morastige Erde, um eine Flasche Lagavulin, Clints Lieblingswhisky, darin einzugraben. Mit Tränen in den Augen verließ ich danach den menschenleeren Friedhof und wanderte ziellos durch die mir völlig unbekannte Gegend. Bis es mir gelang, ein Taxi zu erwischen und in mein Hotel zurück zu kehren. In meinem Zimmer zog ich mir die tropfnassen Klamotten aus und duschte ausgiebig. Obwohl ich mich danach etwas besser fühlte, hielt ich es nicht aus, hier alleine herumzusitzen. Ich verließ das Waldorf und ließ mich von einem Cab zu „Michael´s Pub“ bringen. Der Kneipe, in der Woody Allen einmal die Woche mit seiner Band erstklassigen Jazz spielte. Clint und ich hatten hier oft an der Bar gehockt und den wehmütigen Klängen der Klarinette dieses schmächtigen kleinen Juden gelauscht, der so verzweifelt hinter der Liebe der Frauen her rannte und dabei immer unglücklicher wurde. Wie an seinem Gesicht unschwer zu erkennen war.
Heute war Woodys Auftritt und an diesem Abend schien er mir noch zerbrechlicher und verwirrter zu sein als in meiner Erinnerung. Seine abwechselnd schrillen und melancholischen Improvisationen offenbarten seinen zerrissenen Seelenzustand genauso deutlich wie seine Filme. Erschreckend, wohin diese Sehnsucht nach der bedingten, egoistischen Liebe ihn trotz seines Welterfolgs auf der geistigen Ebene gebracht hatte. Wieder einmal hatte ich das Gefühl, in einen Spiegel zu sehen.
Ich bestellte mir ein Glas Lagavulin und sah mir die Gäste in der dicht gefüllten Kneipe sehr genau an. Clint und ich hatten oft über New York und seine Bewohner philosophiert. Wir waren beide der Ansicht, dass der „Big Apple“ eine verängstigte Stadt ist, in der alle mit hängender Zunge hinter dem Geld herjagen. Die Bankiers genau wie die Straßenräuber, die Businessmen ebenso wie die Nutten. Ich schaute mir die Augen der um mich herum stehenden Männer an und erblickte darin Angst und Wut. Bestimmt lebten sie hinter dreifach verriegelten Türen. Clint pflegte zu sagen, dass ihre Leben in der gnadenlosen Ellbogengesellschaft Manhattans hauptsächlich daraus bestünden, andere Männer zu bekämpfen, die sie nicht hassten, und mit Frauen zu schlafen, die sie nicht liebten.
Читать дальше