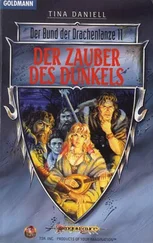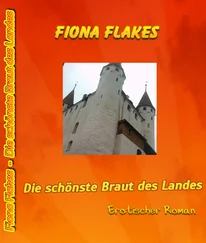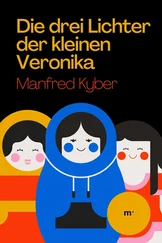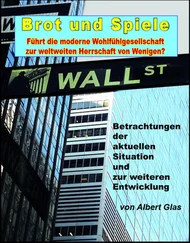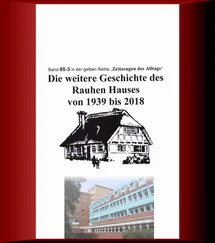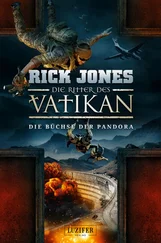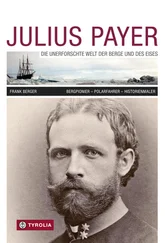Gleiches gilt mutatis mutandis für den Einkauf von Bandbreiten bei der Netzanbindung sowie den Ausbau und Betrieb der lokalen Netze.
(c) Kapazität an Rechenleistung und Speicher
Die Hochverfügbarkeit von IT-Systemen, also die Garantie, auch bei ernsthaften Hardwareausfällen den auf 24 / 7 Basis definierten Dienst binnen einer kurzen Zeitspanne wieder aufsetzen zu können, setzt die Verdoppelung zentraler Hardwareressourcen voraus, sodass im Problemfall ein spiegelndes System das gestörte Produktionssystem ersetzen kann. Dies ist an einzelnen Hochschulen offensichtlich nicht finanzierbar. Einen völligen Ersatz der Bereitstellung von Serverleistung und Speicherkapazität durch die Rechenzentren einzelner Hochschulen halten wir vor allem auf Grund datenschutztechnischer Probleme für wenig zielführend; aber auch deshalb, weil nur die Inanspruchnahme von Cloud-Leistungen durch technisch versierte Stellen das Entstehen von Abhängigkeiten von externen Anbietern verhindern kann.
Für die Bereitstellung von Rechenleistung und Speicherkapazität empfehlen wir daher den Aufbau von IT-Zentren, die jeweils mehrere – räumlich nahe beieinander liegende – Hochschulen bedienen und von diesen gemeinsam betrieben werden. Innerhalb dieser regionalen akademischen IT-Zentren kommen Cloud-orientierte Technologien zum Einsatz. Landesweit bestehen Verträge zwischen diesen regionalen Zentren, die den Ausgleich von Spitzenlasten zwischen den regionalen Zentren ermöglichen.
Bei Konzeption dieser mehrere Einrichtungen abdeckenden IT-Zentren wird dringend empfohlen, die Konstruktion der kommunalen Rechenzentren zu Vergleichen heran zu ziehen.
(d) Betrieb von eMail und anderen Kommunikationsplattformen
Abgesehen von Kostenvorteilen durch die Zusammenfassung der Verwaltung von Maildiensten und anderen Kommunikationsplattformen entsteht durch diese Konzentration auch ein wesentlicher Anreiz für die Vereinheitlichung des Auftrittes der Informationssysteme einer Hochschule. Ein fugenloses einheitliches Angebot der Hochschulinformationsangebote ist wiederum eine Voraussetzung für Synergien zwischen den Informationsangeboten der einzelnen Hochschulen.
Grundsätzlich sollte daher gelten, dass es insgesamt nur einen eMail-Dienst an der Hochschule geben darf und dies auch bei allen anderen Informationsdiensten – hier seien z.B. Content Management Systemen für den Betrieb von Homepages genannt – der Fall ist. Dabei entsteht freilich ein Interessenkonflikt: Die Hochschulen des Landes haben, in ihrem Selbstverständnis als Träger der Innovation auch im Bereich der Informationsangebote, ein Interesse daran, ihre Einrichtungen dazu zu ermutigen als „early adapters“ aufzutreten, also mit neuen Informationsplattformen zu experimentieren, bevor diese sinnvoll als hochschulweiter Standarddienst angeboten werden kann.
Durch die derzeitige Politik einzelnen Einrichtungen das Aufbauen neuer Technologien auf eigene Kosten zu erlauben, sie aber bei Einrichtung einer hochschulweiten Übernahme dieser Technologie gleich zu behandeln, wie später kommende, werden early adapters de facto bestraft: Sie haben den Erstaufbau einer Technologie aus eigenen Mitteln finanziert. Werden andere Einrichtungen beim wesentlich späteren Einsatz der neuen Technologie auf hochschulweit einheitliche Weise durch eine reine Beratung unterstützt, bedeutet dies, dass early adapters zu diesem Zeitpunkt bereits bestehende Informationsressourcen auf eigene Kosten auf die letztendlich von der Hochschule gewählte Technologie umstellen müssen. Dies macht es völlig unökonomisch, sich dem hochschulweiten Angebot anzuschließen.
Wir empfehlen daher, dass bei der Übernahme einer Kommunikationsplattform als hochschulweiter Dienst einerseits ein verbindliches Service Level für den Betrieb dieser Kommunikationsplattform festgeschrieben wird, andererseits Einrichtungen, die diese Technologie zu einem früheren Zeitpunkt bereits in eigener Initiative eingeführt haben, konkrete Mittel zur Verfügung gestellt werden, wenn sie ihre innovativen Vorleistungen zu Gunsten eines einheitlichen Standards aufgeben.
Wir haben diese Überlegungen in den Abschnitt über die Unterstützung der Basis-IT-Infrastruktur für mehrere Hochschulen eingestellt, weil es uns realistisch erscheint, dass das Festschreiben verbindlicher Service Levels für den Betrieb von Kommunikationsplattformen ebenfalls eine Hochverfügbarkeit voraussetzt, wie im vorigen Abschnitt postuliert. Auch diese Dienste werden daher besser durch mehrere Hochschulen bedienende Dienstleistungszentren zu realisieren sein, als in den einzelnen Hochschulen.
(e) Langzeitarchivierung
An den Hochschulen des Landes gibt es derzeit keine systematischen Vorkehrungen für die Langzeitarchivierung. Diese ist für drei Sektoren notwendig:
1. Für die langfristige Verfügbarkeit von Wissenschaftsressourcen, wie bibliothekarischen Ressourcen und kalibrierten Standarddatensätzen zur Überprüfung von Versuchsanordnungen.
2. Für die langfristige Sicherung von Dokumenten, für deren langfristige Bereitstellung gesetzliche Verpflichtungen 13bestehen.
3. Für die Sicherung von Forschungsdaten nach den Maßgaben der DFG, 14also die Bereitstellung der wissenschaftlichen Publikationen zu Grunde liegenden Experimentaldaten im Sinne der wissenschaftlichen Qualitätssicherung.
Zwischen den Punkten 1 und 2 einer-, 3 andererseits bestehen hier gravierende Unterschiede.
Sowohl bibliothekarische Ressourcen, als auch rechtlich relevante Dokumente sind im Prinzip unbeschränkt aufzubewahren. Das heißt insbesondere, dass sie auch nach Technologiebrüchen benutzbar bleiben müssen, also einer überwachten Datenhaltung nach den international diskutierten Standards der Langzeitarchivierungsdebatte unterliegen. Nachdem eine der ersten Regeln für diesen Bereich darin besteht, dass mehrere physikalische Kopien so aufzubewahren sind, dass möglichst keine Katastrophen denkbar sind, die alle Kopien gleichzeitig zerstören, ist dies ein Bereich, bei dem eine isolierte Lösung des Problems an einer Hochschule schlechterdings nicht denkbar wäre.
Hier empfehlen wir, die Langzeitarchivierung analog zum empfohlenen Ausgleich von Spitzenlasten zwischen den im vorigen Abschnitt beschriebenen System von regionalen, jeweils mehrere Hochschulen bedienenden hochverfügbaren IT-Zentren zu konzipieren. Zur landesweiten Koordination ist eine Landeseinrichtung zu beauftragen oder zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft weitere Technologien auf ähnliche Weise aus dem Bereich der einzelnen regionalen Zentren in den landesweit analog zur Langzeitarchivierung koordinierten Bereich übergehen werden.
Bei der Aufbewahrung von Experimentaldaten zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung ist eine Aufbewahrung „für immer“, also über die von der DFG vorgesehenen Fristen hinaus, nicht zwingend notwendig. Da es bei der derzeitigen Entwicklungsgeschwindigkeit der IT kaum anzunehmen ist, dass digitale Daten binnen zehn Jahren nicht mehr verarbeitet werden können, wenn am Ende des Projekts eine vollständige, aber nicht alle Aspekte der unbefristeten Langzeitarchivierung abdeckende Dokumentation der Datenformate und der verwendeten Software erfolgt, könnte diese Aufgabe prinzipiell den einzelnen Hochschulen überlassen werden. Da mindestens manche derartige Experimentaldaten jedoch durchaus das Potential haben, langfristig wertvoll zu bleiben – man denke an meteorologische Aufzeichnungen – und überdies bei datenintensiven Projekten Datenmengen anfallen, die über den durchschnittlichen Bedarf einzelner Hochschulprojekte deutlich hinausgehen, empfehlen wir, den für die landesweite LZA zu organisierenden kooperativen Verbund zwischen den regionalen IT-Zentren von vornherein so anzulegen, dass dieser Problemkreis mit abgedeckt wird.
Wir weisen darauf hin, dass die Hochschulen des Landes sich im Bereich der wissenschaftlichen Qualitätssicherung derzeit de facto systematisch der Nichteinhaltung der DFG Bestimmungen schuldig machen. Nach Ansicht der DFG ist die Pflicht zur Bereithaltung der Daten nach Projektende eine rechtlich bindende Verpflichtung, die mit Annahme der Förderung eingegangen wird. Nach Ansicht der Hochschulrechenzentren handelt es sich dabei um eine unverbindliche Empfehlung. In der Praxis dürften in den wenigsten Projekten in den üblicherweise hektischen Abschlussmonaten die angefallenen Daten so gesichert werden, dass sie nach fünf oder zehn Jahren tatsächlich zur Replikation von Experimenten herangezogen werden könnten.
Читать дальше