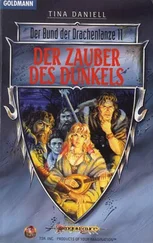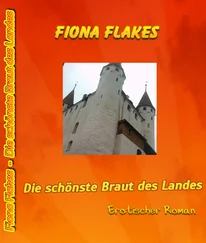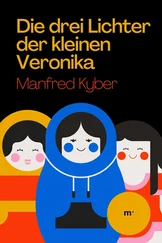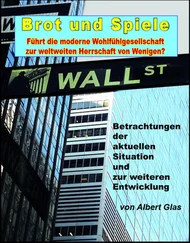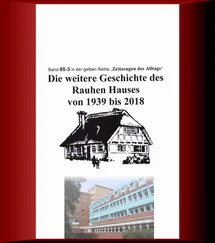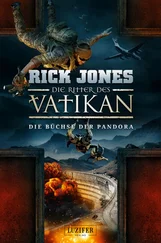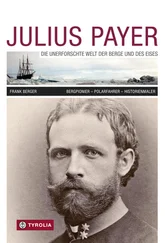1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Diese drei Voraussetzungen werden u.E. nach am besten durch eine Struktur gefördert, in der die gemeinsame IT-Infrastruktur, auf der die Informationsdienstleistungen der Hochschulen aufbauen, sukzessive von einem institutions- auf ein standortorientiertes Modell umgestellt werden. Als „Standort“ verstehen wir dabei einen regionalen Einzugsbereich dessen Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen räumlich so nahe beieinander liegen, dass eine persönliche Konsultation zwischen Infrastrukturmitarbeiter und Endkunde an einer dieser Hochschulen innerhalb ein und desselben Tages ohne aufwändige Terminabsprachen oder Reiseplanungen möglich ist. Nach diesem Modell, das die Grundkonzeption „Wettbewerb durch effektivere Nutzung öffentlicher Infrastruktur“ praktisch umsetzt, sollten also z.B. Universität und Fachhochschule eines zentralen Ortes – ggf. zusammen mit den spezialisierten Kunst- o.ä. Hochschulen desselben Ortes – und die entsprechenden Einrichtungen des unmittelbaren Umlandes durch eine gemeinsame Einrichtung bedient werden. Diese Einrichtung deckt in der Anfangsphase z.B. die gemeinsame Wartung der Netze der genannten Einrichtungen ab, alsoe stellt Ihre eMail und die Backup-Dienste sicher und übernimmt später zusätzliche Aufgaben gemeinsamer Infrastruktur, bis hin zur Bereitstellung weitgehend virtualisierter Hardwareleistung. Ob und wann diese aus dem unmittelbaren Kontext der einzelnen Einrichtungen gelösten Infrastruktureinrichtungen dann ihrerseits Dienstleistungen eines Cloud-Anbieters in Anspruch nehmen und an die von ihnen bedienten Einrichtungen weitergeben, kann später entschieden werden.
Dies scheint uns insbesondere auch wegen der oben postulierten Notwendigkeit wichtig, Informationsinfrastrukturen der Hochschulen in Zukunft hoch verfügbar zu betreiben. Ohne hier die insgesamt aufwändigen Vorkehrungen für die Hochverfügbarkeit von Systemen im Einzelnen diskutieren zu wollen, ist eine der offensichtlicheren Vorkehrungen für die Hochverfügbarkeit die, die verantwortlichen Teile der Infrastruktur zu doppeln, also in die Lage zu kommen, bei Ausfall eines Rechnersystems ein im Standby betriebenes zweites als Ersatz zuschalten zu können, was etwa im Bereich kommunaler Rechenzentren, die aus gutem Grund in der Regel nicht von einzelnen Kommunen, sondern von Gruppen von Kommunen betrieben werden, durchaus üblich ist.
An sämtlichen Hochschulen des Landes die Hardwareausstattung der Rechenzentren zu doppeln, wäre offensichtlich nicht finanzierbar und in dieser Form auch nicht notwendig: Fällt ein forschungsorientiertes System – etwa ein Hochleistungscluster – vorübergehend aus, so ist dies zwar unerfreulich, betrifft aber keinen Teil der Infrastruktur, dessen Hochverfügbarkeit systemkritisch ist. Die Doppelung müsste also jene Teile der Infrastruktur für die Informationsversorgung betreffen, die wir im Abschnitt 2.2. als Basisinformationsinfrastruktur, unterschieden von den Anforderungen wissenschaftlichen Rechnens, identifiziert haben.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass es kurzsichtig wäre, dies als eine Schwächung kleinerer Einrichtungen anzusehen. Abgesehen davon, dass wir im Abschnitt 2.3.2 Kooperationsmodelle aufzeigen, die der Gefahr einer Dominanz größerer Einrichtungen über kleinerer, für die sie Leistungen miterbringen, begegnen, halten wir gerade für die kleineren Hochschulen dies Modell für vorteilhaft: Erlaubt es den Studenten und Studentinnen doch, Hochschule ausschließlich auf Grund des Angebotes an Studiengängen und Betreuungsqualität zu wählen, und nicht auf der Basis der finanziellen Möglichkeit einer Hochschule für die Bereitstellung von Informationsinfrastrukturen. Dieses Argument wird in den Szenarien im Abschnitt 2.6 weiter ausgeführt.
Je größer die Erwartungen an die Mindestausstattung mit informationstechnischen Infrastrukturen wird, desto mehr wird es gerade für die kleineren Einrichtungen heißen: Kooperieren oder Kollabieren.
2.3.1. Erforderliche Restrukturierungsmaßnahmen
Wir hatten bereits in Abschnitt 2.1.5. beschrieben, dass einer der wesentlichen Zukunftstrends der nächsten fünfzehn Jahre eine stärkere Trennung von Front- und Backoffice, anders ausgedrückt, den sozialen und den technischen Komponenten, von Informationsversorgungseinrichtungen sein wird. Zusammen mit den voranstehenden Überlegungen zur Abkehr von institutions- hin zu regionsorientierten Infrastrukturen schlagen wir folgendes Modell vor, bei dem zum Unterschied von anderen Abschnitten stärker als bisher zwischen allgemeinen Einrichtungen der Informationsversorgung und im weitesten Sinne bibliothekarischen unterschieden wird.
2.3.1.1. Ausbau der einheitlichen IT-Basisinfrastruktur über die einzelnen Einrichtungen hinaus
Dabei betrachten wir zunächst: (a) Identity Management (b) Hardwarebereitstellung und Netzbetrieb, (c) Kapazität an Rechenleistung und Speicher, (d) Betrieb von eMail und anderen Kommunikationsstrukturen und (e) Langzeitarchivierung.
(a) Identity Management
Aus im Abschnitt 2.4.1. erörterten Gründen halten wir die Einführung einer institutionsübergreifenden Identität langfristig für eine extrem wichtige Maßnahme. Unbeschadet der dort diskutierten weiter greifenden Konzeption ist eine institutionsunabhängige Identität des Nutzers der Informationsversorgung der Hochschulen auch kurzfristig eine entscheidende Maßnahme für die effektive Nutzung gemeinsamer Ressourcen. Diese bildet wiederum die Basis für zwei wichtige Entwicklungen: Sowohl die Nutzung von infrastrukturellen Angeboten von räumlich nahe beieinander liegenden Hochschulen als auch den Austausch von Lehrleistungen und die gemeinsame Durchführung von Studiengängen. Auf den RuhrCampusOnline ist hier als wichtiges zukunftsweisendes Projekt explizit hinzuweisen.
Hier hat der DV-ISA 12den Auftrag zur Prüfung der technischen Machbarkeit einer NRW-Karte, also eines an allen (staatlichen) Hochschulen des Landes gültigen Identifikationsmittels, innerhalb seiner Mitgliedschaft bereits vergeben. Dies halten wir für eine zentrale und unverzichtbare Maßnahme zur Ausnutzung infrastrukturell möglicher Synergien, die ggf. auch dann weiter zu verfolgen ist, falls der kurzfristigen Umsetzung technische und oder / administrative Hindernisse entgegenstehen sollten.
(b) Hardwarebereitstellung und Netzbetrieb
Für die Beschaffung technischer Massengüter – wie Arbeitsplatzrechner sie heute darstellen – hat Baden-Württemberg ein hervorragendes Beispiel geliefert. Wir empfehlen daher nachdrücklich, das dort mit großem Erfolg erprobte Modell der Beschaffung auf der Basis vom Lande garantierter Mindestabnahmemengen zu übernehmen bzw. systematischer anzuwenden.
Zum Verständnis: Nach diesem Modell wird etwa die landesweite Lieferung von mindestens 5.000 Arbeitsplatzrechnern einer bestimmten Leistungsklasse innerhalb des nächsten Jahres ausgeschrieben. Das Land garantiert, dass diese Menge mindestens abgenommen wird. Nach Abschluss eines Rahmenvertrages haben schließlich alle Hochschulen des Landes die Möglichkeit zu den Bedingungen dieses Rahmenvertrages zu bestellen. Wird die Mindestbestellmenge erreicht, entstehen für das Land keine Kosten. Im Falle Baden-Württembergs hat diese Politik zu auffällig günstigen Konditionen geführt.
Diese Politik scheint uns auf viele weitere Bereiche in der Informationsversorgung insgesamt übertragbar und hat zugleich den Vorteil, dass für die Hochschulen in den wenigen Fällen, in denen die so per Rahmenvertrag verfügbaren Produkte aus speziellen Gegebenheiten nicht verwendbar sind, keinerlei Einschränkung der Beschaffungshoheit stattfindet.
Bei der Wartung von Hardware ist langfristig wohl davon auszugehen, dass die verbleibenden Wartungskapazitäten an den Hochschulen nochmals deutlich abgebaut werden. Auch hier scheint es naheliegend, die Marktmacht der Hochschulen gesamt einzusetzen, also – ggf. unter Einbeziehung in die Ausschreibungsbedingungen für die eben benannten garantierten Rahmenabnahmeabkommen – Wartungsverträge über einzelne Hochschulen hinaus auszuschreiben.
Читать дальше