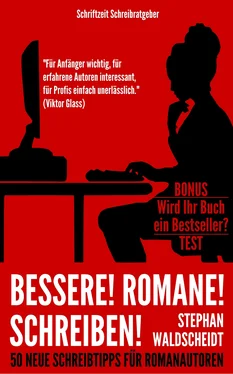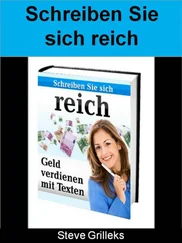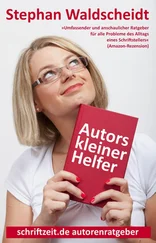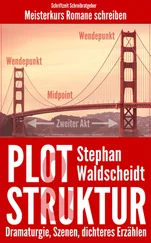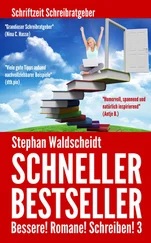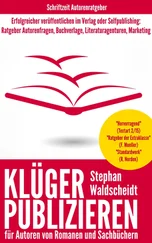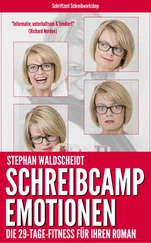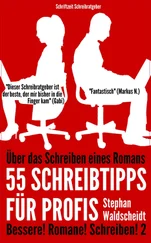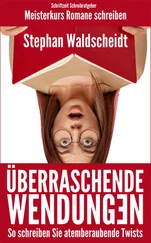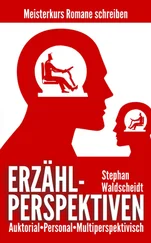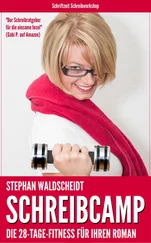An » Zwei an einem Tag « lässt sich gut der Unterschied zwischen Geschichte und Plot erkennen: Die Geschichte ist das, was geschieht, der Plot, die Art und Weise, wie es der Autor geschehen lässt.
Für Ihren Roman heißt die Herausforderung: einen Plot zu kreieren, der Ihre Geschichte auf die – nach Ihren Kriterien und nach Kriterien des Erzählhandwerks – effektivste Weise erzählt.
Oft ist der erstbeste Plot, der einem einfällt, eben nicht der Beste. Nicholls gelingt es mit seinem ungewöhnlichen Plot, einen emotional intensiveren Moment und ein befriedigenderes Ende zu schaffen, als hätte er die Geschichte chronologisch heruntererzählt. Beim Leser bleibt das Gefühl, eine in sich abgeschlossene, runde Geschichte gelesen, nein, erlebt zu haben.
Seien Sie nicht zu schnell zufrieden. Eine solch zentrale Entscheidung wie die nach dem Hauptplot und der Struktur Ihres Romans sollte gut überlegt sein, denn sie später zu ändern, erfordert enorm viel Kraft und Zeit.
Achten Sie auch darauf, nicht zu kompliziert zu werden. Gerade unerfahrene Autoren, sprich: Autoren, die an ihrem ersten Roman schreiben, neigen dazu, sich mit einer komplexen Plotkonstruktion zu viel auf einmal aufzubürden. Wenn Sie von der chronologischen Erzählweise abweichen, sollten Sie einen verdammt guten Grund dafür haben. Beeindrucken tun Sie mit außergewöhnlichen Romanstrukturen niemanden, schon gar keine Lektorin.
Fragen Sie sich: Wie erzähle ich meine Geschichte am effektivsten? Das allein sollte Ihre Richtschnur sein.
3. Erzählen und Erzählperspektive
In diesem Kapitel:
Wie Sie souverän erzählen
Erklärungen – die gefährlichste Versuchung des Romanautors
Die zwei Gefahren der Ich-Form
Wie Sie souverän erzählen
» Wer erzählen kann, gewinnt Souveränität «
» Wer erzählen kann, gewinnt Souveränität «, sagt der durch humorvolle Kurzgeschichten bekannt gewordene ehemalige Journalist Axel Hacke (» Das war meine Rettung «, ZEITmagazin Nr. 52 vom 16.12.2010). Das Gleiche gilt umgekehrt: Zum Erzählen gehört eine souveräne Erzählstimme. Es ist ein sich selbst verstärkender Prozess.
Nur ein souveräner Erzähler zieht den Leser in seine Erzählung. Erinnern Sie sich an die Märchenonkels und -tanten Ihrer Kindheit. Am liebsten hörte man denen zu, die selbstbewusst auftraten und ihre Geschichte überzeugend vortrugen. Sie mussten nicht einmal freundlich sein – waren sie unheimlich, strahlten sie etwas Düsteres aus, umso besser. Zuhören (oder Lesen) heißt auch, sich dem Erzähler anzuvertrauen. Ein zögerlicher, ein stotternder, ein unglaubwürdiger Erzähler – jeder von ihnen ist das Ende jeder noch so guten Geschichte.
Arbeiten Sie an Ihrer Erzählstimme, bis Sie in Ihrem Roman die Souveränität ausstrahlen, die man von einem Erzähler erwartet.
Was gehört dazu?
Ein sicheres, selbstbewusstes Auftreten. Beim Schreiben heißt das: Schreiben Sie aktiv. Und vielleicht verzichten Sie doch lieber auf solche Wörter, die den ganzen Text tendenziell eher verlangsamen oder ihn gewissermaßen ins Stolpern bringen.
Klingt das souverän? Nein? Wie wäre es hiermit:
Verzichten Sie auf Wörter, die den Text verlangsamen oder ihn zum Stolpern bringen.
Geht es noch souveräner? Ja:
Lassen Sie weg, was den Text bremst.
Was aber, wenn der Erzähler in Ihrer Geschichte oder die Figur, aus deren Perspektive Sie erzählen, ein schüchterner Mensch ist? Dann schreiben Sie auf souveräne Weise unsouverän. Indem Sie zu der Figur werden (die Sie übrigens, als ihr Schöpfer, sowieso schon sind), indem Sie die Dinge auf glaubhafte, mehr noch: auf überzeugende Weise mit den Augen der Figur sehen, mit ihrem Körper, ihrem Herzen fühlen und das alles dem Leser mitteilen.
Zeigen Sie dem Leser, dass er Ihnen vertrauen darf.
Vertrauen ist ein Gefühl, ein Wohlgefühl. Lassen Sie den Leser spüren, dass er bei Ihnen gut aufgehoben ist. Enttäuschen Sie ihn nicht.
Zu Anfang Ihres Romans machen Sie Versprechungen darüber, was den Leser erwartet. Erzeugen Sie auf den ersten Seiten eine düstere Atmosphäre voller unguter Vorahnungen, erwartet der Leser im Verlauf der Geschichte angenehm Schreckliches. Überraschen Sie ihn dann mit einer lockeren Schmonzette, fühlt er sich zurecht verraten.
Gelegenheit, Vertrauen aufzubauen, haben Sie während des ganzen Romans, mit jeder Seite, jedem Absatz, jedem Wort. Doch Vorsicht: Sie können dieses Vertrauen jederzeit verspielen.
Das Vertrauen Ihres Lesers zu Ihnen wird umso mehr wachsen, je häufiger Sie ihn durch überzeugende und emotional starke Momente hindurchführen: Da, denkt er, wieder eine Szene, die mich zum Heulen oder Zähneknirschen bringt, eine fiese Überraschung, eine unerwartete Wendung – und Sie als Erzähler bleiben in der Spur und behalten alle Zügel des Plots im Griff. Das schafft Vertrauen.
Erhalten tun Sie sich dieses Vertrauen mit wissenswerten Informationen, klugen Bemerkungen und ironischen oder humorvollen Einsprengseln an den richtigen Stellen und im richtigen Maß.
Zu einem souveränen Erzähler gehört Authentizität. Überzeugen Sie den Leser, dass die Geschichte aus Ihrem Inneren kommt und nicht bloß, sagen wir, für Geld und Ruhm geschrieben wurde – egal, was Ihre wahren Gründe sind.
Zur Authentizität gehört, dass der Leser bei Ihnen als Autor eine starke emotionale Beteiligung am Geschehen spürt – ohne dass diese Ihre Fähigkeiten als Erzähler trübt. Wenn Sie als Autor, allem Anschein nach, der eigene Text nicht interessiert, wie wollen Sie dieses Engagement dann von Ihrem Leser erwarten!
Souveränität ist auch eine Charakterfrage. Wenn Sie eher ein zurückhaltender Mensch sind, werden Ihre Texte das in einem gewissen Maße spiegeln. Kein Problem. Als Autorin sind Sie der Märchentante gegenüber im Vorteil: Sie können überarbeiten.
Achten Sie beim Überarbeiten gezielt auf die Souveränität Ihrer Erzählstimme – und ändern Sie die weniger souverän klingenden Stellen.
Da die Souveränität von Erzählerin und Erzähler – Märchentante, Märchenonkel – ein sich selbst verstärkender Prozess ist, gewinnen Sie durchs Schreiben auch persönlich an Souveränität.
Wenn das mal kein Ansporn ist.
Erklärungen – die gefährlichste Versuchung des Romanautors
... und wie Sie ihr widerstehen
Die Frau, die mir die Tür öffnete, kam mir winzig vor. Ich schaute auf sie hinunter wie auf ein Kind. Sie legte den Kopf in den Nacken.
Sie trug ein schwarzes Kleid mit weißem Spitzenkragen. Und feste schwarze Schuhe. Sie mochte Mitte fünfzig sein.
»Wer sind Sie?«, fragte sie.
»Wir haben telefoniert.«
»Sie sind Tabor Süden?«
»Glauben Sie mir nicht?«
»Zeigen Sie mal Ihren Ausweis.«
Ich gab ihr eine Visitenkarte.
»Was soll das denn?«, sagte die Frau, nachdem sie sich die kleine Karte dicht vor die Augen gehalten hatte.
Manchmal war ich übermütig.
So beginnt Friedrich Anis Krimi » Süden und das Gelöbnis des gefallenen Engels « (Knaur Tb 2001). Ein rasanter Anfang. Fehlt ihm etwas? Durchaus. Doch das, was fehlt, vermisst kein Leser: überflüssige Erklärungen.
Überflüssige Erklärungen sind eins der augenfälligsten Kennzeichen, die den Amateurschreiber vom Profiautor unterscheiden. Sie sind auch einer der Hauptgründe, weshalb Manuskripte abgelehnt werden.
Das heißt: Hier geht’s ums Eingemachte.
Warum geben Autorinnen und Autoren immer wieder und zu oft der Versuchung nach, Dinge zu erklären, die nicht erklärt werden müssen, nicht jetzt oder nicht hier?
Grund 1: Das Problem ist nicht bekannt.
Читать дальше