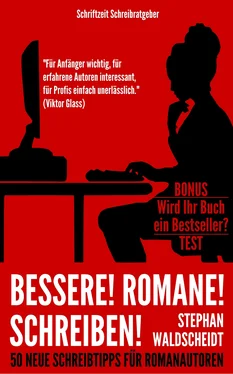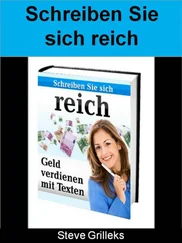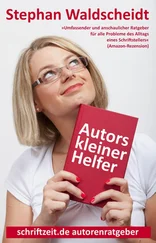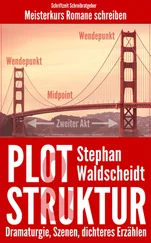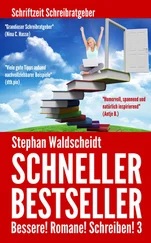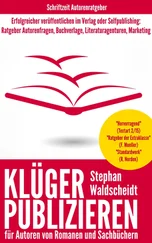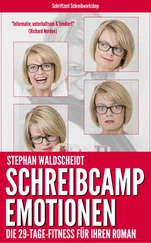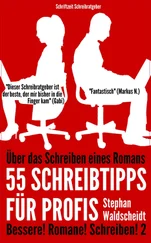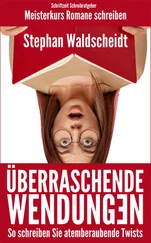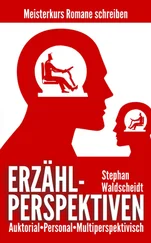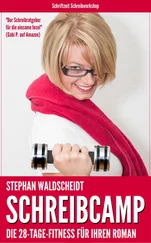Das war die gute Nachricht.
Die bessere, die jedoch noch mehr Arbeit macht: Jeder Mensch ist in jeder Beziehung anders. Bei Ihrem Partner sind Sie die Kuschelmaus, bei Ihren Angestellten die harte Chefin, bei Ihren Eltern Ihr Leben lang »unsere kleine Gabi«. Im Sportverein sind Sie der Scherzkeks, beim Klassentreffen die, die alles durcheinander säuft und trotzdem stehen bleibt und beim Einkaufen die kritische Kundin, die anstrengende Fragen stellt.
Bei Ihren Romanfiguren sollte das genauso sein. Auch wenn es Ihren Roman überfrachten würde, das alles darzustellen – es macht ihn welthaltiger und den Charakter realistischer, wenn sie die vielen potenziellen Beziehungen zumindest andeuten.
Für Sie als Erzähler heißt das: In jeder Beziehung, die Sie in Ihrem Roman betrachten, sollten Sie Ihren Charaktere zumindest ein wenig anders darstellen. Meistens machen Sie das automatisch, denn es ergibt sich aus dem Drive der Situation und des Dialogs. Aber sind Sie sich der Sache bewusst, können Sie überzeugendere, lebendigere Beziehungen und Charaktere schaffen.
Gerne dürfen Sie sich dabei der Beziehungspsychologie bedienen (wie Sie überhaupt vor nichts zurückschrecken sollten, was Sie inspiriert und Ihren Roman reicher macht, vielleicht mal von Selbststudien als Mörder abgesehen).
Die Struktur-Analyse etwa untersucht Kommunikation. Sie unterscheidet zwischen drei Ich-Zuständen, in denen sich ein Mensch befinden kann, wenn er kommuniziert: Kind-Ich, Erwachsenen-Ich und Eltern-Ich. Wenn sich etwa Albert im Kind-Ich (zum Beispiel als beleidigte Leberwurst) befindet, Barbara aber im Erwachsenen-Ich (eher rational argumentierend), sind Konflikte vorprogrammiert – und das bereits ohne widerstreitende Ziele.
Vernachlässigen Sie auch nicht die Eigendynamik, die Beziehungen entwickeln können. Es mag helfen, die zu schildernden Situationen zumindest im Ansatz durchzuspielen, bevor Sie ihnen auf der Seite Leben und Kraft einhauchen.
Sie können die Situation im Wortsinne durchspielen, mit echten Menschen. Das mag Ihnen blöd vorkommen. Keine Sorge. Sie müssen nicht die ganze Szene wie ein Theaterstück inszeniert herunterspulen. Oft genügt es schon, wenn Sie sich im Wohnzimmer hinstellen und Ihre Tochter (den Mörder) auf einem Stuhl drapieren und Ihren Mann (das unschuldige Opfer) auf dem Teppich. Schon bevor Sie irgendetwas tun, fallen Ihnen vermutlich Verbesserungen für Ihre Szene ein. (Ähnlich funktioniert wohl auch die nicht unumstrittene Therapiemethode der Familienaufstellung.)
Schüchterne Menschen kramen Ihre alten Puppen hervor und stellen die Szene mit ihnen nach.
Probieren Sie diese und andere Methoden aus. Sie werden verblüfft sein, um wie vieles reicher und lebendiger solche Inszenierungen die Beziehungen zwischen Ihren Romanfiguren machen – und am Ende Ihren ganzen Roman.
In diesem Kapitel:
Warum Sie Geschichten weben und nicht bloß spinnen sollten
Der Unterschied zwischen Geschichte und Plot
Warum Sie Geschichten weben und nicht bloß spinnen sollten
Ein Glas Sauerkirsch-Konfitüre, und der Leser weint
Lacey wandte sich zu ihm [Wolgast]. »Nimm ihn.«
Das tat er. Seine Arme waren noch geschwächt vom Klettern, aber er hielt ihn fest an sich gepresst. *
Eine der wichtigsten Romanfiguren in Justin Cronins Mystery-Thriller » Der Übergang «, Wolgast, ist ein lebendig geschilderter, überzeugender Charakter. Bei ihm schließen sich Wunden nicht automatisch, wirkt eine Anstrengung in der nächsten Szene nach. Cronin webt ein dichtes Netz in seinem Roman – und der Ausdruck des Webens scheint mir treffender als das englische »Spinning a yarn«, woher wohl auch unser Erzählfaden kommt. Einen Roman schreiben hat weit mehr mit Weben als mit Spinnen zu tun. (Zugegeben, der Witz mit dem Spinnen ist offensichtlich, den dürfen Sie gerne selber weiterspinnen.)
Viele Autoren kappen nach einer Szene zu viele ihrer Fäden. Sie scheinen froh zu sein, die Szene hinter sich gebracht zu haben und denken nicht mehr daran, was sie da mit ihren Figuren angerichtet haben. Das geht über reine Continuity-Fehler weit hinaus.
(Randnotiz: Continuity, Kontinuität, ist ein Begriff aus der Filmbranche. Dort werden eigens Leute beschäftigt, die Szenen so herrichten wie bei der Einstellung eine Woche zuvor – damit die rote Vase wieder genau so auf dem gelben Häkeldeckchen steht, an dem die Heldin mal kurz zupfen muss, um ihren Ordnungswahn zu demonstrieren.)
Eine gewebte Geschichte enthält Symbole, die an verschiedenen Stellen im Roman auftauchen. Eine gewebte Geschichte zieht den Leser tiefer in das Geschehen hinein. Warum? Weil er das Gefühl hat, einem Organismus beim Wachsen zuzusehen. Und nicht bloß einem roten Faden in ein Labyrinth hinein zu folgen.
Er [Wolgast] ging um kurz nach sieben. Nach so vielen Wochen, wo er nur herumgestanden war und Pollen von den Bäumen sammelte, protestierte der Toyota lange und keuchend, als Wolgast ihn startete, aber schließlich griff der Motor und lief. *
Cronin hätte Wolgast auch einfach ins Auto steigen und wegfahren lassen können. Gestört hätte das die Leser kaum, schließlich könnte der Toyota ja auch nach drei Wochen sofort anspringen. Aber mit seinem Rückgriff auf ein zurückliegendes Ereignis webt Cronin eine weitere Reihe in seinen Stoff, der Roman wirkt realistischer.
Und nicht nur das: Durch den Rückgriff auf den schlecht anspringenden Wagen zeigt Cronin die vergangene Zeitspanne, statt sie nur zu behaupten.
Schließlich hat das Geschichtenweben einen ganz praktischen Vorteil für Sie als Autor: Es gibt Ihnen einen willkommenen Anknüpfungspunkt, um in die Szene einzusteigen: hier Cronins Toyota.
Für Sie heißt das: Wenn Sie in einer Szene nicht wissen, was Sie Ihre Charaktere tun lassen sollen, probieren Sie es mit einer Verbindung zu einem zurückliegenden Ereignis. Der Charakter könnte sich an eine Unterhaltung erinnern, die sieben Szenen zuvor stattgefunden hat und den Gesprächspartner jetzt darauf ansprechen, vielleicht auf etwas, was der ihm gesagt hat. Oder Ihrem Charakter fällt beim Durchwühlen der Schränke ein Glas Konfitüre in die Hand, das er vor elf Szenen zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Frau gekauft hat. Sofort wallen Emotionen auf.
Sie können auf alles zurückgreifen, Stimmungen, Versprechen, Aussichten, Gegenstände, Wetterlagen, Toyotas, alles, was Ihnen nur einfällt, um ihren Stoff noch ein wenig dichter zu weben.
Kleiner Tipp: Je spezifischer die Details sind, die Sie in Ihre Geschichten einweben, desto leichter sind Rückgriffe möglich – und desto organischer erscheinen sie dem Leser.
Geschichten dicht zu weben, statt nur Erzählfäden zu spinnen, wird Ihrem Roman gut tun. Und ein banales Glas Sauerkirsch-Konfitüre löst plötzlich tiefe Gefühle aus. Auch bei Ihren Lesern.
__
*) eigene Übersetzung aus: Justin Cronin, » The Passage «, Ballantine 2010.
Der Unterschied zwischen Geschichte und Plot
Zwei in einem Buch
Bei seinem Roman » Zwei an einem Tag « (Kein & Aber 2010) bedient sich Autor David Nicholls am Ende eines Kniffs. Obwohl er eine der beiden Hauptfiguren sterben lässt, schafft er es, den Roman nicht auf einer traurigen Note enden zu lassen. Dazu hört er nicht mit der Sterbeszene auf, sondern durchbricht die Chronologie und endet mit dem Anfang und der Szene, in der für die Hauptfiguren Emma und Dexter die gemeinsame Geschichte beginnt.
Nicholls’ Roman ist für Autoren allein schon wegen des Plots interessant: Der Erzähler begleitet Emma und Dexter über zwanzig Jahre hinweg und zeigt ihr Leben an jedem 15. Juli. Ein wenig erinnert mich das an den Film » Harry & Sally «, ein wenig an Daniel Glattauers » Gut gegen Nordwind «.
Читать дальше