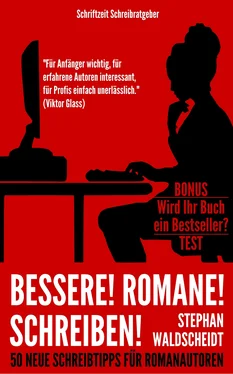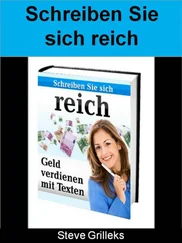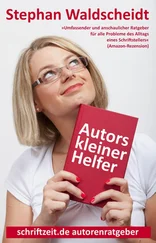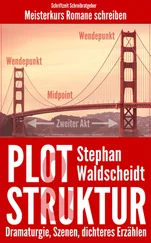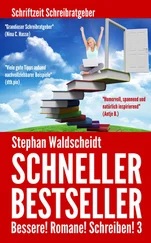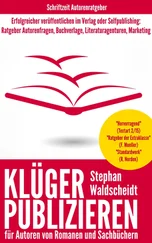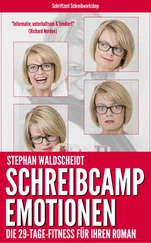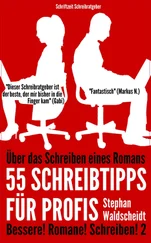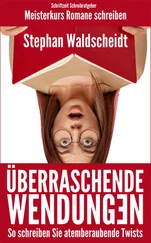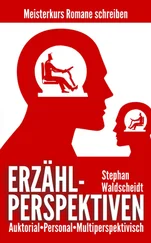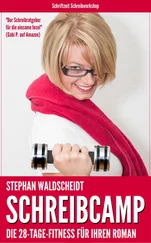Beim Erzähler könnte die Prämisse lauten:
»Musik machen in der Jugend führt zu einem glücklichen Leben als Erwachsener.«
Bei seinem Freund lautet sie eher:
»Musik machen in der Jugend führt zum Selbstmord.«
Aber diese Prämissen betreffen jeweils nur eine Erzählebene. Auf einer anderen Erzählebene, auf der es um die Freundschaft des Ich-Erzählers mit Niila geht, lautet die Prämisse des Ich-Erzählers, ein wenig umständlich, etwa so:
»Das Anregen und Pflegen einer Freundschaft führt zu einer wichtigen Erfahrung und Art von Liebe, die das spätere Leben aufwertet.«
So gibt es durchaus Romane, deren Helden mehrere Geschichten erleben, und jede hat ihre eigene Prämisse.
Dan Simmons etwa erzählt über seinen Roman » Drood « (ein komplexer Historiengrusler über Charles Dickens’ unvollendetes letztes Buch und über seinen Freund und Kollegen Wilkie Collins) Folgendes: Ein Freund von ihm habe ganz richtig erkannt, dass er da eigentlich sieben Romane geschrieben habe. Eben weil der Hauptplot über so viele verschiedene Ebenen verfügt.
Und dann sind da noch die angerissenen Erzählstränge oder Ebenen, die der Autor bewusst nicht ausgearbeitet hat, um dem Werk am Ende etwas Offenes, Authentisches, Lebensnäheres zu verleihen. Diese Stränge und Ebenen verweigern sich absichtlich dem Beweisen der Prämisse.
So weit, so kompliziert. Zurück zu der letzten Frage der Leserin: Woher weiß man nun, welche Prämisse die Richtige ist?
Hier gibt es kein Richtig oder Falsch. Vielmehr kommt es darauf an, was für einen Roman man schreiben will. Je nach Prämisse kann dasselbe Thema zum Krimi, zur Horrorgeschichte oder zur Komödie werden.
Beispiel:
Thema: Mädchen und Junge lieben sich.
Prämisse von Roman 1: »Wahre Liebe führt zur Verwandlung des Jungen in einen Vampir.«
Genre von Roman 1: Horror-Romanze.
Prämisse von Roman 2: »Wahre Liebe führt zur gemeinsamen Aufklärung eines schrecklichen Verbrechens.«
Genre von Roman 2: Krimi, Thriller.
Prämisse von Roman 3: »Wahre Liebe führt zur Überwindung von Religionsgrenzen und Fußpilz.«
Genre von Roman 3: Multikulti-Komödie.
Die Prämisse muss aber keineswegs am Anfang des Romanschreibens stehen. Wirkungsvoller ist es, mit einem Charakter zu beginnen, mit Was-wäre-wenn-Fragen, mit Plotschnipseln – und von dort aus, etwa dem Problem des Charakters, die Prämisse zu entwickeln. Um sie dann mit dem Roman zu beweisen. Oder, wie wir gesehen haben, die vielen Prämissen.
Womit wir bei der Prämisse des Romanautors wären:
»Einen Roman zu schreiben, führt zu verdammt viel Arbeit.«
Über Recherche
Die wundersamen Entdeckungen beim Bierdeckelsammeln
Sie stecken fest? An irgendeiner Stelle Ihres Romans geht es einfach nicht mehr weiter. Womöglich fehlen Ihnen – Banalitätsalarm! – einfach nur Inhalte, genauer: etwas, worüber Sie schreiben können, was jedoch außerhalb Ihres Wissens oder Ihrer Erfahrungen liegt.
Zeit, Ihren Horizont zu erweitern.
Blättern Sie in einem Lexikon oder Wörterbuch oder im Web. Fündig geworden?
Stecken Sie bei einem ganz speziellen Thema fest, dann finden Sie Leute, die sich damit auskennen. So könnte eine Krimiautorin – Banalitätsalarm die Zweite! – bei der Polizei nachfragen. Falls Ihr Schurke Bierdeckel sammelt, gehen Sie zu einer Bierdeckelmesse.
Oft, nein, so gut wie immer finden Sie bei gezielter Recherche neben den gesuchten Informationen auch reichlich Beiwerk: Anekdoten (»Das rote da, auf diesem Bierdeckel, da hatte der Reich-Ranicki Nasenbluten, weil ihm Günter Grass …«), neuen Einblicken (»Die Bierdeckelindustrie lässt heute in nordkoreanischen Sweatshops fertigen. Ich trinke Bier nur noch im Stehen.«) oder Verweisen zu anderen Themen, an die man nie gedacht hätte (»Über die Filzindustrie, ja, wegen Bierfilz, da müssten Sie mal schreiben. Ich meine, Filz! Das sind Tierhaare. Die armen Biester werden gequält, weil wir saufen wollen. Und die Regierung spielt mit. Wenn da mal einer richtig graben würde …«)
Nicht selten ist das Beiwerk interessanter als das Gesuchte und findet Eingang in den Roman. Oder führt ihn womöglich in eine neue Richtung.
Im Extremfall haben Sie am Ende Ihrer Recherche die Idee für einen ganz neuen Roman gefunden und zugleich schon seine Grundlagen da stehen: » Die verfilzte Republik «, ein Politthriller.
Situationen im Roman darstellen oder durchspielen
Warum Sie Ihren Mann als Leiche im Wohnzimmer drapieren sollten
Da steht die Heldin Ihres Romans endlich, frisch aus den Zeilen gepellt, klug, schön, mit einem eisernen Willen und glorreichen Zielen ausgestattet und so vollgepackt mit inneren Konflikten, dass sie kaum noch denken kann.
Na, dann kann der Roman ja mal losgehen. Bestimmt wird der gut, ein Bestseller, mindestens.
Aber da fehlt doch was.
Sie meinen, andere Personen? Ebenso klug und mit Zielen und inneren Konflikten beladen wie ein Sherpa mit Bergausrüstung und frischer Yakbutter? Kein Problem.
Da fehlt noch immer was.
Oh, klar, die Leute im Roman müssen was tun. Kein Problem, ein Plot ist schnell ausgedacht, windschnittig wie ein mit Vaseline eingeschmierter Ferrari. Was denn, noch immer nicht genug? Verraten Sie es mir jetzt endlich, Sie Klugscheibenkleisterer?
Ruhig bleiben. Hier kommt’s:
Die Charaktere müssen nicht nur »was« tun. Sie müssen miteinander und noch besser gegeneinander agieren. Charaktere sind erst dann vollständig entwickelt, wenn Sie Beziehungen zu anderen eingehen.
Menschen allein mögen ganz interessant sein. Aber Geschichten ergeben sich fast immer erst, wenn mehrere Menschen in Beziehung treten. Erst dann ergeben sich Konflikte .
Selbst der innere Konflikt eines Charakters ist ein Beziehungskonflikt: Ein Teil von ihm will die Welt retten, der andere lieber daheimbleiben und mit seinem Sohn die neue Wii-Konsole ausprobieren.
Und wenn die Welt sich den Zielen widersetzt, mit Erdbeben, Feuersbrünsten und einer verbrannten Pizza? Auch die Welt, die Umstände, das Schicksal sind letztlich nichts anderes als besondere Charaktere.
Sie brauchen einen Beweis, dass Beziehungen interessanter sind als ein einzelner Charakter? Fragen wir mal die drei alten Frauen, die dort drüben neben dem Brunnen auf der Bank sitzen und schwätzen. Ob sie wohl über den Charakter eines Nachbarn diskutieren? Oder doch eher über die Affäre des Nachbarn mit der Dorfpolizistin?
Die interessantesten Charaktere kämpfen mit ihren inneren Dämonen. Auch das ist, siehe oben, ein Beziehungskonflikt. Ein Kampf ist im Grunde eine Form einer Beziehung. Und wenn innere Dämonen keine eigenständigen Charaktere sind, was dann?
Wir gehen noch ein Stück weiter, weg von Zweipersonenstücken. Die haben’s leicht: eine Beziehung, und das war’s.
Kaum aber setzten Sie in Ihrem kleinen Terrarium Roman drei Charaktere aus, haben Sie es schon mit vier Beziehungen zu tun – und mit noch mehr potenziellen Konflikten.
Beispiel:
Ihre Figuren heißen Albert, Barbara, Christine. Da hätten Sie die Beziehung zwischen Albert und Barbara, die zwischen Albert und Christine, die zwischen Barbara und Christine und die zwischen Albert, Barbara und Christine, wenn mal alle drei zusammen sind.
Also vier mögliche Konflikte!
Nein. Sogar mehr: Was, wenn sich Albert und Barbara gegen Christine verschwören? Sich Christine und Barbara zusammentun, um Albert eins auszuwischen? Oder Albert und Christine die widerliche Barbara ein für alle Mal aus ihrem Leben und dem Terrarium verbannt sehen möchten?
Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben drei Hauptfiguren, zehn Nebenfiguren und dreißig weitere Personen in Ihrem Roman. Nicht mal besonders viele. Aber wie viele mögliche Beziehungen ergeben sich da, und wie viele potenzielle Konflikte!
Читать дальше