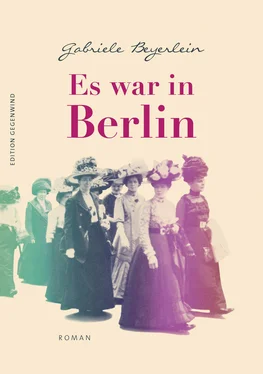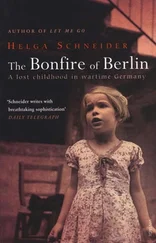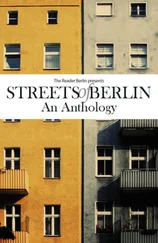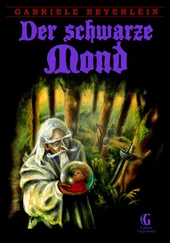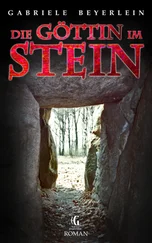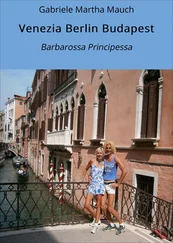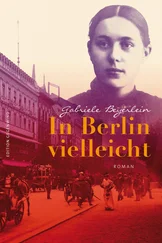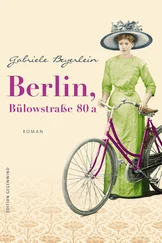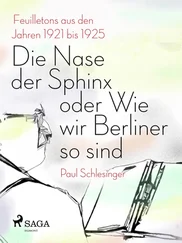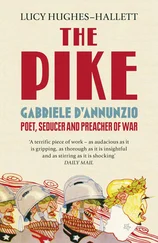»… die Luft umher ist wie gewitterschwül,
denn ach, die gnäd' ge Frau hat heut – Migräne!«,
schloss Johann Nietnagel. Eine Männerstimme im Publikum lachte laut auf, war das nicht Papa? Jedenfalls applaudierte er mit unverkennbarem Vergnügen, er, dem diese literarischen Abende in aller Regel eine lästige gesellschaftliche Pflicht waren. Auch das eine oder andere weitere Lachen war vernehmlich, vereinzeltes Klatschen. Universitätsprofessor Unschlicht strahlte über das ganze Gesicht. Doch die versteinerten Mienen und die Hände, die unbewegt im Schoß liegen blieben, überwogen. Und das Schweigen, das von diesen Mienen und Händen ausging, verbreitete sich rasch und erstickte auch die anfänglichen Äußerungen des Gefallens.
»Was bildet dieser Mensch sich ein!«, zischte eine empörte Frauenstimme.
»Unerhört«, sagte Hauptmann von Klaasen laut. »Der reine Klassenhass!«
Die Mutter erhob sich. »Meine Damen, meine Herren. Meine Tochter möchte gern ein Klavierstück zu Gehör bringen, war es nicht die Appassionata, Margarethe?«
Wie? Margarethe zuckte zusammen. Hatte sie recht gehört? War sie soeben von ihrer Mutter als Pianistin angekündigt worden?
Zwar hatte sie die Beethoven-Sonate in den vergangenen Monaten so intensiv studiert, dass sie in der Lage sein sollte, sie vor Publikum zum Besten zu geben, aber das war nicht abgesprochen, sie hatte ein Glas Champagner und etwas Wein getrunken, was sie vor dem Klavierspielen niemals tat, und der erste und dritte Satz stellten hohe Anforderungen an ihr technisches Können und erforderten allerhöchste Konzentration.
Ein beschwörender Blick der Mutter traf sie. Maman hatte ein untrügliches Gespür dafür, wann gesellschaftliche Situationen zu kippen drohten. Und ebenso untrüglich wusste sie in jeder Situation, wie sie zu retten war. Nun also war Margarethes Part gefragt.
Gehorsam erhob sich Margarethe, neigte leicht den Kopf auf den freundlichen Beifall hin, der ihr galt und nicht dem Dichter dort vorn. Noch immer stand er hinter dem Rednerpult und musterte das Publikum mit Augen, als wolle er gleichsam eine innere Fotografie anfertigen.
»Migräne ist eine furchtbare Krankheit, ein Leiden, das sich keiner vorstellen kann, der es nicht erlebt hat!«, verkündete Frau Universitätsprofessor Unschlicht mit schriller Stimme, »und dieser Mensch, dieser Mensch! Herr Doktor, sagen Sie doch etwas dazu!«
Der Hausarzt Dr. Schneider lächelte leise. »Gewiss, Frau Universitätsprofessor, gewiss kann Migräne ein furchtbares Leiden darstellen. Eine schwerwiegende und äußerst quälende Erkrankung, ohne Zweifel. Nur – wir wollen doch nicht leugnen, dass die Ausrede Migräne gelegentlich auch für anderes herhalten muss, für leichte Befindlichkeitsstörungen und seelische Verstimmungen, womöglich auch für die eine oder andere Unlust, nicht wahr?«
»Und das, meine ich, hat der Dichter ganz vorzüglich angedeutet mit seinem Verweis auf Eis und Himbeeren!«, schaltete sich Frau Doktor Schneider, eine geborene Baronesse von Zietowitz, lebhaft ein. »Wer jemals eine wirkliche Migräne hatte, weiß, dass da weder an Eis mit Himbeeren noch an sonst irgendetwas Essbares auch nur im Entferntesten zu denken ist.«
»Nehmen Sie diesen Menschen etwa auch noch in Schutz?«, empörte sich Frau Universitätsprofessor Unschlicht. »Eine Person, die so über unsere Kreise herzieht? Ich für mein Teil …«
»Meine Damen, meine Herren«, sagte Margarethe laut und verneigte sich noch einmal, »wenn Sie mir Ihr wohlwollendes Gehör schenken würden? Blätterst du mir um, Maman?«
Sie klappte den Deckel des Flügels auf, legte die Noten zurecht, sandte ein Stoßgebet gen Himmel und begann zu spielen. Der erste Satz mit seinem düster drohenden Bass und dem schicksalhaften Klopfmotiv forderte sie bis zum Äußersten. Dennoch bedachte sie bei ihrem Spiel auch noch, was für eine Figur sie dabei abgab. Nicht zu exaltierte Körperbewegungen, das wirkt bei einer Dame leicht deplatziert, pflegte die Mutter sie zu ermahnen.
Mit einigen Patzern, die sie gekonnt überspielte, kam sie heil durch das Stück. Sie atmete heimlich auf und widmete sich dem technisch einfacheren zweiten Satz mit mehr Empathie, vergaß endlich die Zuhörer, vergaß, auf ihr Äußeres zu achten, war nur noch bei dieser innig singenden Musik, spürte etwas in sich weit werden und sehnen und hoffen. Und diese Einheit mit der Musik blieb ihr auch bei dem dritten Satz erhalten, den sie in furiosem Tempo nahm. Bald neunzehn Jahre täglicher Etüden hatten ihre Finger geläufig gemacht, ihre Technik geschult, ließen sie auch dem verzweifelten Rasen der Sechzehntel, dem Presto der galoppierenden Achtel gewachsen sein. Wie einen Hafen erreichte sie aus dem ungestümen Lauf heraus die drei Schlussakkorde.
Stürmischer Applaus brachte sie in den Saal zurück. »Sie sind eine wahre Künstlerin der Tasten«, erklärte Hauptmann von Klaasen und neigte sich über ihre Hand. An seinem Arm wechselte sie in das angrenzende Speisezimmer hinüber, in dem ein Kuchenbuffet errichtet war. Johann Nietnagel stand im Erker ans Fensterbrett gelehnt und schob mit unübersehbarem Appetit ein Stück Apfelkuchen in sich hinein. Hatte er ihrem Klaviervortrag etwa gar nicht beigewohnt?!
»Dieser Dichter scheint zu befürchten, gleich des Hauses verwiesen zu werden, und will zuvor noch sein Honorar verspeisen«, flüsterte sie Hauptmann von Klaasen süffisant zu. Woher kam der feine Stich in ihrer Brust, den sie dabei verspürte? Als habe sie soeben Verrat begangen.
Der Hauptmann gab ihr lachend recht.
»Stellen Sie sich vor«, setzte sie noch eins obendrauf, »er ist von meiner Mutter dazu auserkoren, die Dialoge zu schreiben, mit denen wir beim Wohltätigkeitsfest Napoleon und Luise geben sollen.«
»Das ist nicht möglich?«, fragte er entsetzt. »Ihm fehlt mit Sicherheit der patriotische Ernst!«
Sie zuckte lächelnd die Achseln. »Meine Mutter hat nun einmal eine Schwäche für Randfiguren des Kulturbetriebes. Lassen Sie mich nur machen! Ich werde klarstellen, in welchem Sinn das Stück verfasst sein soll.«
Damit trennte sie sich von Hauptmann von Klaasen und schlenderte zu dem Dichter hinüber.
»Nun?«, fragte sie kühl und sah einige Zentimeter an ihm vorbei zum Fenster hinaus in den beleuchteten Garten. »Hat meine Mutter Sie von dem Auftrag schon in Kenntnis gesetzt, ein Stück über Napoleon und Königin Luise zu schreiben?«
»Sie ist heute vor meinem Vortrag mit dem Vorschlag auf mich zugekommen«, erwiderte er und stellte den Teller beiseite. »Wer weiß, ob sie es danach noch getan hätte! Aber ich musste Ihrer Frau Mutter ohnehin mit meinem aufrichtigen Bedauern – sie ist eine bewunderungswürdige Ausnahmeerscheinung in dieser Gesellschaft, wenn ich mir das zu bemerken erlauben darf –, ich musste ihr leider abschlägigen Bescheid geben. Ich fertige keine Auftragsarbeit.«
Sie sog hart die Luft ein, starrte ihn an. Dann wurde ihr bewusst, wie undamenhaft ihr Verhalten war. Dennoch senkte sie den Blick nicht.
Johann Nietnagel strich sich mit heftiger Geste die Haare aus der Stirn. »Zudem entspricht der Stoff ganz und gar nicht meinem Interesse. Ich bin an der Gegenwart interessiert, nicht an der Vergangenheit. Ein unbestechlicher Chronist unserer Zeit will ich sein, einfangen, was ist, ihm eine der Wirklichkeit, der Natur möglichst nahe Form geben. Die Wahrheit schreiben. Und so auch den Stummen meine Stimme leihen. Verstehen Sie?«
Wider Willen nickte sie. Da hatte ihre Mutter geglaubt, ein gutes Werk zu tun, wenn sie diesem Dichter einen bezahlten Auftrag gab, und nun wies dieser ihn einfach zurück. Und sie selbst, sie hatte gemeint, ihm vorschreiben zu können, in welchem Sinne er das Ganze verfassen sollte! Wie lächerlich sie sich damit gemacht hätte, wenn sie es ausgesprochen hätte! Diese Unabhängigkeit …
Читать дальше