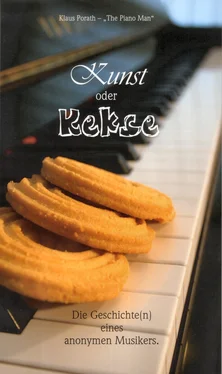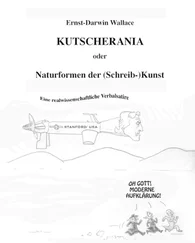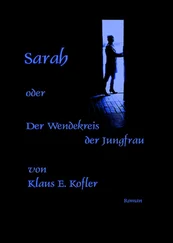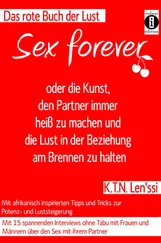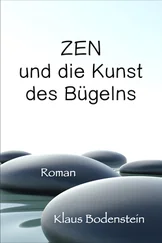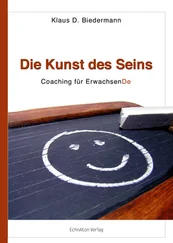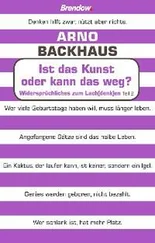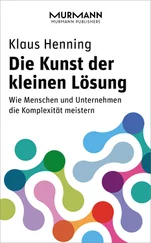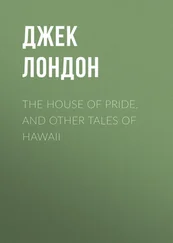Manchmal frage ich mich, wie sich elterliche Anerkennung anfühlen mag. Als Ausgleich beklatschen jede Woche wildfremde Menschen das, was ich tue. Wer erfährt so viel Anerkennung in seinem Beruf wie ich? Wie könnte ich mich da beklagen? Ich möchte sogar so weit gehen, dass das Unverständnis und die Ablehnung meiner Eltern für mich geradezu perfekt waren, um die für meinen Beruf unbedingt benötigten breiten Schultern zu bekommen. Es ist hart, aber wahr: Wer meine Musik nicht mag, hat auch keinen Respekt vor mir als Mensch. Das liegt leider in der Natur der Sache. Aber ich habe keinerlei Angst davor und weiß mich dank der guten Schulung durch meinen Vater immer zu wehren. Er hat mich quasi als psychischer Sparrings-Partner in jahrelanger Übung hart gemacht. Heute gelingt es niemandem, die gute Stimmung auf einem meiner Konzerte zu sabotieren oder seine schlechte Laune an mir auszulassen. Danke, Papi!
1981: Sebastian, die Buddes und die Beatles.
Den ersten richtigen Kontakt mit der Musik, die mich am meisten begeistern sollte, und der ich mich bis heute verschrieben habe, verdanke ich Sebastian Budde. Der strich im Schulorchester brav den Kontrabass, aber sein Herz schlug – wie bald auch meines – für die Popmusik. Auf diesem Gebiet hatte er einiges ausgetestet: er hatte ein bisschen Klavierspielen gelernt und bearbeitete ab und an das Schlagzeug seines großen Bruders Andi. Doch sein musikalischen Lebensinhalt fand er mit zehn Jahren in der Gitarre! Nicht im Akkordeschrammeln zu „Blowing In The Wind“ am Lagerfeuer, sondern in der (O-Ton Sebastian) „spärlich eingesetzten Lead-Gitarre“ .
Er war mit meiner großen Schwester in einer Klasse, und die ließ eines Tages ihm gegenüber den bereits erwähnten Satz fallen: „Mein Bruder klappt die Noten zu und spielt einfach irgendetwas!“ Das machte ihn hellhörig, denn für Popmusik braucht man genausolche Leute. Und die sind unter den vielen Eleven der klassischen Musik rar gesät. Also sprach er mich eines Tages in der Schule mit den Worten „Hallo Klaus Porath!“ an, was mich sofort ärgerte. Ich fand das unpassend und unbeholfen. Was sollte dieses „Porath“ unter Kindern? Dass die Sippe, aus der man kam, in seinem Umfeld eine große Rolle spielte, sollte ich bald erfahren. In unserer Familie waren wir laut Aussage meines Vaters alle „freie Menschen“. Die Buddes dagegen verstanden sich als „Klan“, quasi eine Neuauflage der „Buddenbrooks“ – in Lübeck-Moisling. Für mich war das damals neu und faszinierend. Und heute bietet es mir genügend Angriffsfläche, ein paar spießige Auswüchse genüsslich durch den Kakao zu ziehen. Sorry! Ich habe zwar keine Fußballer-Beine, aber ein Fußballer-Herz: diese Vorlagen MUSS ich einfach verwandeln.
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, und so könnte ich mir alle weiteren Ausführungen sparen, wenn ich hier die Weihnachtspostkarte der Buddes von 1982 abdrucken würde. Auf der sitzt die Familie eng nebeneinander aufgereiht auf dem Sofa und lächelt versonnen in die Kamera. Der brave Sebastian hält dabei in kerzengerader Haltung mit der linken Hand sein linkes und mit der rechten Hand sein rechtes Knie fest. Nur sein großer Bruder Andi, der Rebell mit dem Schlagzeug, passt nicht mehr auf die Sitzfläche. Er liegt deshalb, grinsend dem Idyll entronnen, wie ein Pascha breitbeinig davor auf dem Flokati. Dieses Bild hätte Loriot nicht schöner inszenieren können. Aber ich empfand es auch als ungemein herzlich, denn Frau Budde hatte es mir nach Amerika geschickt, wo ich ein Austauschjahr verbrachte, und auf der Rückseite notiert: „Damit Du uns noch erkennst, wenn Du wieder da bist.“
Trotz unserer spröde angelaufenen Kontaktaufnahme waren Sebastian und ich neugierig aufeinander und wollten uns einmal musikalisch beschnuppern. Aufgrund von Sebastians vielen musikalischen und außermusikalischen Aktivitäten, wie etwa seiner Mitgliedschaft in der Ruderriege unserer Schule, fanden wir dafür aber keinen Termin. Da ich gut zwei Jahre jünger war als er, erhoffte er sich von einem Austausch vermutlich weniger als ich und begann langsam das Vorhaben als undurchführbar abzuschreiben. Wie bereits erläutert, habe ich den Dickschädel meines Vaters geerbt und verliere Wichtiges nicht so schnell aus den Augen. Die erste von mir zu überwindende Hürde bestand darin, überhaupt an Sebastian heranzukommen. Für heutige Verhältnisse unvorstellbar, teilten sich die Familie Budde und sein Vater, der Zahnarzt Dr. Budde in der Praxis nebenan, ein- und dieselbe Telefonnummer. Und so handelte ich mir, egal zu welcher Tageszeit ich es auch versuchte, bei jedem meiner Anrufe von Mutter Budde eine Rüge ein. Und Sebastian wurde aus pädagogischen Gründen nicht ans Telefon gelassen. Ich habe damals ALLES probiert:
08.00 – 09.00 Uhr: Störung des Frühstücks von Familie Budde.
09.00 – 12.00 Uhr: Störung des Praxisbetriebes von Herrn Dr. Budde.
12.00 – 13.00 Uhr: Störung des Mittagessen von Familie Budde.
13.00 – 15.00 Uhr: Störung der Mittagsruhe von Familie Budde.
15.00 – 18.30 Uhr: Störung des Praxisbetriebes von Herrn Dr. Budde.
18.30 – 20.00 Uhr: Störung des Abendbrotes von Familie Budde.
20.00 – 22.00 Uhr: „Mein lieber Klaus! Ruft man denn so spät noch an?“
Erstaunlicherweise hegte ich trotzdem große Sympathien für den antiquierten, gutbürgerlichen Kokon, der alle Buddes zusammenhielt. Auch wenn der per Telefon nicht zu durchdringen war. Anders als in meiner Familie mischten sich hier die Eltern in die Freizeitgestaltung ihrer Kinder ein. Zumindest, wenn es darum ging, dass ein Budde zu seinem Wort steht. Oder war Sebastians Mutter einfach nur meinen „Telefonterror“ leid? Ich möchte mich bei ihr an dieser Stelle aufrichtig dafür bedanken, dass sie auf Sebastian einwirkte, der „dem Klaus ein Treffen versprochen hatte“ , das deswegen auch stattfinden müsse. Wer weiß, wie alles sonst gekommen wäre?
So konnte ich mich eines schönen Tages im Jahre 1981 nach langer Vorarbeit endlich auf mein Fahrrad schwingen und trudelte eine halbe Stunde später voller Erwartungen im Eigenheim der Buddes ein. In unserer Familie, wie vermutlich allen anderen im ausgehenden 20. Jahrhundert, hätte man als Fünfzehnjähriger den Eltern des Freundes an der Tür brav einen „guten Tag“ gewünscht und wäre dann direkt mit ihm zum wie auch immer gearteten Spielen übergegangen. Nicht so bei Familie Budde! Hier erzwang das Protokoll vorher noch ein gebührendes Beschnuppern bei einer gepflegten Tasse Tee und einem Stück Kuchen. Ich schlug mich dabei gut, krümelte wenig, sagte wenig und wurde als Arztsohn aus fremdem Hause akzeptiert. Anders, als Sebastians erste Frau hatte ich zum Glück keine Klassenunterschiede zu überwinden. Was das war, hätte ich damals als „freier Mensch“ auch noch gar nicht gewusst.
Der Hund der Buddes, Typ „Klosettbürste“, hieß aufgrund seines erstaunlich hohen Lauftempos frei nach Goethe „Emilia Galoppi“. In der Konversation bei Tisch spielte die gehobene Literatur eine wichtige Rolle. Vater Budde warf sich hier vor allem mit seinem Ältesten die Bälle zu. Bei diesem Spiel galt es, sich keine Blöße durch Nichtwissen zu geben. Dass so etwas außerhalb des Deutschunterrichts im Familienkreis stattfand, beeindruckte mich. Nur die Art und Weise des „Kenn’ ich! Hab’ ich! War ich schon!“ fand ich befremdlich. Was sollte das? Vater Porath war in unserer Familie auch ohne solche Spielchen als „King“ gesetzt. Vater Budde musste dagegen anscheinend ständig beweisen, dass er allen überlegen war. Mag sein, dass das daran lag, dass seine beiden Stammhalter ihn um mehr als einen Kopf überragten. Dietrich Schwanitz, der leider inzwischen verstorbene Autor von „Bildung. Alles, was man wissen muss“, wäre bei diesem Spiel stolz auf mich gewesen. Ich verhielt mich intuitiv wie ein gestandener Akademiker: Ich schaltete mich wenig ein und blamierte mich so nicht durch Unwissen.
Читать дальше