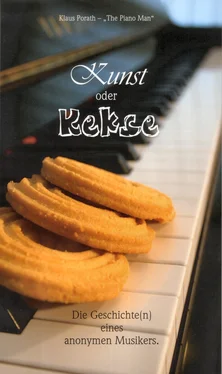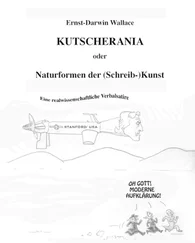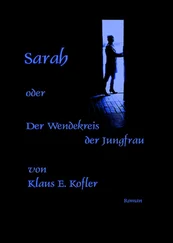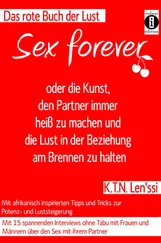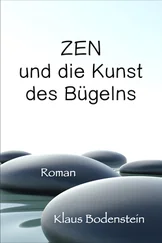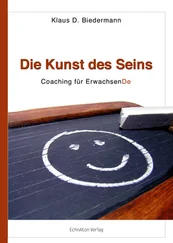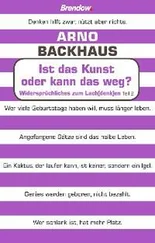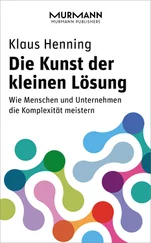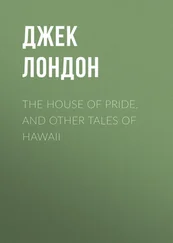Den schwebenden Klang des Akkordeons mochte ich. Und die Shantys spielte ich gerne, weil sie „schmissig“ waren. Ein Seemannslied gefiel mir vor allem wegen seines Textes. Der gab mir eine Vorahnung davon, dass es – in meinem späteren Leben – für mich doch Vorteile hatte, ausgewählte Exemplare der besseren Hälfte der Menschheit mit Musik umgarnen zu können:
„Hein spielt abends so schön auf dem Schifferklavier,
auf dem Schifferklavier seine Lieder.
Hein spielt sich in die Herzen der Mädels hinein,
und sie bitten den Hein immer wieder.
Jede denkt für sich, heut‘ spielt er für mich!
Jede ist so froh, jede liebt ihn so...“
Das klang verheißungsvoll! Aber wenn die Seefahrer-Lyrik im Zwischenmenschlichen allzu explizit wurde, verstand ich nur noch Bahnhof. „Schön sind die Mädels im Hafen. Treu sind sie nicht, aber neu“ , ergab für mich als Zehnjährigen keinerlei Sinn und wurde mir auch nicht erklärt.
Der Mensch, der mir die Bedienung des Blasebalges und der Knöpfe mit der linken Hand beibrachte, hieß Gerhard Kerskes und war „staatlich geprüfter Akkordeonlehrer“. Was das war, wusste ich nicht, aber es verpasste ihm eine seriöse Aura. Herr Kerskes hatte im zweiten Weltkrieg als Funker an der Ostfront im russischen Frost fast seine Ohren verloren. Seine Ausführungen über den Besuch einer billigen Tanzrevue gleich nach dem Krieg, als man nach jahrelanger Gefangenschaft „auch mal wieder eine Frau sehen musste“ , konnte ich nicht nachvollziehen.
Er war so entsetzt über die mangelnde Allgemeinbildung seiner Akkordeonschüler, dass er uns alle gemeinsam einmal im Monat einberief und kostenlos neben allgemeiner Musiktheorie auch noch die großen deutschen Flüsse und Ähnliches mit uns paukte. Meine Eltern fanden so viel Engagement löblich, nannten diese Stunde aber leicht spöttisch „Akko-T.“ – „Akkordeon theoretisch“. Wer bei den Nebenflüssen der Donau versagte oder sich im Gruppenunterricht verspielte, wurde von Herrn Kerskes liebevoll mit: „Du Weihnachtsmann!“ gerügt. Mich traf das oft, aber ich hatte an dieser Pädagogik alter Schule nichts auszusetzen.
Sein Unterricht fand in einem winzigen Hinterhof-Kabuff in der Breiten Straße statt, das nur über ein Labyrinth aus dunklen, muffigen, mit Linoleum ausgelegten Gängen zu erreichen war. Ein Wunder, dass ich damals dort nie verloren ging. Er gab auch Unterricht an der Hammondorgel. Wenn keine Schüler da waren, nahm er mit zwei Tonbandgeräten düstere Klangkollagen auf, die wie gewaltige Eruptionen auf fernen Planeten klangen. Dafür war er nicht „staatlich geprüft“. Sein Unterricht begann irgendwann immer häufiger auszufallen, weil er Probleme mit dem Herzen hatte. Als letztes kam dann eine Postkarte seiner Frau mit der traurigen Mitteilung, er sei verstorben. Anders als Frau Kieckbusch würde ihm heute bestimmt gefallen, was ich mache.
Ich hatte viel bei ihm gelernt. Aber mein Instrument war und blieb das Klavier. Das Akkordeon war für mich ein guter Klavierersatz, im wahrsten Sinne ein Schifferklavier. Während unserer fünfwöchigen Segeltouren im Sommer war ich froh, Tasten „in abgespeckter Form“ griffbereit zu haben. Wieder zu Hause angekommen, ging mein erster Weg immer sofort ans Klavier. Nach der langen Abstinenz hörte es sich jedes Mal wieder ganz neu und großartig an.
1979: Otto Waalkes, der „Rächer der Enterbten“.
„ Wir arbeiten, um zu segeln“ war das Lebensmotto meines Vaters. Segeln ist gelebte Freizeit, und zur Freizeit gehört Musik! Ich sehe das Bild immer noch vor mir, wie meine Eltern, jeder mit einem Glas Sherry bewaffnet, einer links, einer rechts, draußen im Cockpit sitzen und im Sonnenuntergang in Dvoraks Cellokonzert oder Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 1 schwelgen. Ich hörte dann drinnen, ohne Drink, auch immer ganz genau zu. So habe ich die romantische Klassik kennen und schätzen gelernt. Sie hat mich damals tief berührt, auch wenn ich selber kein klassischer Musiker werden sollte.
Bei uns an Bord gab es aber manchmal auch ganz andere Töne, die meinen heutigen ähnlich waren. Das Boot rechts neben uns am Steg vier in unserem Heimathafen Kiel-Schilksee gehörte einem strammen Sportlehrer, der von allen nur „Nurmi“, nach dem legendären finnischen Langstreckenläufer, genannt wurde. Solange er mit seinem Oberstudienratsgehalt mithalten konnte, segelten meine Eltern und er denselben Bootstyp. Als unser Boot dann größer war als seines, beneideten meine Eltern ihn trotzdem für seine sechs Wochen Sommerferien. Sie selber trauten sich nur, ihre Praxis für vier Wochen am Stück zu schließen. Mit zwei Schiffen gingen wir oft gemeinsam auf Tour nach Skandinavien.
Nach dem Krieg hatte „Onkel Nurmi“, wie wir Kinder ihn nannten, als kleiner Junge einmal mit einem Blindgänger gespielt. Deswegen hatte er ein Glasauge und ging mit deutlich weniger als zehn ganzen Fingern durchs Leben. Das und die Tatsache, dass er nie Musikunterricht genossen hatte, hielt ihn aber keineswegs davon ab, abwechselnd zum Akkordeon und zur Gitarre zu greifen! Wenn wir im Urlaub irgendwo vor Anker lagen, unterhielt er uns alle abends mit lustigen und frivolen Liedern. Seine beiden Favoriten waren „Ein Hering und eine Makrele“ („...die waren ein Herz, als auch Seele“) und „Es wird Nacht, Señorita“ („...und ich hab kein Quartier, nimm’ mich mit in Dein Häuschen, ich will gar nichts von Dir“) .
Allen war klar, dass ich musikalisch besser war als er. Aber ihm gehörte eindeutig „die Show“! Als ich 1995 dem „Bund freischaffender Pianisten“ beitrat, feierte man dort gerade die „bahnbrechende Entdeckung“, dass der Erfolg eines Unterhaltungspianisten nur zu 40 Prozent von seinem Können „an der Taste“ abhängt, aber zu 60 Prozent von seiner „Personality“. Ich war noch nicht einmal in der Pubertät. Wie sollte ich außermusikalisch gegen einen entfesselten Oberstudienrat gegenanstinken? Wenn „Onkel Nurmi“ eine Pause machte, ermutigte er mich oft, auch ein Lied beizusteuern. Das tat ich, aber meistens fingen alle zu früh an mitzusingen! Ich hielt mich streng an die Noten. Wofür fuhr ich denn sonst jede Woche zum Unterricht von Herrn Kerskes? Meine Beschwerde an die fröhliche Runde „Ich bin erst beim Vorspiel!“ sorgte bei den Erwachsenen aus mir unerfindlichen Gründen stets für große Heiterkeit.
Bei einem Segeltörn hatte „Onkel Nurmis“ Tochter eine Freundin mitgenommen. Die beiden Mädels sangen zweistimmig zur Gitarre, vielleicht etwas von den Beatles. Ich war nicht nur von den beiden zarten Geschöpfen, sondern auch vom Klang ihrer ineinander verschmelzenden Stimmen berührt. Es war meine erste Begegnung mit mehrstimmigem Gesang, der uns auch später in der Band wichtig sein sollte. Ich übte fortan zu Liedern aus dem Radio eine zweite Stimme zu singen, was mein Vater mit „Du singst immer irgendwie knapp daneben“ kommentierte. Vielleicht war er doch nicht so latent musikalisch, wie ich vermutete?
Nicht nur „Onkel Nurmi“, der grandiose Hobby-Showman, begeisterte meine Eltern durch seine lockere Art. Viel öfter als klassische Musik spielte unser Radiorekorder an Bord Kassetten mit überspielten Otto Waalkes-LPs ab. Das „kleine Ottili“ war in unserer oft verkrampften Familie ein wahrer Held! Der war so blöde, dass er schon wieder gut war. Das war meine Chance! Den von mir ungeliebten Spitznamen „Otto“ trug ich dank ihm schließlich fast ein bisschen mit Stolz. Otto fiel aus dem Rahmen, und ich auch.
Nachdem mein Vater mich dankenswerterweise zum Singen, zu den Tasteninstrumenten und zum Vortrag von Musik fast gezwungen hatte und mich von „Rampensäuen“ wie Onkel Nurmi und dem „Ostfriesischen Götterboten“ hat prägen lassen, ist es eigentlich unerklärlich, dass er heute nicht mein allergrößter Fan ist. Im Gegenteil! Ob ich meinen konträren Lebensentwurf aus freien Stücken gewählt habe, ist eine philosophische Frage. Hat der Mensch einen freien Willen? Trotz aller in schöner Regelmäßigkeit auftauchenden finanziellen Engpässen bin ich „stolz“ darauf, mit meiner Musik meine sechsköpfige Familie über die Runden zu bringen.
Читать дальше