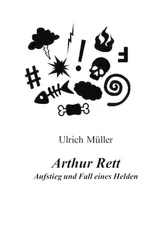„Sein Ruf“, erläuterte Marjan, „ist ein ansteigendes tlüh.“ Und er spitzte den Mund und brachte ein absolut glaubwürdiges tlüh heraus.
„Bei Gefahr“, so Marjan, „liegt die Betonung übrigens auf der Endsilbe, er macht dann so etwas wie ein plüüé.“
Und wenn Marjan nun dieses plüüé intonierte, konnte man sich gut vorstellen, wie groß die Gefahr für den Goldregenpfeifer in dem Falle sein musste. Doch war dies noch nicht alles.
„Markiert der Goldregenpfeifer sein Revier“, schloss Marjan seine ornithologischen Erklärungen, „ertönt ein warnendes fla-hüüi.“
Und spätestens da war jedem Zuhörer klar, dass bei einem fla-hüüi schnell das Feld räumen war, denn was Reviermarkierungen anbetraf, verstand der Vogel keinen Spaß.
Marjan Bárbar also bekam seinen Traumjob und Tschusch durfte endlich das leidige Spielfeld verlassen. Das war 1983 und wen wunderte es, dass dies das Jahr der Uferschwalbe war.
Der Besuch der Grundschule im Münchner Stadtteil Allach erwies sich für Tschusch als durchschlagender Erfolg. Sein elefantöses Gedächtnis, ein dankenswertes Erbe seines Vaters, verwechselten die Lehrer alsbald mit außerordentlicher Intelligenz und rieten den verdutzten Eltern, den Sohn auf das Gymnasium zu schicken. Nun war es zu jener Zeit keineswegs Usus, dass ein Gastarbeiterkind eine höhere Schule besuchte und einer, der Tschusch hieß, gleich dreimal nicht. Den Ehrgeiz, einem Jugo die Bildungsweihen der Oberschicht zukommen zu lassen, entwickelten auch mehr die Lehrkräfte, denn Tschuschs Familie. Marjan war eigentlich davon ausgegangen, dass sein Sohn dereinst Vogelzähler werden würde, so wie er, hatte der Knabe die Vöglein doch auch so lieb und als Vogelzähler brauchte man kein Abitur. Doch einmal mehr hatte Tschusch andere Pläne.
Seit er denken konnte, wollte er Privatdetektiv werden. Für den Beruf des Schnüfflers, wie manch übel gesonnene Zeitgenossen die hehre Kunst des Spannens gegen Geld verunglimpften, zeichnete ihn sein ganzheitliches Wesen aus. Er hatte Neigungen, die zwangsweise zu diesem Beruf führen mussten. Schon immer interessierte sich Tschusch für das Leben anderer und gerne ging er wildfremden Leuten nach. Bereits als Jugendlicher verbrachte er Stunden damit, sich einen von der Straße herauszupicken und zu beobachten, was der so tat.
Außerdem ging er gern zu Fuß. Ganz gleich, wie das Wetter war: Tschusch spazierte durch die Stadt. Hatte er Probleme (und die hatte er ständig), lief er die Straßen entlang und dachte nach. Was er dabei dachte, ordnete er einem eigenen Denkkapitel unter das er als Geh - danken titulierte. Und seitdem er bei Friedrich Nietzsche nachgelesen hatte, dass man im Sitzen nicht denken könne, nur gehend, fühlte er sich in seinem inneren Gangwerk umso mehr bestätigt. Bei jeder Art von Schieflage (und in solche geriet er ständig) ging er sich ins Lot zurück. Dabei konnte er kilometerweise wandern, bis seine Füße hart wie der Beton der Pflasterung unter ihm wurden. Aus dem Grund kannte er sich in München aus wie kein Zweiter, hatte er doch jede Straße schon einmal bestiefelt. Tschusch erging sich sein Leben, auch wenn er dabei bisweilen von einem Missgeschick ins andere fiel. Doch fiel er stets nach vorne. Wer viel geht, so seine Devise, sieht auch viel und wer viel sieht, der weiß, was in seiner Stadt vor sich geht, unabdingbar für einen guten Detektiv.
Während seines Mäanderns durch die Stadt inspizierte er auch die Gangart anderer Menschen, prägte sich die verschiedenen Bewegungsabläufe der Passanten ein, sodass er deren Charakter am Ende allein aufgrund ihrer Gangart dechiffrieren konnte.
„Man glaubt gar nicht“, so eine seiner Weisheiten, „was man alles über einen Menschen erfährt, wenn man ihm eine Zeit lang hinterhergeht.“
Und da war ja noch das sensationelle Gedächtnis. Nie vergaß Tschusch ein Gesicht, nie vergaß er, was die von ihm ausspionierten Leute an dem einen oder anderen Tag gemacht hatten, und wenn es Jahre her waren. Im Lauf der Zeit wuchs sein Gehirn folglich zu einer famosen Datenbank von Ehebrechern, Ausreißern, Blaumachern, Versicherungsbetrügern und Zahlungssäumigen an.
Folgerichtig bewarb er sich nach dem Abitur bei einer renommierten Münchner Detektei und wurde nach der Probephase sofort in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen, war doch seine Aufklärungsquote damals noch phänomenal. Dann beging er einen ersten großen Fehler: er machte sich mit einem eigenen kleinen Büro selbständig und damit fingen die Probleme an. Das war 2001 gewesen, dem Jahr des Haubentauchers.
„Bárbar“, sagte Tschusch, „Bárbar mit accent grave auf dem ersten A.“
„Gut, Herr Barbár“, sagte die Frau mit accent grave auf dem zweiten. „Mit Ihrem Tarif bin ich einverstanden. Wann können Sie loslegen?“
„Haben Sie ein Foto Ihres Mannes“, fragte Tschusch. „Auch ein Name wäre von Vorteil.“
Die Frau, die in seinem Büro saß, hatte sich bisher nicht vorgestellt, nur erzählt, dass sie ihren Mann des Ehebruchs verdächtige und deshalb seine Dienste benötige. Sie wolle jetzt endlich die Wahrheit wissen.
Alle wollen immer die Wahrheit wissen, dachte Tschusch, dabei war die Lüge doch so gnädig. Wie sie denn auf die Idee gekommen wäre, hatte er sich erkundigt, die übliche Frage, wenn Frauen zu ihm kamen und ihre Gatten des Fremdgehens bezichtigten, denn manchmal löste sich der Verdacht in Luft auf, hakte man näher nach. Seit Neustem bliebe er abends immer länger im Büro, hatte sie berichtet, dann würde er öfter größere Summen vom gemeinsamen Konto abheben und überhaupt spüre man so etwas als Frau. Riechen würde er nämlich, und zwar anders, wenn er dann endlich nach Hause käme. Nicht nach Büro, wenn der Herr Barbár verstehe, was sie meine.
Es war eine hübsche Frau. Tschusch mochte, wie sie auf dem Stuhl Platz genommen hatte. Vorsichtig, als hätte sie sich noch nie richtig hingesetzt, als hätte sie diese Alltagsbewegung nur choreografiert. Doch mit unnachahmlicher Anmut. Wie kann man so eine Frau nur betrügen, dachte er.
„Mein Mann ...“ Sie zögerte. „Mein Mann, nun, er ist nicht ganz unbekannt. Außerdem bekleidet er ein hohes Amt bei Gericht.“
„Auch Richter begehen Untaten“, sagte Tschusch. „Ich habe sogar von einem gehört, der seine eigenen Kinder ermordet hat.“
„Er ist kein Richter, Herr Barbár. Er ist Oberstaatsanwalt. Manchmal ist er sogar im Fernsehen. Deshalb ist die Angelegenheit ja so delikat“
Tschusch wurde hellhörig. Sein bester Freund Edmund Schröder, ein alter Klassenkamerad, war ebenfalls Oberstaatsanwalt. Und ebenfalls bekannt durch gelegentliche TV Auftritte, wo er stets den harten Hund gab. Die Frau nestelte in ihrer Handtasche, zog ein Foto heraus und legte es auf Tschuschs Schreibtisch. Es war Edmund.
„Dann sind Sie seine Frau?“
Eine zugegeben dumme Frage, doch hatte er die Frau seines Freundes nie gesehen. Er wusste, dass sich Edmund seiner schämte und ihn deshalb nie nach Hause einlud. Tschusch war ein mittlerweile ziemlich abgerissener Privatdetektiv und es gab Tage, da sah man ihm dies an.
Die Dame warf ihm einen verständnislosen Blick zu, sparte sich aber den Kommentar. Die Detektei war ihr von ihrer Freundin Sylvie empfohlen worden, deren Gatte Simon ein Doppelleben führte, eines mit ihr und eines mit einem Mann. Der Herr mit dem eigentümlichen Namen, der auch ein wenig so aussah, wie ein Barbár eben, hatte damals nicht nur die Homosexualität des Ehebrechers aufgedeckt, sondern auch, dass Simon und sein Verhältnis ein Kind adoptieren wollten, und das, obwohl er bereits mit Sylvie deren Drei gezeugt hatte.
Normalerweise wäre die Sache zu einem handfesten Skandal ausgeartet, denn Simon war ein zumindest in streng konservativen Kreisen angesehener Politiker, ein Rechtsausleger, der sich durch eine besonders scharfe Haltung gegenüber Minderheiten ausgezeichnete, ganz gleich, ob das nun Schwule oder Lesben, Asylsuchende oder Linksintellektuelle waren.
Читать дальше