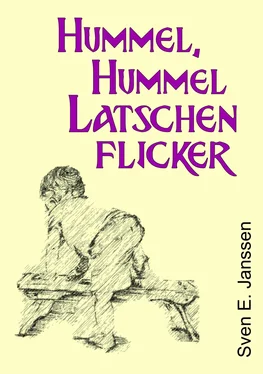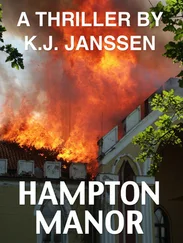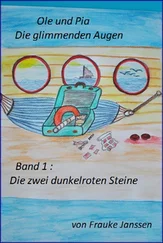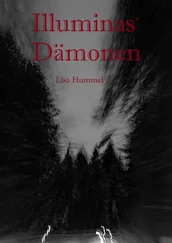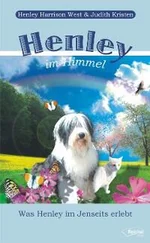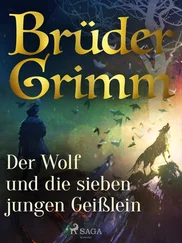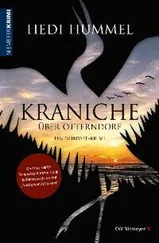Als Jan vielleicht knapp sechs Jahre alt war kaufte ihm Opa Gundermann einen knallblauen Polizei-Tretporsche, das schönste Spielzeug, das er, als Kind, jemals hatte. Dazu bekam er einen weißen Plastik-Helm und einen richtigen kleinen Gestapo-Mantel aus schwarz-braunem Vistram, über den Jan dann noch eine große Spielzeugpistole geschnallt trug. Zum Dank schmiss er seinem Großvater ein paar Tage später im Garten einen Stein an den Kopf, als dieser gerade dabei war, mit einem Holzrechen das Laub zusammenzuklauben. Opa Gundermann blutete wie verrückt und schaute seinen Enkel nur fassungslos an, wobei er immer bleicher wurde. Noch lange Zeit später konnte sich Jan Lübben genau daran erinnern, wie seine Eltern sich damals ernsthaft mit dem Gedanken trugen, ihn in die Kinder-Klapsmühle zu stecken. Freilich rächte sich das Schicksal auf dem Fuß, denn nur wenige Tage danach fuhr er mit seinem blauen Tretauto die steile Hoftreppe der Hindenburgstraße 267 hinunter, die den Vorgarten mit dem hinter dem Haus liegenden Obstgarten verband. Er wollte so, im Selbsttest, den weißen Polizei-Plastikhelm ausprobieren, das Experiment endete mit einem tiefen Loch im Hinterkopf. Manchmal ging Opa Gundermann auch mit seinem Enkel in den Ludwigspark, das war dann immer etwas Besonderes. Der Ludwigspark war ein am Stadtrand gelegener, wunderschöner dichtgrüner, bewaldeter Park, einst Privatgarten einer reichen Fabrikantenfamilie. Im ´Luddwich´, wie die Anlage von den Einheimischen nur genannt wurde, gab es, neben einem herrlichen Spielplatz, auch ein elegantes Kaffeehaus. Dort bestellten sich Opa Wilhelm und Jan stets Fanta und frischgebackene Salzbrezeln, denn im Kaffee Luddwich gab es die besten Brezeln der Welt. Meistens gönnten sie sich danach auch noch ein Stück Käsekuchen oder Sahnetorte.
Die Nachbarschaft in der Hindenburgstraße war strikt in Freund und Feind unterteilt. Rechts neben der Nummer 267 stand die Vorkriegsvilla der Bögerbergs, einer verarmten Ludwigshausner Großbürgerfamilie, die vor dem Kriege sogar ein Hausmädchen hatte. Die alte Frau Bögerberg, die noch alle, ob der alten glanzvollen Zeiten, die ‚Große Bögerberg´ nannten, war Oma Gerlis beste Freundin. Frau Bögerberg war ein ganz dürres, fragil wirkendes Persönchen mit blaugrauem kurzem Lockenkopf. Im Krieg waren ihr zwei Finger an der rechten Hand abgefroren. Dennoch strotzte die gescheite Frau nur so vor Energie. Manchmal musste Jan irgendwelches Zeugs zu den Bögerbergs rüberbringen, dann gab’s immer was für die Spardose, ein Bonbon oder wenigstens einen Keks. Besonders gern mochte er Willibert Bögerberg, den einzigen, schon erwachsenen Sohn der Familie; der machte immer Späße. Als Kind bekam Willibert beim Spielen einen Fußball ins Gesicht und zwar so doll, dass er am Schädel operiert werden musste und dadurch zum Frühinvaliden wurde. In dem Haus links neben der Nummer 267 wohnten die Wischnewkis. Die Wischnewkis waren Flüchtlinge, und so in den Nachkriegswirren aus Ostpreußen vor den Russen abgehauen, um dann irgendwann im Süden zu landen. Frau Wischnewki ging im Krankenhaus putzen, ihr Mann war Heizer bei den Amis. Die Wischnewkis hatten zwei Söhne, den älteren, Franz, den alle nur Bubi nannten, und den jüngeren, Peter. Die Wischnewkis waren einfache und ganz wahnsinnig nette Leute. Die Wischnewki-Söhne wurden zu Jan Lübbens Lieblingsspielkameraden in der Hindenburgstraße. Ein paar Häuser weiter, auf der anderen Straßenseite, wohnten die Kellermanns. Deren Sohn, Rudolf, war etwa so alt wie Jan Lübben und ein von allen Kindern gefürchteter Feind. Er war größer und stärker als alle anderen und konnte sagenhaft gut mit der Steinschleuder umgehen. Er war auch der erste, der ihm so richtig die Fresse blutig schlug. Noch weiter vorne in der Straße wohnten die Höfler-Buben, die eine eigene Fraktion bildeten, die mit keinem so richtig gutstand. Die Höfler-Buben waren gefürchtete Flitzbogenschützen. Sie hausten in einer düsteren, vierstöckigen, lindgrün gestrichenen Vorkriegsvilla, die auf einem Hügel stand. Von dort aus, im Gestrüpp versteckt, schossen sie auf alles, was sich bewegte. Vielleicht waren sie so zornig, weil es hieß, ihre Mutter sei Bordellvorsteherin in einem der zahlreichen Ami-Puffs, die sich rund um die Ludwigshausner US-Basis angesiedelt hatten. Alles in allem war es eine glückliche, sorgenfreie, rundweg schöne Kindheit, die Jan Lübben in der Hindenburgstraße verlebte.
Jan Lübbens Eltern wohnten damals in einer oberhalb der Hindenburgstraße gelegenen Parallel-Straße – ganz Ludwigshausen bestand aus einem Gewirr von Hügeln, ein jeder wie eine kleine Stadt für sich. Dort, in der Westendstraße, lebten sie Zaun an Zaun zu den Amis, einer riesigen US-Militär-Wohnsiedlung. Die Braddler (Dialektal/despektierlich: US-Amerikaner, bzw. GI) wie sie von den Ludwigshausnern nur genannt wurden, hatten einfach alles, ihre eigenen Supermärkte, Tankstellen, Kliniken, Spielplätze, Schulen, Hamburgerläden und Eisdielen. So waren denn auch ihre Nachbarn Militärangehörige, Jans bester Freund in Kindheitstagen John Meyers, der Sohn eines MP-Mannes aus Texas und einer Deutschen Krankenschwester. Wenn er nicht in der Hindenburgstraße war, hing er meistens in der Wohnung von Johns Eltern rum, dort spielten sie dann Superman und Batman oder mit den Matchbox-Autos, denn auch sein amerikanischer Freund war schon als Kind ein Autonarr. Manchmal gingen sie auch auf den Ami-Spielplatz, der gleich hinter der Wohnung anfing. Dann schaukelten sie auf Schaukeln aus grünem Marschgeschirrstoff. Am liebsten aber band sich John Meyers die riesige Knarre seines Vaters, inklusive Patronengurt, um. Die Kanone schliff auf dem Boden hinter ihm her, aber er war mächtig stolz und Jan Lübben mächtig neidisch. Damals wünschte er sich nichts mehr, als dass auch sein Vater MP-Mann wäre, insbesondere wegen der großartigen Pistole. Wenigstens hatte sein Vater, Wolfrath Lübben, ein Luftgewehr. Mit dem schoss er manchmal auf die Spatzen im hinter dem Haus gelegenen Garten, vom Fenster des Wintergartens aus. Im Handschuhfach seines orange-roten Renault 5 lag eine schwere Gaspistole, die so richtig doll echt aussah. Jan Lübben konnte sich später nicht mehr erinnern, warum sein Vater eine Gaskanone im Auto hatte, denn der war ein freundlicher, friedlicher Mensch, bei allen beliebt. Eigentlich sagten das alle, die ihn gekannt haben. Irgendwann war es dann aus mit dem Frieden. Das Schulamt lud Jan Lübben schriftlich zum Idioten-Test ein, um zu sehen, ob er mit seinen sechs Jahren reif war für die Bildungs-Maschinerie. Der Schulpsychologe war ein fetter, alter, geiler Glatzkopf, der die ganze Zeit wie ein Schleimwurm freundlich tat, wobei sich auf seinem glänzenden, rosigen Gesicht ein ebenso feistes wie falsches Lächeln eingegraben hatte. Auf einem Stück Papier sollte Jan ein Männchen malen. Doch er schiss dem amtlich bestallten Schulanwerber was. Nicht etwa, dass er nicht zeichnen konnte. Er zeichnete sogar recht gut für sein Alter. Nein, Jan Lübben wollte einfach nur diesem für ihn uralten, ihm widerlichen, Repräsentanten der Autorität mit seinem dümmlichen, verlogenen Lächeln eins auswischen, ihm Widerstand leisten. So kam es, dass er erst ein Jahr später, bereits mit Sieben, eingeschult wurde – freilich schon mit psychologischem Brief und Siegel und ohne Wissen seiner Eltern – als pennälerischer Halbidiot eingestuft. Die der Westendstraße nächstgelegene Grund- und Hauptschule war die Huckelsberg-Schule, im Dialekt kurz ´Huggelsbärch´, so ziemlich die asozialste Lehranstalt in der ganzen Stadt. Gut, da gab es noch die Sonderschule am Schmiednagelsberg, die die Einheimischen, in ihrer stets diplomatischen Art, als ´Treppengymnasium´ bezeichneten, fand sich doch die einzige Dummschuul (Dialektal/despektierlich: Sonderschule) der Kleinstadt in direkter Nachbarschaft einer steilen Treppe, die zwei Ortsteile miteinander verband. Der ´Huggelsbärch´ lag auf dem Huckelsberg, einem Stadtteil, in dem überwiegend Ludwigshausner Lumpenproletariat wohnte. Die Huckelsberg-Grund-und-Hauptschule wurde vornehmlich von kleinen Gewaltverbrechern, Dieben, Trinker-Kindern, Perversen sowie unheilbaren Dummköpfen jeglicher Couleur besucht. Und von Jan Lübben. Die Kinder der Besseren Leute gingen allesamt auf die Römerschänzer Schule, die im gleichnamigen Viertel am Stadtrand und schön im Grünen lag. Fast alle braven Akademiker-Bürger, die Jan Lübben später kannte, hatten ihre Karriere dort begonnen. Doch schon Jan Lübbens Mutter hatte den ´Huggelsbärch´ durchlaufen. Und so kam es, dass er der Klasse des Fräulein Kundelgau zugeteilt wurde, der ehemaligen Lehrerin seiner Mutter Juliane.
Читать дальше