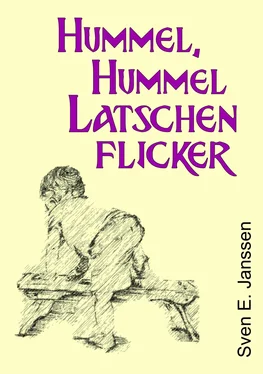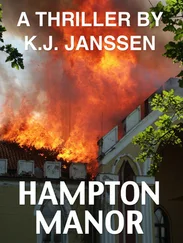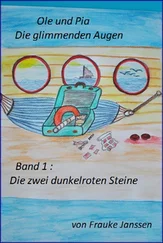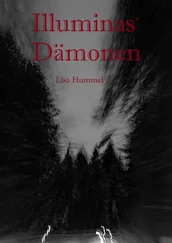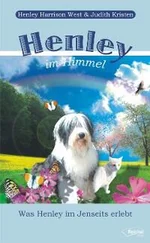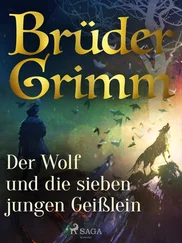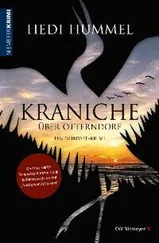Neben einer ganzen Reihe anderer Kinderbücher fanden sich in der Truhe auch eine Familie von Steiff-Tieren sowie die schönsten bunten Glasmurmeln, die man auf der ganzen Welt finden konnte. Ganz besonders liebte er einen kleinen rotbraunen Stoffhund mit kurzem Fell und Stummelschwanz, der auf seinen Hinterfüßen hockte und, den Kopf leicht zur Seite geneigt, einen mit seinen treuen schwarzen Knopfaugen anblickte, ganz, als ob er lebendig wäre. Dann war da im dritten Stock noch eine Vorratskammer, aus der Omi Dieffenbach noch jedes Mal irgendeine Überraschung hervorzauberte. Mal gab`s einen rotwangigen, herrlich nach Garten duftenden Apfel, mal ein Tütchen mit Lakritz-Schnecken und, manchmal, gab es auch ein Stück Seife. Jan war ganz verrückt auf Seife. Maria Dieffenbachs Lieblingsmarke steckte in einer rechteckigen Kartonfaltschachtel, die das Foto einer jungen blonden, langhaarigen Frau mit gütigem Gesicht zierte. Das Stück Seife selbst war dann nochmal in ein ganz feines, glattes Papier eingewickelt. Oft saßen Omi Dieffenbach und Jan auch in der Küche und sie las ihm dann vor, meistens Gedichte. Sein Lieblingsgedicht war „Herr Ribbeck von Ribbeck auf Havelland“, von Theodor Fontane, das sie ihm wieder und wieder vortragen musste. Das kleine illustrierte Büchlein, in das sie fein säuberlich und in schönster Sütterlinschrift seinen Namen eingetragen hatte, bewahrte er, zeit seines Lebens, eifersüchtig auf. Im Grunde hätte sie die Gedichte nicht vorlesen müssen, denn sie konnte sie alle auswendig; heute würde man sagen, dass Maria Dieffenbach ein Gedächtnis wie ein Computer hatte. Auf jeden Fall aber hätte sie eigentlich Professorin werden müssen oder wenigstens Lehrerin. Sie wäre bestimmt eine außergewöhnlich gute Lehrerin geworden. Maria Dieffenbach, die Jan Lübben immer nur Omi nannte, war jedoch nicht wirklich dessen Großmutter, sondern die Hauswirtin seiner Großeltern mütterlicherseits, Gerlinde Gundermann, geborene Kinzel und deren Ehegatten, Wilhelm Gundermann. Aber weder war die Hindenburgstraße 267 eine normale Hausgemeinschaft, noch war Omi Dieffenbach eine normale Hauswirtin. Schon lange vor dem Krieg wohnten Jan Lübbens Großeltern bei den Dieffenbachs, damals lebte noch Maria Dieffenbachs Mann, Johannes Dieffenbach, und der Weltkrieg hatte die Nachbarn eng zusammengeschweißt, enger als manche echte Familie. Noch in den letzten Kriegstagen wurde das Haus von den Amis ausgebombt, dabei gingen weite Teile des Daches zu Bruch. In dieser Zeit flog auch die Küchentür in Maria Dieffenbachs Wohnküche aus den Angeln und wurde seither nie wieder ersetzt. Im Winter 1945/46 waren die Wände dann dick mit Eis zugefroren und das Eis brachte den Hunger mit sich. Die Dieffenbachs und die Gundermanns kochten Kaffee aus Baumrinde und Suppe aus Brennnesseln. Oft begaben sich die Frauen des Hauses dann auf stundenlange Hamstermärsche, nur, um an etwas zu essen heranzukommen. Manchmal marschierten sie sogar bis weit ins benachbarte Wallachtal hinein, denn dort lagen einige Höfe im satten Wiesengrün eines kleinen Flüsschens. Nachdem die amerikanische Luftwaffe den sowohl strategisch als auch industriell nahezu unbedeutenden Ort noch in den letzten Kriegstagen bald dem Erdboden gleichgebombt hatte, ließ sich die US-Army dauerhaft mit einem riesigen Stützpunkt in Ludwigshausen nieder. Der kleinen Hausgemeinschaft in der Hindenburgstraße waren die Amis freilich eher suspekt, schon gar nicht sah man sie als Befreier. Man hatte den Krieg verloren, scheiße halt. Obendrein kamen mit den US-Soldaten auch noch die ersten Neescha
(Dialektal/despektierlich: Dunkelhäutiger) in das Städtchen, das war den Alten einfach zu viel. Nur die bislang eher unterbeschäftigten lokalen Huren freuten sich und lernten Englisch in Rekordgeschwindigkeit. Letztendlich war man dennoch froh, dass die Amerikaner und nicht die Russen nach Ludwigshausen gekommen waren. Die Amis mochte keiner leiden, aber sie störten auch niemanden wirklich, vor den Russen aber hatten die Leute Angst.
Maria Dieffenbachs Tochter, Marianne – kurz Maxi –, war sieben Jahre älter als Jan Lübbens Mutter, doch wuchsen die beiden, zusammen mit Onkel Friedrich, Maxis Bruder, wie Geschwister auf. Onkel Friedrich ist dann nach dem Krieg in die Nachbarstadt ausgewandert, um dort, als Bankdirektor, eine Offizierstochter zu heiraten und mit dieser eine Familie zu gründen. Natürlich war auch Friedrich Dieffenbach nicht Jan Lübbens echter Onkel, doch er nannte ihn halt einfach so. Maxi Dieffenbach, die als kaufmännische Angestellte in einer Schuhfabrik arbeitete, hatte nie geheiratet oder Kinder bekommen. Vielleicht deshalb, weil sie die Intelligenz ihrer Mutter geerbt hatte und möglicherweise daher nicht dazu bereit war, irgendeinem faulen Idioten die Socken zu waschen oder sich am Wochenende irgendein besoffenes Fußball-Gebrabbel anzuhören. Aber wer wusste das schon, und schließlich ging’s ja auch keinen was an. Jan Lübbens Mutter, Juliane Lübben, geborene Gundermann, hatte sich, mit harten Ellenbogen und viel Schweiß, vom einfachen Kaufmannslehrling zur Personalchefin der größten Fabrik des Städtchens hochgekämpft, Herrin über 2000 Industriearbeiter. Die Fabrik war ihre Familie, ihr Kind, ihr Messias, ihr Alles. Dort verbrachte sie zwölf Stunden täglich, nur mittags kam sie manchmal vorbei, um sich ein Essen abzuholen, das sie dann eilig am Schreibtisch verschlang. Und so ergab es sich, dass Maxi Dieffenbach, im Laufe der Jahre, zu Jan Lübbens Ersatzmutter, ja zu seiner Seelenmutter wurde. Sobald sie nachmittags, so gegen kurz vor halb fünf, von der Arbeit nach Hause kam, lief er ihr schon auf der Straße entgegen, um sich ihr an den Hals zu werfen. Dann musste sie ihn bis an das kleine grüne Gartentor, schließlich durch den fein säuberlich gepflegten Vorgarten, bis hin zum gläsernen Windfang und durch die Haustür hinein, die Treppe hinauf, in den zweiten Stock, bis in die Wohnküche hineinschleppen. Dort löste sie ihre Mutter ab, mit dem Spielen, dem Gedichte lesen, den Umarmungen, dem Lachen und Singen, der grenzenlosen, liebevollen Geduld. So ging das jeden Nachmittag, bis dann, abends, Juliane Lübben kam, um ihn abzuholen, was ihr, nach ihrem langen, harten Tag im Büro, meist nur unter wildem Geschrei und zornigen Kindertränen möglich war.
Morgens brachte ihn seine Großmutter, Gerlinde – kurz Gerli – Gundermann zu Fuß in den nahen gelegenen Kindergarten. Seine Großeltern waren, an modernen Maßstäben gemessen, bettelarm, ein Auto war undenkbar. Opa Gundermann hatte nicht mal einen Führerschein, und im Krieg ist er immer nur geritten oder auf dem Panzer mitgefahren. Dennoch fehlte es dem kleinen Jan an nichts, ganz im Gegenteil, er wurde verwöhnt und verhätschelt wie ein Prinz. Seine Oma Gerli liebte er abgöttisch; nichtsdestotrotz machte er ihr, als kleiner verzogener, schon früh jähzorniger, Teufel das Leben zur Hölle. Der ganze Weg zum in der Innenstadt liegenden Kindergarten war ein zorniges, ungezogenes Geplärr, denn bereits als Kleinkind hatte Jan Lübben eine wunderliche Abneigung gegen Autorität, in diesem Falle gegen jene der katholischen Kirche, verkörpert durch die Kindergartenschwestern, fast ausnahmslos überaus boshafte, schwarzverschleierte Nonnen mit ausgeprägtem Hang zum Sadismus. Hatte Oma Gerli es endlich geschafft, ihn in der Krippe einzuliefern, fing er auch schon an, den schwarzen Schwestern ins Bein zu beißen, sie zu treten oder sich, vor lauter Zorn, in die Hose zu pissen. So zog sich der Fußmarsch von der Hindenburgstraße – unter normalen Umständen höchstens 20 Minuten – bis zu dem katholischen Waisenhaus, dem sein Kindergarten angegliedert war, bald eine dreiviertel Stunde hin, tagaus, tagein. Noch schlimmer war für Gerlinde Gundermann freilich der Rückweg, denn der führte zwangsläufig an dem dann geöffneten zweitgrößten Kaufhaus des Ortes und dessen Spielwarenabteilung vorbei. Schon als Kleinkind war Jan Lübben ein Autonarr, und so zerrte er sie mindestens zwei, dreimal die Woche in die erste Etage der ´Kaufhalle´, zu den Matchbox-Autos; kaufte sie ihm keins, biss er sie ins Bein oder plärrte, wie ein Besessener, mit knallrotem Kopf. Und so kam es, dass sich die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung seiner Großeltern in einen regelrechten Spielzeugladen verwandelte, in allen Ecken standen seine automobilen Schätze, füllten bald ganze Kisten. Noch mehr als Autos liebte er schon als kleines Kind das Weibliche Geschlecht. Und so blieb den bigotten, säuerlichen Kindergartenschwestern nichts anderes übrig, als ihn jeden Morgen wenigstens für eine viertel Stunde in eine der Mädchenklassen des benachbarten Waisenhauses zu führen, wo er dann den Clown mimte. Auf die Frage, was er werden wollte, sagte er meistens „Astronaut“, „Rennfahrer“ oder „Verbrecher“. Manchmal sagte er auch „Daiwel“ (Dialektal: Teufel) , nur um die Nonnen zu ärgern, die dann immer ganz weiß im Gesicht wurden. Gerlinde Gundermann stammte aus dem Frankenland. Im Laufe der Jahre entwickelte sie so einen recht exotischen linguistischen Cocktail aus der distinguierten Mundart ihrer neuen Wahlheimat und dem fränkischen Dialekt ihres bajuwarischen Geburtsortes. Sie kam aus einer ziemlich wohlhabenden Familie, der Vater war nicht nur Metzgermeister, sondern auch Bürgermeister des Kleinstädtchens Stiefelstein und als solcher eine Art Hoflieferant. So wuchs Oma Gerli wohlbehütet und sorgenfrei auf, von einer Klosterschule zur anderen wechselnd. Doch als der Vater nach einem schweren Autounfall erblindete, verlor die Familie alles, an eine Unfallversicherung dachte damals noch kein Mensch. Ihren Mann, Wilhelm Gundermann, hatte sie hingegen schon vorher kennengelernt und mit ihm wanderte sie, noch vor dem Krieg, ins abgelegene Ludwigshausen aus.
Читать дальше