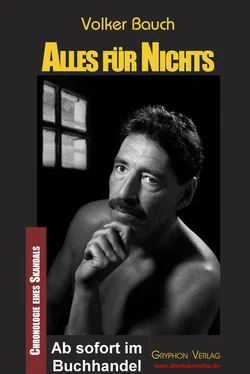Ich kam auf eine Regelstation für Strafhaft. Dort saßen die, die rechtskräftig verurteilt waren und nun ihre Strafe verbüßten.
Meine neue Zelle hatte eine Steckdose und an der Wand, auf einem Tisch, stand ein kleiner Fernseher. Diese beiden Dinge fie len mir als erstes auf.
Der Mithäftling hieß ebenfalls Michael und war 34 Jahre alt. Mit Unterbrechungen, hatte er 18 Jahre im Knast verbracht.
In dieser Zelle war es genauso eng, wie in der letzten. Doch alles wirkte viel sauberer und aufgeräumter. Mein neuer Zellenkollege besaß einen Tauchsieder. Heißes Wasser konnte man nun jeder Zeit haben und war nicht mehr auf das „Goodwill“ von Beamten oder missmutigen Hausarbeitern angewiesen.
Im Vergleich zu meiner letzten Unterkunft, war das hier fast eine LuxusSuite. So empfand ich es jedenfalls.
Mein Mitbewohner sprach nicht viel und das war mir auch ganz recht so. Ich hatte mich um meine eigenen Dinge zu kümmern. Beate hatte mir einen Anwalt namens KOHN aus Hann. Mün den bei Kassel besorgt. Angeblich ein Strafrechtsexperte mit
Schwerpunkt Wirtschaftsdelikte.
Doch erst einmal musste ich von hier wegkommen. Ob ich beim nächsten Transport dabei sein würde, konnte mir, trotz massiven Nachfragens, niemand sagen. Die Hoffnung, dass die Kripo jemals hier erscheinen würde, hatte ich bereits aufgegeben.
Jemanden von den Bediensteten zu fragen, war vergebene Lie besmüh. Die machten durch die Bank, Dienst nach Vorschrift. Alles andere interessierte sie nicht.
Ich schrieb Eingabe um Eingabe, mich beim nächsten Ab fahrtstermin zu berücksichtigen. Ich erhielt noch nicht einmal eine Antwort.
Inzwischen war ein weiterer Mittwoch vorbei und ich saß noch immer hier. Wieder eine Woche warten!
Zu den Hauptbeschäftigungen meines Mitbewohners zählte, von früh bis spät durch die Programme des Fernsehers zu zappen. Und der lief bis in die Nacht.
Zweimal am Tag stählte er seinen Körper mit Kraftübungen. Dazu benutzte er einen Besenstiel, an dessen Enden er jeweils einen gefüllten Wassereimer befestigte. Damit machte er bis zu 20 Kniebeugen. In die Freistunde ging er fast nie. Ich drehte meist allein meine Runden.
Mir wurde in der Zeit im Knast schnell klar, dass ich trotz Gesellschaft allein auf mich gestellt war. So etwas wie Solidarität gab es nicht. Allerhöchstens Zweckgemeinschaften, wenn es um irgendwelche Dinge des Alltags ging, die man sich über verschie dene Kanäle besorgen wollte.
Auf dieser Station gab es pro Tag so genannte Umschlusszeiten. Dann waren die Zellentüren eine Stunde lang geöffnet und man konnte andere Gefangene besuchen oder empfangen.
Für mich kam das nicht infrage. Ich wollte bewusst nicht viel Kontakt zu diesen Leuten.
Immer kamen die gleichen Fragen:
„Warum bist du hier?“ und „Wie viel Jahre hast du bekommen?“ Danach wurde man eingeschätzt, wobei das körperliche Erschei nungsbild und ob man sich etwas zum Einkaufen leisten konnte,
weitere Kriterien waren.
Die Kommunikation spielte sich meist auf der untersten geisti gen Ebene ab.
Die Legenden so mancher Mitgefangener waren schockierend. Sie stammten überwiegend aus katastrophalen sozialen Verhält
nissen, hatten weder Bildung noch Beruf und waren teilweise schon etliche Male im Knast gewesen.
Der Grossteil der Leute konnte nur mäßig lesen oder schreiben und befand sich auf dem Leistungsstand eines Drittklässlers. Im Umgang miteinander bediente man sich einer eigenen primitiven Knastsprache.
Einzelne Formulierungen waren mir bis dahin auch fremd.
So bedeutet ein Koffer, zum Beispiel, ein Päckchen Tabak. Die dazu benötigten Blättchen sind ein Buch. Ein Glas löslicher Kaf fee ist eine Bombe und der diensthabende Beamte wird als Schlie ßer tituliert. Angesprochen wird man regelmäßig mit „ Was geht ab, Alter?“
Als vermeintlichen Ausdruck der Persönlichkeit, hatten sich nicht wenige dem Kraftsport bzw. dem Bodybuilding verschrieben. Wahre Muskelmassen stolzierten in der Freistunde wie aufgebla sene Kampfhähne über den Hof.
Der Anteil der Ausländer hier war groß. Insbesondere die Grup pe der Russen und Russlanddeutschen war beträchtlich und ein in sich geschlossener Kreis. Andere Nationalitäten, wie Türken, Albaner, Jugoslawen, sah man ebenfalls ausschließlich unter sich. Fast jeden Abend stieg ein süßlicher Geruch zu mir nach oben. Michael kiffte. Manchmal rauchte er drei bis vier Stück in kur zen Abständen bis er so dicht war, dass ich den ganzen Abend oder Nacht nichts mehr von ihm hörte. Woher er das Zeug hatte, wusste ich nicht und interessierte mich auch nicht. Hauptsache,
er ließ mich damit in Ruhe.
Wieder war ein Mittwoch gekommen und ich hoffte sehnlichst, diesmal auf der Transportliste zu stehen.
Als ich morgens das Frühstück in Empfang nahm, sah ich den Beamten schon mit einem Blatt Papier winken:
„Bauch! Sachen packen! Es geht nach Kassel!“
Endlich war es soweit. Hauptsache weg von hier und in die Nähe zu Beate und den Kindern. In Kassel konnten sie mich besuchen. Diese Vorstellung hielt mich aufrecht und ließ mich die Tortur,
die nun folgte, ertragen.
Es waren circa 18 Leute, die den großen Bus betraten, der mich nach Kassel bringen sollte.
Aufgeteilt in vier Vierergruppen, mussten wir uns in enge Ab teilzellen quetschen, die keinerlei Bewegungsfreiheit boten. Der Rest der Truppe nahm die hintere Sitzreihe, die als einzige nicht verschlossen war.
Die Fahrtroute konnte man nur erahnen. Lediglich ein kleines Sichtfenster ermöglichte einem einen kurzen Blick nach draußen. Es war stickig in dem Käfig.
Den ersten Halt machte der Transport im Potsdamer Knast. Hier verließen einige Leute den Bus und andere kamen hinzu. Weiter ging es nach Magdeburg. Hier verbrachten wir zwei
Nächte in einem absoluten Dreckloch.
Mit mir zusammen blieben noch 10 Leute übrig, die nach Han nover zur nächsten Station geschafft wurden. Erneut folgte eine Nacht mit sechs wildfremden Personen in einer Durchgangszelle. Hannover war der reinste Umsteigebahnhof für Gefangenentrans porte. Fast stündlich trafen Busse aus den unterschiedlichsten Rich tungen ein, die am nächsten Morgen auf verschiedenen Routen
weiterfuhren. Es war ein wahrer Viehauftrieb.
Bereits um 6 Uhr morgens ging es am nächsten Tag für mich weiter. Nach einigen Stopps in anderen Gefängnissen und vier Stunden Fahrt, erreichte ich Kassel. Ich spürte meine Beine nicht mehr. Aber ich war endlich da.
Eine Etappe hatte ich hinter mir. Die Nächste wartete bereits auf mich. Es sollte die Hölle werden.
Es war Ende Mai 1993, circa eine Woche vor Pfingsten. Es war heiß an diesem Mittwoch und die Luft schien flimmernd in den Strassen zu stehen.
Völlig übermüdet kam ich morgens in mein Büro, das sich am Anfang der Fußgängerzone des kleinen Hessischen Städtchens Korbach befand.
PRO MEDIA hatte ich vor fünf Jahren aufgebaut und war nun seit zwei Jahren in meine Heimatstadt zurückgekehrt.
Ich besaß die Exklusivrechte für die Vermarktung von Werbung auf Einkaufswagen in Supermärkten für das Gebiet Nordhessen und SüdNiedersachsen. Die entsprechende Lizenz hatte ich vor einigen Jahren von dem FranchiseGeber erworben.
Als Agentur für Marketing, Werbung und Promotion, stand PRO MEDIA auf Expansionskurs. Die Geschäfte liefen gut.
Nachdem meine Frau Doris und ich uns zunächst die Aufgaben teilten, waren wir inzwischen zu sechst.
Das Tagesgeschäft, und somit die laufenden Einnahmen, hatte sich etabliert. Der Bereich Musikpromotion und Musikprodukti on sollte nun wieder intensiviert werden.
Da kam ich her. Dieses Business hatte ich von der Pike auf ge lernt. Erst als langjähriger Musiker, der sein BWLStudium zum Teil damit finanzierte, später im Management eines Herstellers von Musikinstrumenten und bei einer großen Schallplattenfirma. Nach drei Jahren in einem kleinen Ort im Hunsrück und nach fünf Jahren in Bad Homburg bei Frankfurt, hatten wir es wieder
Читать дальше