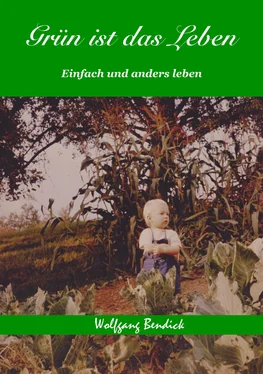Jedenfalls kamen wir überein, dass wir auf dem Hof bleiben könnten. Bis zum Herbst. Wenn dann weniger Arbeit wäre, müssten wir aber gehen! Den nächsten Winter könnten wir jedenfalls nicht bleiben! Man nähme uns aus reiner Nächstenliebe, denn effektive Arbeit zu leisten, wären wir erst in ein paar Jahren imstande. Auch bekämen wir nur die vier Wände zur Verfügung gestellt! Holz und Essen müssten wir selber besorgen, wir bekämen keinen Lohn, würden nicht versichert, müssten aber im Winter mindestens einen halben Tag, und wenn dann die Arbeit losginge, einen ganzen Tag arbeiten! Ein Tag in der Woche sei frei. Wir sagten zu, aber unter der Bedingung, dass einer von uns unter diesen Umständen später auswärts Arbeit suchen müsste, denn etwas Geld bräuchten wir doch noch. „Ihr wisst gar nichts von eurem Glück, denn im Schwarzwald gibt es einen Bauern, der sich 800 Mark im Monat zahlen lässt dafür, dass man dort arbeiten kann! Da geht es morgens um 5 Uhr raus und bis zum Sonnenuntergang, und alles wird von Hand gemacht und mit Pferden...“ Und dieser Landwirt, „der Rödelberger“, war ab jetzt der große ‚Buhmann‘, wenn wir mal mit unserem Los bei unserem Bauern nicht zufrieden waren.
Unser Zimmer lag über der Küche der Bauernfamilie, unterm Dach des Hauses. Das Klo war im Flur, das Bad unten. Dieses konnten wir einmal pro Woche benutzen und es musste vorher eingeheizt werden. Ein alter Küchenherd war das Hauptmöbel unseres Raumes. Am ersten Abend durften wir ein paar Holzscheite des Bauern nehmen, dann mussten wir das Brennholz selber im Wald suchen. Als später das Feuer im Herd knisterte und die Flammen durch die schlecht schließenden Ringe der Platte hindurch unter der Zimmerdecke ihren Reigen tanzten, lagen wir auf der Matratze und waren glücklich. Man hatte uns genommen! Vom Stall dringen leise die Geräusche der Kühe zu uns herauf, ein Parfüm von Äpfeln liegt in der Luft, vermischt mit dem erdigen Geruch von Kartoffeln und dem Modergeruch aus dem Kellergewölbe, wo die Gemüse für den Hofverkauf ausliegen. Die Bäuerin hatte uns ein paar angewelkte Porree-stängel zugeschoben, aus den wir eine Suppe kochen konnten. „Das soll aber eine Ausnahme bleiben, denn die Gemüse sind zum Verkauf bestimmt!“, grummelte der Bauer. Später aßen wir dann unsere Suppe und genossen die vier ‚eigenen‘ Wände. War dies unser erster Schritt zu einem eigenen Höfle?
Am nächsten Morgen ging es dann los. Man zeigte uns den Keller, die Schuppen, den Schweinestall. Doris sollte der Frau zur Hand gehen, ich folgte dem Bauern durch die restlichen Gebäude, wobei er mir alles zeigte und zugleich schon erklärte, was in Zukunft alles zu tun sei, falls er mal nicht da sei oder ich eine freie Minute hätte. Denn ohne Arbeit ginge es mal nicht auf so einem Hof! Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie wenig in der Landwirtschaft verdient werde! „Das Beste wäre, gar nicht zu arbeiten, denn das würde wenigstens die Unkosten ersparen!“ „Aber man hat doch immer genügend zu essen, und das ist doch schon etwas!“, warf ich ein. Daraufhin bekam ich erst einmal eine lange Predigt über die Ausgaben für Versicherungen, Strom, Wasser und Maschinenreparaturen, Ernteausfälle und die schlechte Marktlage. Das kam mir zwar mehr als Ausrede vor, um uns keinen Lohn zahlen zu müssen, ließ es aber ohne Kommentar. Überall häuften sich Geräte und Dinge, die darauf warteten, repariert oder aufgeräumt zu werden, oder gleich weggeworfen oder verbrannt. Dafür, dass es die arbeitsarme Saison war, gab es überraschenderweise viel zu tun! Wie sollte das erst werden, wenn mal Hochsaison herrschte?
Am Mittag wollten wir dann, wie ausgemacht, mit der Arbeit aufhören. „Ja aber ihr seid doch noch gar nicht fertig!“, bekamen wir zu hören. „Es war doch ausgemacht, in der ruhigen Zeit nur ein halber Tag Arbeit täglich!“, warfen wir ein. „In der Landwirtschaft gibt es keine festen Zeiten! Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ihr noch lernen müsst! Fertig ist man, wenn die Arbeit beendet ist!“ Das schien uns wie eine neuartige Auslegung von ‚gleitender Arbeitszeit‘, wie sie gerade in manchen Betrieben ausprobiert wurde. Gut, wir hatten zugesagt, wollten außerdem, vor allem zu Anfang, auch niemanden enttäuschen. Also machten wir am Nachmittag weiter, bis unsere Aufgabe beendet war. Doch dann machten wir uns aus dem Staub, ohne dem Bauern etwas zu sagen.
Wir erkundeten die nähere Umgebung. Wir gingen einfach der kleinen Teerstraße nach, die an dem Haus vorbei führte. Wir liefen durch eine vom Frost vergilbte Streuobstwiese zu einem kleinen Hügel. Wir schwangen uns über einen hölzernen Zaun und stiegen zwischen den grobrindigen, leicht gedrehten Stämmen bis hinauf auf den Moränenhügel. In der Ferne glitzerte der blasse Spiegel des Bodensees, umrahmt von den majestätischen, schneebedeckten Schweizer Bergen. War das schön! Wir setzten uns auf einen Anorak, schmiegten uns aneinander und ließen den Blick schweifen. Es roch leicht nach feuchtem Laub. Wir waren glücklich und verspürten so etwas wie das Gefühl von Heimat…
Die Arbeit begann mit Sonnenaufgang. Auch, wenn sie nicht zu sehen war. Das war im Winter ganz angenehm, wenn es auch in der Früh nicht gerade ein Vergnügen war, wenn der Reif unter den Schritten knirschte und die Hände am eiskalten Werkzeug festklebten. Der Atem wehte wie eine weiße Fahne und kondensierte im Bart zu Tropfen. Langsam hob sich der Nebel und die Silberwelt wurde durchsichtiger. Wie Weihrauch lag der Geruch der Holzfeuer in der Luft, bis bald die ersten Sonnenblitze die Welt mit Farben bespritzten. Doch das war hier in Bodenseenähe leider nicht die Regel. Oft blieb es grau, und man vergaß schnell, dass irgendwo auch eine Lichtwelt existierte. So gegen zehn Uhr machten die Bauern Kaffeepause. Das war unsere Frühstückszeit. Außerdem waren wir keine Kaffeetrinker. Das war weniger gesundheitlich bedingt. Vielleicht ging das bei mir auf eine Ablehnung der spießerischen Gesellschaft zurück, die im Kaffeeritual ihren Höhepunkt fand. Jedenfalls war diese halbe Stunde Pause unsere Frühstückszeit, wo wir unser Müesli zu uns nahmen, verbessert mit warmer Milch und geschnetzelten Früchten, die wir aus der Schweinetonne gelesen hatten. Bei Sonnenuntergang war Arbeitsende, wenn es uns nicht gelang, uns nach erledigten Pensum vorher davonzustehlen.
Nach getaner Arbeit ließen wir uns von der sich durch die Wiesen und Obstanlagen schlängelnde Straßen leiten, bis uns ein Bächle oder Pfad von dieser ablenkte. Wir folgten diesem wie Entdecker und freuten uns an jedem Wehr oder unterhöhltem Ufer, beobachteten die Forellen oder andere Tiere, die sich langsam wieder ans Tageslicht wagten, wenn wir uns eine Weile nicht bewegt hatten. Was gab es da alles zu entdecken, wenn man erst einmal still geworden war! Das Plätschern des Wassers wurde zu Musik, das Wehen des Windes zu einer Melodie, zu der sich mit dem Längerwerden der Tage auch noch die Stimmen der zurückgekehrten Vögel gesellten. Langsam erwachte die Natur, viele uns unbekannte Pflanzen durchstachen die feuchte Erde und entrollten oder entfalteten ihre Stängel und Blätter. Wir hatten immer ein Pflanzenbestimmungsbuch bei uns und lernten bei jeder Wanderung neue Gewächse und deren Wirkungen auf die Menschen kennen. Wir fingen an, die ersten Pflanzen zu sammeln und zu trocknen. Der Bauer gab uns eine seiner auf dem Dachboden eingestaubten Tret-Nähmaschinen. Doris nähte damit kleine Säckchen, die wir mit den Kräutern füllten. Oder wir stopften sie in Schraubverschluss-Gläser, wenn sie aromatisch waren. Auch fertigten wir mit Obstler Tinkturen an, die uns bei Erkältungen halfen oder die wir unseren Freunden als Schnaps servierten. Wir begannen in dieser Zeit ein Herbarium anzulegen. Nicht weit vom Hof stand ein verwahrlostes Haus, an dem wir manchmal bei unseren Exkursionen vorbeikamen. Es war das einzige verwahrloste Haus in der Umgebung und drohte, bald einzufallen. Es muss vor langer Zeit eine Mühle gewesen sein, denn ein ausgetrockneter Kanal führte dort hin. Der Ort gefiel uns, vor allem die Inschrift in gotischen Buchstaben über der Tür: „Was von deinen Vätern du ererbt, erwirb es, um es zu besitzen!“ Wir sprachen den Bauern darauf an. „Der Spruch ist von Goethe! Das Haus ist irgendwie verwunschen. Die da gewohnt haben, sind alle spinnet geworden. Es gibt schon noch einen Eigentümer. Aber der hat es wohl nicht nötig, etwas damit zu machen…“
Читать дальше