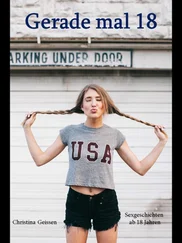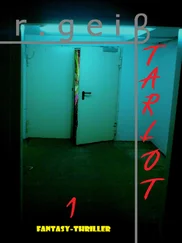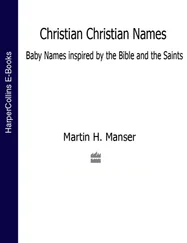Christian Geiss - Seelenkrieg
Здесь есть возможность читать онлайн «Christian Geiss - Seelenkrieg» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Seelenkrieg
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Seelenkrieg: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Seelenkrieg»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Seelenkrieg — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Seelenkrieg», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Seine Reise hatte den Läufer dieses Mal tief in das Innere von Aserbaidschan geführt und er war bis in die Stadt Baku gekommen. Dort hatte er von dem gehört, was sie schon so lange vergebens suchten. Es war ihm gelungen, einen Mann namens Abid zu belauschen. Bei Honiggebäck und schwarzem Tee hatte dieser Mann seiner Tochter von den Erlebnissen seiner Reise ins Zweistromland berichtet. Die beiden mussten sich wohl sehr nahe stehen, denn der Alte hatte seiner Tochter während der ganzen Erzählung durchs Haar gestreichelt.
Die Erinnerung an diese Szene ließ den Läufer erschaudern. Ihn widerte diese menschliche Zuneigung an. Dann zog er seinen Handschuh aus und fingerte aus den verwahrlosten Kleidern einen rötlich schimmernden, labberigen Wurm hervor. Seine letzte Mahlzeit lag nun schon einige Stunden zurück – da kam ihm dieser kleine Happen zwischendurch ganz gelegen. Mit offenem Mund zerquetschte er zwischen seinen Zahnstummeln das Tier, das sich eben noch von seinem Körper ernährt hatte.
Erneut packte er die Riemen, ließ die Ruder schwerfällig ins Wasser klatschen und paddelte weiter. Schwarzer Nebel breitete sich aus und lebendige Kerzen verrieten ihm den Weg durch die rauen Klippen und die heimtückische Strömung. Um sich herum hörte er das Brüllen und Tosen der Gischt der Wellen, die sich an den Felsen brachen. Darunter mischte sich das Schreien, die qualvollen Rufe und das Stöhnen derer, die an den Riffen zerschellt oder im Meer ertrunken waren.
Das düstere Wasser war inzwischen tintenschwarz. Allmählich hatte sich das Meer in einen Morast und schließlich in einen stinkenden Sumpf verwandelt. Aus dem Nebel tauchten die Berge der Insel auf. Gestaltlose Existenzen schwebten über der Küste oder saßen auf Felsen aus Totenschädel. Ein beißender Geruch lastete schwer in der Luft, die von kaltem Staub erfüllt war. Finsternis quoll aus Kratern hervor und ein unheimlicher Gesang hallte zu dem Läufer herüber. Eine verhängnisvolle Melodie, dirigiert vom eisigen Wind. Unerlässlich, niemals endend, schallte diese über die Insel und raubte einem den Schlaf. Er hatte die Fahrt überstanden.
Als der Rumpf seines Bootes den Grund berührte, rollte er sich über die Reling. Zwischen Reet und dornigem Unterwuchs zerrte er seinen Kahn an Land – voller Hoffnung auf eine Belohnung und eine gute Zukunft. Denn sein Meister hatte ihm und allen anderen Läufern versprochen, dass sie für immer im Überfluss und völligem Glück leben würden. Sie müssten nur diesen Baum finden.
Noch ehe er die Ruder im Boot verstaut hatte, hörte er von Weitem das Klappern von Pferdehufen. Kurz darauf erschien die Kutsche seines Meisters vor ihm. Auf dem Kutschbock saß der persönliche Sekretär des Meisters. Dieser Leibeigene lebte mit wenigen anderen Bediensteten auf dem mächtigen Landgut im Herzen der Insel und gehörte zu den Auserwählten. Diese wurden bevorzugt behandelt, erhielten bessere Kleidung und durften auf Strohmatten in kärglichen Hütten hausen. Alle anderen lebten in Höhlen und fensterlosen Kellern. Gleichberechtigung gab es auf der Insel nicht. Stattdessen herrschten Angst, Verzweiflung und Misstrauen. Nur wer stark war, hatte eine Chance, den nächsten Tag zu erleben.
»Stopp!«, rief der Meister forsch, und sogleich kamen die Pferde zum Stehen. Gierig nach erfreulichen Neuigkeiten, sprang er mit einem Satz von der Kutsche.
»Ihr ergebener Diener.« Der in Lumpen gehüllte Mann warf sich vor seinem Meister auf den Boden und küsste ihm die Füße. Erst nach Erlaubnis des Meisters war es ihm gestattet, sich aufzurichten. Danach würde sein Bericht über die nächsten Tage entscheiden: entweder schuften auf den Feldern oder unzählige Nächte im Bunker durchstehen.
»Steh auf!«, befahl der Meisters in verächtlichem Ton.
Langsam rappelte sich der Läufer mit Hilfe seiner hageren Hände auf.
»Was gibt es? Wurdest du fündig?«, fuhr der Meister sein Gegenüber harsch an.
»In Baku konnte ich einen Mann belauschen, der anscheinend gefunden hat, was wir suchen«, würgte der Läufer verängstigt hervor. Trotz der offensichtlich guten Nachricht schlotterte sein Körper vor Angst.
Der Meister hörte gespannt, was sein Läufer ihm sonst noch zu berichten hatte. An einem anderen Tag hätte er sich vermutlich direkt aufgemacht, um diese Spur zu überprüfen. Jedoch hatten sich in den letzten Tagen die Ereignisse überschlagen. Solch eine Gelegenheit, Zerstörung in die Welt zu bringen, würde sich so schnell nicht wieder bieten.
»Geh! Sammle die Steine von den Feldern!«, kommandierte der Meister und schnippte einen Krümel verdorbenes Brot vor seinen Läufer in den Dreck.
»Und wir müssen los«, wandte er sich an seinen persönlichen Sekretär. »Wie es aussieht, haben wir gerade noch ein weiteres Ziel erhalten.«
Das Leder der Kreuzleine klatschte auf den Rücken der Pferde und unversehens rollte die Kutsche weiter.
Nur wenig später setzten sie zusammen von der Insel des Meisters auf das Festland über. Irgendwo dort war dieser grässliche Garten versteckt. Nur wenn der Meister diesen eines Tages finden würde, hätte er eine Chance, den entscheidenden Sieg zu erringen.
Noch vor wenigen Stunden hatte der Meister auf seinem Stuhl gesessen und verschlagen die Sanduhr auf dem einfachen Tisch betrachtet. Eine solche Uhr gab es nur ein Mal. Sie war gefertigt worden aus dem Holz einer uralten Eiche. Ihr verschnörkeltes Gehäuse erinnerte an eine barocke Kirche. Eine perfekte Uhr – und doch nur ein missliches Imitat.
Feiner Sand rieselte durch die schmale Öffnung hinab. Die Körner gaben keinen Ton von sich – lautlos verschwand die Zeit. Nichts konnte sie aufhalten. Die Zeit rann unaufhaltsam und mit ihr die Geschichte, bis diese ihr Ende fände und schließlich alle Uhren still stehen würden.
Als das letzte Körnchen Sand drohte, nach unten zu fallen, fasste der Meister mit seiner Hand nach der Uhr und drehte sie erneut um. Dabei sah es fast so aus, als ob er lächelte. Doch sein Vollbart verbarg nahezu jede seiner Regungen, so auch diese.
Wieder las der Meister den Auftrag, den er per Telegramm erhalten hatte. Er hatte es geschafft. Sie waren auf seine Lügen hereingefallen und hatten sein Angebot angenommen. Sie wussten nicht, mit wem sie sich hier einließen, und sollten es auch nie erfahren. Sie hielten ihn für einen General. Für sie war er General Iblis, einer ihrer fähigsten Soldaten.
Dabei war er weit mehr als dieses Blendwerk seiner eigentlichen Identität. Tief verborgen, hinter seinen äußeren Schalen und Facetten, lag sein grausiges Geheimnis. Er lebte mitten unter ihnen und doch gehörte er zu einer anderen Welt.
Still saß er im Hades, dem Ort, den er liebte, und den außer ihm keiner betreten durfte. Die Säulen bestanden aus Schädeln, die Wände aus Knochen und der Boden aus Skeletten.
Jetzt entfernte er sorgsam einen Orden nach dem anderen von seiner Brust und wurde äußerlich wieder zu einem gewöhnlichen Bürger. Als er jedoch die letzte Medaille auf den Tisch legte, brach die ganze Dunkelheit aus ihm heraus. Seine Finger verkrümmten sich, seine Hand wurde zu einer Klaue. Das Weiße seiner Augen verschwand und leuchtete schwarz wie die Nacht. Seine gespaltene Zunge schnellte nach vorne. Eine dunkle Träne rann über seine Wange und aus seiner höckerigen Nase floss zäher, übel riechender Schleim. In ihm lebte das, was es doch eigentlich nicht geben sollte: die Finsternis.
Dieser Ausbruch des Bösen dauerte nur einige Sekunden, dann hatte er sein wahres Wesen wieder verborgen. Entschlossen erhob sich der Meister und steckte die Sanduhr in die Innentasche seines Mantels. Dann nahm er noch seine kleine Handsichel sowie ein unsichtbares Seil aus seiner Schublade. Wie die Sanduhr und die Sichel trug General Iblis diesen Strick als Instrument des Tötens immer bei sich. Das unsichtbare Seil wurde bei Bedarf zur Schlinge des Todes. Er konnte es sogar um ganze Länder legen und sie damit fesseln.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Seelenkrieg»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Seelenkrieg» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Seelenkrieg» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.