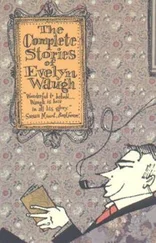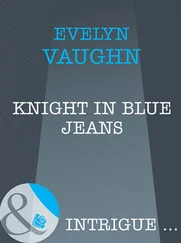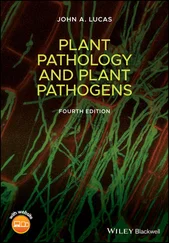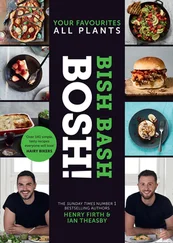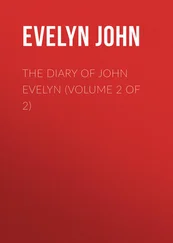Nachdem ich meine roten Gerbera und die Kerze deponiert habe, stehe ich am Grab. Mir kommt es so vor, als seien diese drei Jahre, immerhin mehr als 1.000 Tage, unglaublich schnell vergangen. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, bin ja auch ich im Nullkommanichts fällig.
7. Juni
Heidi und ich sind auf dem Weg zur Arbeit. Auch sie kenne ich, ebenso wie Elsa, seit Jahren, da wir morgens um die gleiche Zeit die Straßenbahn nehmen. Während unserer gemeinsamen viertelstündigen Fahrt gibt es stets etwas zu erzählen. Heute geht es um das Unvermögen unserer Ehemänner, sich von manchen Dingen zu trennen.
„Ich bin mit einem Sammler verheiratet. Der verwahrt fast alles, weil er meint, es eines Tages noch brauchen zu können.“ erwähne ich.
„So eenen hab ich ooch.“ Heidi stammt aus Brandenburg, und ich höre ihr gern beim Reden zu. „Der hat im Keller Ecken voller Holz, Kisten voller Schrauben und braucht ooch noch die rostigen Nägel. Alle!“
„Manchmal kommt es mir so vor, als lebten wir im Museum. Einige Leute will ich gar nicht mehr zu uns einladen, weil bei denen alles perfekt ist. Da geniere ich mich.“ gebe ich zu.
„Vor paar Wochen hat mein Mann endlich mal anjefangen, den Keller auszumisten. Dauernd hab ich ihn ermahnt. Und dann hat er was jesucht und erinnert sich, dass es in der Mülltonne gelandet ist. Ich bin das jetzt schuld, weil er ja nur wegen mir aufgeräumt hat.“ meint sie, und möchte von mir wissen: „Verwahrst Du denn gar nichts?“
„Es geht so. Aber ich kann mich von Kleidungsstücken nicht so gut trennen. Ich habe Klamotten, die ich auch nach zehn Jahren immer noch mal anziehe. Es kommt auch vor, dass ich was Neues gekauft habe und etwas von den vorhandenen Sachen farblich dazu passt. Dann freue ich mich und sehe erst recht nicht ein, dass ich was wegwerfen oder in die Kleidersammlung packen soll. Wenn unsere Kinder nach unserem Tod die Schränke durchsehen müssen, steht Britta vielleicht da und sagt: “Guck mal, Marvin, diese Bluse hat Mama bei Deiner Einschulung getragen.“
Heidi muss gleich aussteigen, raunt mir aber noch zu: „Det mit dem Schämen würd ich mir aber nochmal überlegen, da müsstest Du drüber stehn. Wenn et bei den Freunden so ordentlich ist und sie trotzdem zu Euch kommen, scheint et ihnen doch zu jefallen.“
„Ich möchte nicht hören, was die hinterher dann zu reden und zu lachen haben, wie es bei uns wieder ausgesehen hat und so.“ erkläre ich.
„Det hörste ja ooch nich. Die sind ja dann aufm Heimweg.“ merkt sie grinsend an und verlässt die Bahn.
8. Juni
Mit Mann und Sohn sitze ich beim Abendessen.
„Nein danke, ich möchte nichts mehr.“ verkünde ich. Hannes und Marvin gucken mich an. Ungläubig. Auch grinsend.
„Ich hab nur gefragt, ob noch was da ist.“ erläutert Marvin.
Ach je, da hab ich wieder mal was falsch verstanden.
„Da gibt es so kleine Hörgeräte. Vielleicht solltest Du doch mal ran.“ ergänzt mein Sohn mit aufmunterndem Blick. Dazu sage ich nichts. Die Dinger sind nicht billig. Außerdem, und das ist wohl der Hauptgrund, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich mit so einem Gerät im Ohr wohl fühlen würde. Also vorerst nicht so viele Antworten geben, sie könnten für erneute Irritationen sorgen.
16. Juni
Am Fühlinger See findet ein Drachenbootrennen statt; der „Fastelovends-Cup“ wird ausgetragen. Je zwanzig Personen klettern in eins der Boote, die am Bug mit farbenprächtigen, aber böse blickenden Drachenköpfen dekoriert sind. Die Mannschaften haben sich bunt kostümiert, auch diverse Wikinger sind dabei. Während die aktuelle Hitparade über die Lautsprecher erschallt, gehen bis zu vier Boote ins Rennen, und die Männer paddeln und zeigen, was ihre kräftigen Armmuskeln leisten können.
Ein Stück weiter, in einem ruhigen Uferbereich, der wie ein Biotop angelegt ist, tanzen massenhaft blaue Libellen umher. So viele auf einmal haben wir noch nirgends gesehen. In einem Wiesenbereich lassen wir uns nieder, gucken zu, hören die Anfeuerungsrufe und genießen es, einfach nur in Ruhe zu sitzen und nichts zu tun. Nach einer Weile ist es aber auch genug.
Da ich heute Probleme mit den Knien habe, muss Hannes mir hoch helfen, trotzdem gelingt das Aufstehen nur unter Mühen. „Hoffentlich hat das jetzt keiner gesehen.“ murmele ich vor mich hin, während ich mich umdrehe. Oh. Hunderte von Menschen sitzen oder stehen da, denen meine Hampelei sicher nicht verborgen geblieben ist. Na, wenn schon. Die werden auch mal älter. Ein bisschen peinlich ist es aber doch.
29. Juni
Hannes und ich sitzen in der ersten Etage eines chinesischen Restaurants mit Blick auf den Dom und die Domplatte, die wie stets voller Menschen ist. Vom Essen werden wir schon bald abgelenkt, denn unten setzt sich eine Demonstration in Gang, friedlich, wie es scheint, und wir gucken von unserem Fensterplatz aus zu.
Nachdem wir das Restaurant verlassen haben und noch etwas zuschauen wollen, entsteht plötzlich eine völlig andere Stimmung. Es wird unruhiger, Rufe erschallen, Menschen hasten geradewegs an uns vorbei. Auch Polizisten. Gleich neben uns stoppt ein Einsatzwagen, aus dem zügig mehrere Einsatzkräfte springen, die anhand von Kleidung und Ausstattung als Sondereinheit zu erkennen sind. Hier geht es bald richtig zur Sache, denke ich noch. Unmittelbar darauf stürmen drei von ihnen auf junge Leute zu, auf Demonstranten, zwei von ihnen werden niedergerissen. Hannes ist aufgebracht, und möchte hin.
„Bleib da weg. Du kannst Dich doch nicht einfach dazwischen werfen.“ schreie ich ihn an.
„Aber die haben doch gar nichts getan.“ ruft er mir zu. Ihm tun die jungen Leute leid.
„Die schicken doch keine Sondereinheit, wenn da nur harmlos protestiert wird.“ entgegne ich.
Nur mit Mühe kann ich Hannes davon abhalten, nach vorne zu preschen, um sich einzumischen, eventuell den Polizisten die Meinung zu sagen. Vor uns rennt eine junge Polizistin einer gleichfalls jungen Frau hinterher, holt sie ein und zerrt sie recht unsanft zurück zu den Kollegen.
Rund um das Geschehen versammeln sich immer mehr Menschen, die ratlos oder aufgebracht gucken. So manche Kameras und Smartphones sind bereits bei der Arbeit, alles wird aufgezeichnet. Mir wird das alles immer unheimlicher, ich will nur weg von hier.
„Ich geh jetzt. Hier bleibe ich nicht länger.“ verkünde ich im Weggehen. Hannes lässt sich davon nicht beeindrucken. Er bleibt weiterhin stehen.
Ich gehe Richtung Hohe Straße, drehe mich nach einigen Metern um, und sehe Hannes immer noch an gleicher Stelle. Na dann eben nicht – gehe ich eben alleine. Erst am Ende der Schildergasse, kurz vor dem Neumarkt, schaue ich erneut hinter mich. Von ganz weit hinten schlendert Hannes herbei. Meine Stimmung schwankt zwischen leichtem Ärger und großer Erleichterung. Als er näher kommt, lächeln wir uns an, gehen zur Haltestelle und warten auf die Bahn. Erst später kommen wir auf das Thema zurück und stellen fest, dass wir sehr unterschiedlich mit einer solch ungewohnten, aber auch brisanten Situation umgehen. Über die Ursachen und Gründe, die das Geschehen auf der Domplatte in Gang gesetzt haben, erfahren wir nichts.
12. Juli
Im Alleingang zur Neusser Straße, eine meiner Kölner Lieblingsstraßen, die ich immer wieder gerne besuche. Kleider- und Schuhläden, Uhren- und Schmuckgeschäfte, Stände mit Telefonkram und vieles mehr. Gerüche aller Art wechseln sich ab; auf dieser Straße befinden sich die Dönerbude neben dem Café, der türkische Laden mit Gemüsesorten aller Art, auch fremd aussehenden, und allerhand Kräutern, und der Supermarkt lockt mit dem Geruch nach frisch gegrillten Hähnchen. Mich zieht jedoch ein betörender Kaffeeduft ins Café. Als ich gerade durch die Tür treten will, wird einer der Tische frei vorm Lokal. Meiner! Schnell setze ich mich hin, bevor es ein anderer tut. Gleich neben dem Tisch steht ein Fahrrad mit üppiger Blumendekoration vorne am Lenker, was mich sofort an die letzte Tour nach Amsterdam erinnert.
Читать дальше