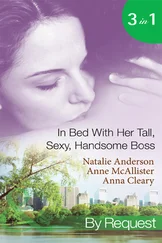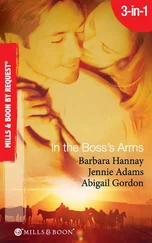Manchmal versteht man das Leben erst rückwärts. Nämlich erst im Nachhinein. Als würde man einen Film von Ende bis Anfang schauen und zwischendurch immer wieder rufen „ach, deswegen!“ und „ja, natürlich! Darum hat sie das gemacht“. So geht es mir ein bisschen, wenn ich die letzten sechs Jahrzehnte Revue passieren lasse. In den Situationen selbst habe ich meistens gar nichts verstanden und die Umstände oft verflucht. Zum Glück war Aufgeben aber nie eine Option, denn dafür waren auch die vermeintlichen Niederlagen viel zu lustig.
Und wenn es mal nicht so lustig war, habe ich auf meinen inneren Kompass geschaut und gehört. Die innere Stimme ist der Kompass, den wir alle in uns tragen. Wir müssen uns nur auf diesen Kompass, diese innere Führungskraft einlassen und ihr genau zuhören.
Während meiner Reise habe ich mir in Südamerika die Seele aus dem Leib gekotzt, am Sinn des Lebens gezweifelt, mir in Spanien meine Füße blutig gelaufen, als Ausdruck meiner trauernden Seele meine blonden Haare schwarz gefärbt und auf Ibiza die freie Liebe gelebt.
In all den Jahren habe ich jedoch den Glauben an echte Liebe und inneren Frieden nie verloren. Während ich die letzten Jahrzehnte Revue passieren lasse, sitze ich auf dem Steg, der ein Häuschen und einen angrenzenden See verbindet. Die Sonne verschwindet gleich hinter den Baumkronen. Noch glitzert sie über die stille Wasseroberfläche. Ich trage meinen weißen Sonnenhut und ein buntes Wickelkleid. Es ist Sommer in Norddeutschland. Ich schaue in die Natur um mich herum und spüre ein tiefes Glücksgefühl in mir. Ruhig und gleichmäßig durchströmt es meinen Körper. Es war ein langer Weg hierher, aber jeder einzelne Schritt war wichtig und in der Gesamtheit richtig.
In diesem Buch will ich meine Geschichte erzählen und damit Mut machen. Mut, die vermeintlichen Fehler als Chancen und Türöffner zu sehen, Mut, sich in das Unbekannte zu stürzen, Mut, alles auf eine Karte zu setzen, wenn die innere Stimme Signale sendet. Mut, nicht aufzugeben, sondern es einfach zu probieren.
Ich wollte nie erwachsen werden. Die Erwachsenen um mich herum lebten so ein langweiliges, immer gleiches und auch ziemlich verlogenes Leben. Ich stamme aus dem kleinen Ort Utzmemmingen, nahe dem Ort Pflaumloch. Kein Witz. Das liegt in Baden-Württemberg, an der Grenze zu Bayern. Die nächstgrößere Gemeinde ist Bopfingen am Ipf und das ist auch nicht groß. Mitte der 50er-Jahre geboren, war ich die jüngste von drei Schwestern. Was für eine Enttäuschung. Es sollte doch endlich ein Junge im Hause Altinger geboren werden. Und dann kam ich. Am härtesten traf es meine Eltern, die in Utzmemmingen die Konditorei und einen Laden betrieben und natürlich einen Nachfolger und Stammhalter wollten. Sie hatten auch schon einen Namen für ihn, Maximilian. Aber daraus wurde nichts. Als die Hebamme sagte: „Glückwunsch zur dritten Tochter“, antwortete mein Vater: „die können sie gleich wieder mitnehmen“ und machte sich ganze zwei Wochen gar nicht erst die Mühe, in die Wiege, die eigentlich ein Brotkorb war, zu schauen. „Noch a Mädle“, dachte er. Meine Mutter stand einen Tag nach meiner Geburt wieder im Laden und verkaufte.
In unserem Geschäft gab es alles, was so ein 800-Seelen-Dorf braucht. Vom Wurstdarm zur Herstellung eigener Wurst bis zur Kittelschürze. Und was wir nicht hatten, wurde besorgt. Der Laden war nicht groß, aber vollgestopft bis oben hin. Wie eine Art Mini-Kaufhaus. Und mittendrin natürlich die selbstgebackenen Kuchen, Torten und Gebäck aller Art.
Als mein Vater dann schließlich doch einen Blick auf mich warf, war es Liebe auf eben diesen ersten Blick. Das kleine blonde Mädchen mit den strahlend blaugrauen Augen, da konnte er einfach nicht mehr böse sein, und so wurde ich sein heimlicher Liebling.
Ich erinnere mich an warme, frische Nusshörnchen, direkt aus dem Ofen der Konditorei. Morgens setzte mein Vater mich auf die warme, aber natürlich nicht heiße Platte des großen Backofens. Dort aß ich zufrieden mein Hörnchen, baumelte mit den Beinen und sah Papa bei der Arbeit zu. Die Momente, die wir ganz für uns hatten, noch bevor die Mama die Tür aufstieß und wieder irgendetwas wollte, etwas fragte oder sagte, noch bevor meine Schwestern herumlärmten und noch bevor der Laden aufgeschlossen und die immer gleichen Kunden hereinkamen, diese Momente waren die schönsten.
Mein Vater musste jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen, Kuchen und Torten backen, dann weckte er mich gegen 6 Uhr und schmierte mir die Pausenbrote mit viel Butter und dicken Scheiben Wurst. In den frühen Morgenstunden, in denen ich meinen Papa ganz für mich alleine hatte, waren wir jedes Mal wie zwei Provinz-Schauspieler, die davon träumen, einmal vor ganz großem Publikum zu spielen und einmal die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Dabei hatten wir ja nur uns zwei. Meine Mutter und meine Schwestern interessierten sich nicht für Operetten, Bücher oder Witze. Die erzählte er immer, wenn er kurz traurig wurde, und er wurde oft traurig.
Wie fast alle Männer damals war auch mein Vater im Zweiten Weltkrieg Soldat gewesen. Davon erzählte er häufig, so wie alle Erwachsenen damals. In Russland sind ihm eines Nachts in eisiger Kälte die Zehen abgefroren. Und wenn wir dann beide dasaßen, mit hängenden Köpfen, weil er wieder davon erzählt hatte, fing er erst pfeifend, dann singend an, aus einer Operette zu improvisieren, und ich sang und klatschte mit. Mein Vater freute sich immer, wenn er mich mit seinen Gesängen und den nachgesprochenen Dialogen zum Lachen brachte. „Warum bist du kein Schauspieler geworden, Papa?“, fragte ich ihn oft. Dann antwortete er immer: „Ach Kind, mein Kind“ und wirkte traurig. Traurigkeit konnte er aber nie lange im Raum stehen lassen. Sie musste schnell überspielt werden. Sein Kriegstrauma hat er wie die meisten in der Zeit nie verarbeitet. Dafür gab es ja viel zu viel zu tun. Ständig, eigentlich immer, gab es etwas zu tun, deshalb musste ich auch früh in unserem Kramerladen mithelfen. So wie die ganze Familie. Papa und ich waren immer ein Team und er war nicht nur Vater, sondern auch Mutter für mich, was damals geradezu revolutionär war. So streng wie die typischen Mutter-Vater-Rollen damals aufgeteilt waren. Vor allem in Baden-Württemberg.
Aufgeteilt war alles. Die Arbeit, das Geld und natürlich das Essen. Um 7 Uhr gab es Frühstück. 10 Uhr Vesper inklusive erstes Bier. Um 12 Uhr Mittagessen, immer frisch gekocht. Um 15 Uhr Kaffee und Kuchen und um 18 Uhr Abendbrot. Hunger oder nicht, daran war nicht zu rütteln. Es wurde gegessen. Dieser Essens-Rhythmus wurde so fleißig und genau eingehalten wie die Kehrwoche, das abendliche Gebet, der sonntägliche Kirchgang und die wöchentliche Beichte. So waren nun mal die Regeln. Die Regeln des Erwachsenen-Lebens, das ich für mich später so ganz anders gestalten sollte.
Schon als Fünfjährige in der Backstube meines Vaters hatte ich nicht das Gefühl, in diesen Rhythmus des Lebens hineinzupassen. Nicht, weil ich in irgendetwas besser war als die anderen im Dorf. Nein. Eher, weil ich mich gruselte beim Gedanken, diesen Rhythmus für mein eigenes Leben fortzuführen. Das war einfach nichts für mich.
Die Erwachsenen schienen nie darüber nachzudenken, was das Leben noch bereithielt. Mehr als das gehorsame Arbeiten, das disziplinierte Sparen, um dann getreu „schaffe, schaffe, Häusle baue“ alles immer in diesem immer gleichen Kreislauf zu halten. Schlafen, essen, arbeiten, putzen, beten.
Da musste doch noch mehr sein! Die Musik der 60er-Jahre, die ich im Radio hörte und auf Kassetten aufnahm, ließ mich wie durch ein Fenster in die Welt schauen. Mit all ihren Tönen, Farben und Visionen. Manchmal lief ich beim Spielen alleine in einen kleinen Wald, der an Felder grenzte. Ich kletterte auf einen Baum und sah die weiten Kornfelder vor mir und stellte mir vor, dies sei meine Bühne, auf der mich alle sehen und mir applaudieren konnten. Sobald die Kirchenglocken läuteten, musste ich mich jedoch wieder beeilen – die nächste Mahlzeit wartete. In unserem Dorf kannten sich die 800 Einwohner untereinander, halfen einander und jeder tratschte über jeden. Als ich geboren wurde, hieß es: „Der Herr Altinger hat wieder nur ein Mädchen hingekriegt.“
Читать дальше