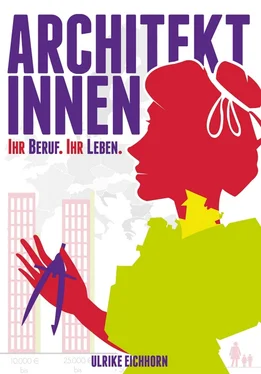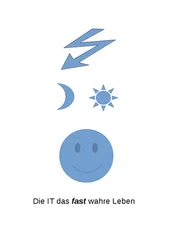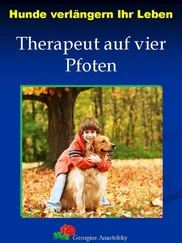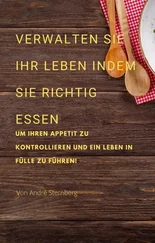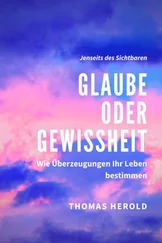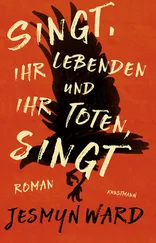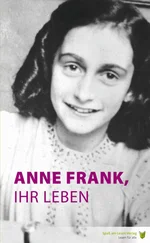Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es zahlreiche Frauen, die sich als Wegbereiterinnen für das Frauenstudium in Deutschland einen Namen machten. Zu ihnen gehörte Katharina Charlotte Friederike Auguste Windscheid (1859 — 1943), die im Jahr 1895 die Doktorwürde im Fach Philosophie erhielt. Zu nennen sind ebenfalls Marianne Theodore Charlotte v. Siebold Heidenreich, (1788 — 1859, Doktorwürde in der Entbindungskunst 1817 in Gießen), Schriftstellerin Daniel Jeanne (Johanna) Wyttenbach, (1773 — 1830, philosophische Ehrendoktorwürde 1827, Marburg), Elsa Neumann (Physik, 1899, Berlin) und Clara Immerwahr (Chemie, 1900, Breslau). Sie alle machten ihrem Geschlecht alle Ehre, auch wenn sie durch ihr Tun zunächst keine Veränderungen für die allgemeinen Zulassungsbedingungen erreichte. 1888 hatte der Allgemeine Deutsche Frauenverein eine Petition beim preußischen Abgeordnetenhaus eingereicht, um die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und zur wissenschaftlichen Lehrerinnenausbildung zu erreichen. Im selben Jahr hatte auch der Frauenverein Reform die Zulassung für Frauen zu allen Fächern gefordert. Dennoch konnten diese Initiativen keine unmittelbaren Erfolge verbuchen. Das pragmatische Vorgehen einzelner Frauen, eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, sollte sich als erfolgreich erweisen. Der erste Schritt dazu war die Zulassung als Gasthörerin. So war Hope Bridges Adams Lehmann die erste Frau in Deutschland, die ihr Medizinstudium als Gasthörerin begann und die es letztendlich mit einem Staatsexamen abschloss. Durch diese Hintertür gelang vielen der Zugang zu den Universitäten. Was als Ausnahme begann, wurde schließlich schnell zur Regel. Die weitaus meisten Gasthörerinnen konnte die Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin verzeichnen. Jüdische Frauen, besonders solche aus dem Russischen Reich, waren unter diesen ersten Jahrgängen ausnehmend zahlreich vertreten. An der Medizinischen Fakultät stellten sie sogar die Mehrheit der Studentinnen. Viele dieser Frauen hatten zuvor in der Schweiz studiert, konnten also schon Studienleistungen vorweisen. Die guten Erfahrungen, die die Schweizer Universitäten mit studierenden Frauen gemacht hatten, waren ein wichtiges Argument, die deutschen Hochschulen für Studentinnen zu öffnen. So betrachtet ist die Einführung des Frauenstudiums in Deutschland den vielen russisch-jüdischen Frauen zu verdanken, die an Schweizer Universitäten studiert hatten. Die bekannteste unter ihnen ist Rosa Luxemburg (1871 — 1919), die an der Universität Zürich Volkswirtschaft studierte. Ein anderes Beispiel ist die Philosophin Anna Tumarkin (1875 — 1951), die erste Professorin an der Universität Bern. Im Jahr 1906 wurde sie Honorarprofessorin und 1908 Extraordinaria. Sie war die erste Professorin Europas, mit dem Recht, Doktoranden und Habilitanden zu prüfen. Zudem war sie die erste Frau, die einen Sitz im akademischen Senat hatte.
Nach und nach öffneten sich die deutschen Universitäten, und noch vor der Jahrhundertwende wurde vielen Frauen der volle Zugang zu allen Studiengängen ermöglicht. Ab dem Sommersemester 1900 waren Frauen an nahezu allen Landesuniversitäten als „ordentliche Studierende“ zugelassen. Unter ihnen war auch die jüdische Medizinstudentin und spätere Ärztin Rahel Straus (1880 — 1963). Sie gilt es insofern zu erwähnen, da sie nicht nur die erste Abiturrede einer jungen Frau in Deutschland hielt (1899), als erste Medizinstudentin an der Universität Heidelberg eingeschrieben war, sondern sich auch aktiv in der Vereinigung Studierender Frauen engagierte. 1902 bestand sie das Staatsexamen mit Erfolg, promovierte 1907 und setzte ihren beruflichen Weg mit der Eröffnung einer gynäkologischen Praxis 1908 fort. Mit ihrem Ehemann, einem promovierten Juristen, bekam sie fünf Kinder. Auch mit Familie und Kindern setzte sie ihren beruflichen Weg beständig fort, kämpfte für die Abschaffung des Paragrafen 218 und engagierte sich im jüdischen Frauenbund. Nach dem Tod ihres Mannes 1933 emigrierte Rahel Straus nach Palästina, arbeitete dort weiter als Sozialarbeiterin und gründete 1952 die israelische Gruppe der Woman´s International League for Peace and Freedom, deren Ehrenpräsidentin sie bis zu ihrem Tod 1963 blieb.
Neben Erfolgsgeschichten soll nicht unerwähnt bleiben, dass es auch traurig endende Lebensläufe von Akademikerinnen gab, die zwar zuversichtlich begannen, im Laufe der Jahre aber in die Mühlen des Zeitgeschehens gerieten. So geschehen mit Emilie Kempin-Spyri (1853 — 1901), die erst nach der Geburt ihrer drei Kinder (1876 bis 1879) die Reifeprüfung ablegte. Im Anschluss schrieb sie sich 1885 an der Staatswissenschaftlichen Fakultät Zürich zum Jurastudium ein, promovierte mit 34 Jahren 1887 und bewarb sich auf eine Dozentenstelle. Aufgrund ihres Geschlechts wurde sie sowohl von der Universität als auch bei der Zulassung zur Anwältin abgelehnt. Wütend ob dieser Rückständigkeit überzeugte sie ihren Mann, mit ihr und den Kindern 1888 in die USA auszuwandern. Dort fand sie allerdings ähnliche Bedingungen vor. Durch eine glückliche Fügung lernte sie eine wohlhabende New Yorkerin kennen, die sie unterstützte, eine Schule für Anwältinnen zu gründen. (Die „Emily Kempin-Law-School“ ermöglichte in späteren Jahren vielen Frauen eine Ausbildung zum Anwaltsberuf.) Emily war die erste Frau, die an einer amerikanischen juristischen Fakultät lehren durfte. Sie hielt Vorträge, verfasste Aufsätze für Zeitschriften und engagierte sich in der Frauenbewegung. Doch sie war hin- und hergerissen zwischen beruflichem Erfolg und familiären Herausforderungen. Ihr Mann war mit zweien ihrer Kinder 1889 wieder in die Schweiz zurückgekehrt, da er in den USA nicht Fuß zu fassen vermochte. Schuldgefühle der jüngsten Tochter gegenüber wegen vermeintlicher mangelnder Betreuung und eine Krankheit ihres Sohnes in Zürich veranlassten sie 1891 zur Rückkehr in die Schweiz. Dort bewarb sie sich für eine Dozentenstelle. Sie gründete einen Frauenrechtsverein und engagierte sich mit Zeitungsartikeln und Vorträgen für die Sache. Das Glück stand nicht auf ihrer Seite, denn der finanzielle Erfolg blieb aus und ihre Ehe scheiterte. 1895 zog Kempin zunächst allein nach Berlin, holte ihre Kinder nach und verliebte sich in einen Privatlehrer. Dieser zog ihr allerdings ihre jüngste Tochter vor und zeugte mit ihr ein Kind. Emilie erlitt einen Nervenzusammenbruch, lebte seit 1897 in einer Heil- und Nervenanstalt und hoffte auf Erholung. Doch die Ärzte hielten sie für geisteskrank und empfahlen dem Ehemann, für sie die Vormundschaft zu übernehmen. Emilie versuchte vergeblich, aus der Anstalt zu fliehen. Sie wurde in eine Baseler Irrenanstalt überführt, wo sie einsam von Familie und Freunden abgeschottet dahinvegetierte, bis sie 1901 mit achtundvierzig Jahren starb.
Ein ähnliches Schicksal erlitt Camille Claudel (1864 — 1943). Die Bildhauerin lebte und arbeitete an der Seite des berühmten Auguste Rodin. Auch sie wurde diskriminiert und in ihrem künstlerischen Schaffen behindert, weil sie sich von Rodin getrennt hatte. Claudel begann zu trinken und vereinsamte. Ihre Familie veranlasste eine gewaltsame Überführung in eine Irrenanstalt, wo sie mehr als 30 Jahre verbrachte, bevor sie am 19. September 1943 starb.
Ungeachtet dieser betrüblichen Lebenswege konnten im Laufe der Jahre und aufgrund der Bemühungen zahlreicher Vorreiterinnen viele Frauen ermutigt werden zu studieren. Im Jahre 1913 waren etwa 8 Prozent aller Studierenden weiblichen Geschlechts. Ihr Anteil stieg bis 1930 auf etwa 16 Prozent. So können wir ab der Jahrhundertwende bis zum Beginn der nationalsozialistischen Strömungen zahlreiche Frauenbiografien lesen, die in akademischen Berufen erfolgreich waren. Zu ihnen gehörten auch zahlreiche Architektinnen:
Emilie Winkelmann, (1875 — 1951) wurde als Tochter eines Lehrers in Aken an der Elbe geboren. Sie erlernte das Handwerk des Zimmerers und half als junges Mädchen im Baugeschäft ihres Großvaters. Nach Abschluss der Schule gelang es ihr− obwohl Frauen zu dieser Zeit in Preußen noch keinen Zugang zu Hochschulen hatten− eine ausnahmsweise Zulassung zur Technischen Hochschule Hannover zu bekommen: Sie hatte sich eines Kniffs bedient und ihren Antrag mit E. Winkelmann unterzeichnet. Die Zulassung zum Staatsexamen jedoch versagte man ihr. 1906 zog Emilie Winkelmann nach Berlin, arbeitete in einer Baukanzlei und eröffnete als erste selbstständige Architektin Deutschlands ihr eigenes Büro. 1907 nahm sie an einem Wettbewerb für ein Theatergebäude nahe des Strausberger Platzes teil. Mit dem ersten Preis erhielt sie den Bauauftrag. Nach erfolgreicher Umsetzung des Projektes folgten Aufträge vermögender Berliner Bürger. Emilie Winkelmann plante Villen, Land-, Herren- und Mietshäuser. Nicht nur in Berlin und Umgebung, auch in Pommern und Schleswig-Holstein sind Spuren ihrer Baukunst zu sehen. In der Leistikowstraße, Berlin, entstand 1909 bis 1910 nach ihren Plänen das Leistikowhaus, ein großes städtisches Mietshaus, das heute unter Denkmalschutz steht. Zu ihren bedeutendsten Bauten zählt das, in den Jahren 1914 bis 1915 unter dem Protektorat der Kaiserin Auguste Viktoria errichtete Viktoria-Studienhaus, heute als Ottilie-von-Hansemann-Haus bekannt, in der Otto-Suhr-Allee, ebenfalls in Berlin. Äußerlich der Architektur des ausgehenden 18.Jahrhunderts angepasst, basierte diese damals einmalige Wohn- und Bildungsstätte für Berliner Studentinnen auf den reformerischen Ideen der Frauenbewegung. Leider wurde Winkelmanns Karriere ab 1916 durch eine schwere chronische Erkrankung eingeschränkt, sie litt zunehmend an Schwerhörigkeit und Desorientierung. Bedingt durch die Krankheit und die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs gelang es der Architektin nicht, an ihren früheren beruflichen Erfolg anzuknüpfen. Sie versuchte mit Projekten im Kleinwohnungsbau Anschluss an die Entwicklung zu bekommen, aber da sie sich weder in den 1920er- noch in den 1930er-Jahren parteipolitisch betätigte, blieben öffentliche Aufträge aus. So konzentrierte sie sich auf die Modernisierung von Guts- und Herrenhäusern, dem Umbau von Schloss Grüntal bei Bernau und nach dem Krieg dem Wiederaufbau und der Unterbringung von Flüchtlingen. Emilie Winkelmann wurde im Familiengrab in Aken beigesetzt. Die von ihr projektierten Villen und Landhäuser gelten auch heute noch als bemerkenswert modern und ebenbürtig denen von berühmten Architekten wie Alfred Messel und Hermann Muthesius. Viele von ihr entworfene Gebäude, die meist den individuellen Bedürfnissen der Bewohner angepasst waren, stehen heute unter Denkmalschutz.
Читать дальше