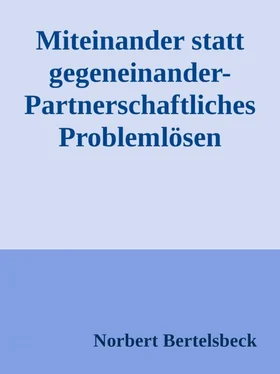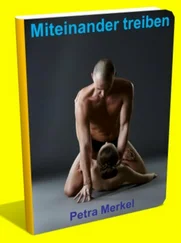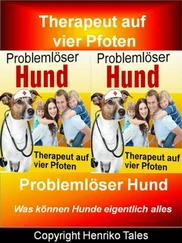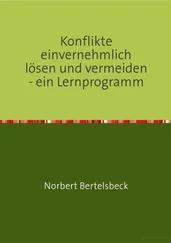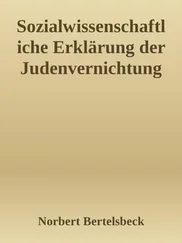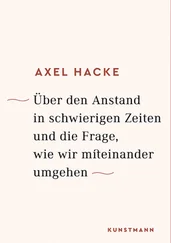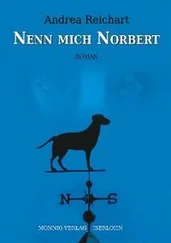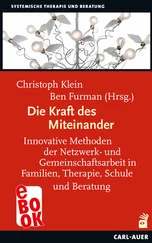Vater: Du meinst, wenn der Mike eine Ausbildung ohne Abitur hat, dann kannst Du das auch so machen?
Jessica: Ja, der verdient schon viel Geld.
Vater: Du musst Dich zu sehr einschränken, wenn Du weiter zur Schule gehst?
Jessica: Ja
Vater: Ich habe nur die Sorge, dass Du es hinterher bereuen könntest, kein Abitur gemacht zu haben.
Jessica: Wieso?
Vater: Du hast mit Abitur mehr berufliche Möglichkeiten, als wenn Du Dich jetzt 1 ½ Jahre vor dem Abschluss um einen Ausbildungsplatz bemühst. Du kannst zudem studieren.
Jessica: Ich will nicht studieren. Dann habe ich ja noch länger kein Geld.
Vater: Dir ist das Geldverdienen im Augenblick so wichtig, dass für Dich ein Studium nicht in Frage kommt. Es kann nun aber sein, dass Du im nächsten Jahr vielleicht schon anders denkst und dann Deine Entscheidung bereust.
Jessica: Das glaub’ ich nicht. Und im übrigen kann ich ja das Abitur auch noch
nachmachen, wenn ich es tatsächlich später haben will.
Vater: Dir stehen auch später noch alle Wege offen?
Jessica: Ja
Vater: Es kann jedoch sein, dass es dann mühseliger wird, wenn Du neben
Deinem Beruf noch das Abendgymnasium besuchst.
Jessica: Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Vollzeitschule zu besuchen. Ich weiß das von der Tanja.
Vater: Ein späteres Abitur muss Deiner Meinung nach nicht mühseliger sein. Das mag schon sein. Nur bist Du dann schon einige Jahre älter. Wenn Du dann noch studieren willst, dann kann es sein, dass Du als älterer Hochschulabsolvent schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hast.
Jessica: Trotzdem stinkt es mir, dass ich sehr wenig Geld habe. Ich bin ja durch den Mike viel mit Leuten zusammen, die viel Geld haben, weil die arbeiten. Die können sich viel mehr leisten als ich.
Vater: Es ist für Dich frustrierend zu sehen, dass andere mehr ausgeben können.
Jessica: Ja, genau.
Vater: Hättest Du mehr Geld, wäre es kein Problem für Dich, weiter zur Schule zu gehen.
Jessica: Ich bin mir nicht sicher.
Vater: Du meinst, es könnten noch weitere Gründe vorliegen?
Jessica leise: Ich weiß es nicht so genau.
Vater: Du möchtest jetzt nicht weiter darüber sprechen?
Jessica: Ja
Vater: Wenn Du Dich dafür entscheidest, weiter zur Schule zu gehen, könnte ich mit Mama einmal darüber reden, ob wir Dein Taschengeld aufbessern können. Solltest Du noch über andere Dinge mit mir sprechen wollen, so stehe ich gerne zur Verfügung.
Jessica: In Ordnung.
Die Wirksamkeit von Beratung
Ob eine Beratung erfolgreich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die Bestandteil einer Theorie über menschliches Handeln sind:
- Für wie realistisch werden die genannten Folgen des Handels gehalten? (Handlungsergebniserwartung)
Ist die andere Person der Ansicht, dass die genannten Folgen nicht eintreten, so wird sie ihr Verhalten nicht ändern.
Beispiel:
Die Eheleute Hartmann benennen als eine negative Folge einer Abtreibung, dass das Seelenheil ihrer neunzehnjährigen Tochter Kathrin gefährdet wird. Diese hat sich jedoch schon vor zwei Jahren vom Glauben abgewendet, d. h. sie bezweifelt, dass es einen Gott gibt.
- Wie unerwünscht werden die Folgen angesehen? (Stärke negativer Valenz von Sachverhalten)
Erwartet der andere die genannten Folgen, empfindet diese jedoch als wenig unangenehm, so wird er sein Verhalten nicht ändern.
Beispiel:
Frau Geschwind isst seit einiger Zeit häufig Schokolade. Ihr Mann weist sie darauf hin, dass sie dadurch an Gewicht zunehme. Dies ist für sie jedoch nicht negativ, da ihre Freundinnen ebenfalls dicker sind und sie davon ausgeht, dass ihr Mann sie auch dann noch attraktiv findet, wenn sie ein wenig molliger ist.
- Wann werden die Folgen erwartet? (psychologische Distanz zu unerwünschten Ereignissen)
Erwartet der andere unerwünschte Ereignisse, treten diese jedoch erst in weiter Zukunft ein, so kann dies ebenfalls dazu führen, dass er sein Verhalten nicht ändert.
Beispiel:
Wenn der Vater seinen Sohn Christian darauf hinweist, dass er später einmal Lungenkrebs bekommen könne, wenn er weiter raucht, dann ist dieses Ereignis für den Sohn in so weiter Zukunft, dass es psychisch nicht von Bedeutung ist.
- Ob dann letztendlich der andere ein unerwünschtes Verhalten ändert, wenn er in naher Zukunft bei dessen Weiterführung negative Folgen erwartet, ist auch abhängig davon, welches Ausmaß an Bedürfnisbefriedigung sein unerwünschtes Verhalten ihm bringt.
Beispiel:
Christian fühlt sich sehr entspannt, wenn er eine Zigarette raucht. Für ihn hat deshalb das Argument, dass er ja durch sein Rauchen auf andere Dinge verzichten müsste, keine große Bedeutung.
Eine Beratung kann jedoch zusätzlich auch, wie oben erwähnt, über alternative Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung informieren. Der andere kann sich dann für eine alternative Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung entscheiden, wenn er den erwarteten Nutzen der neuen Handlung höher einschätzt als den für das unerwünschte Handeln.
Beispiel:
Der Vater erzählt Christian, dass er sich statt mittels des Zigarettenrauchens auch durch Autogenes Training entspannen könne. Der Sohn nimmt das zunächst nur widerwillig zur Kenntnis. Als ihm aber sein Freund Tommy einige Tage später davon erzählt, dass er an einem Entspannungstraining teilnehmen werde, das in der Volkshochschule angeboten wird, entschließt er sich, sich ebenfalls anzumelden.
Ich-Botschaften
Sind Sie der Ansicht, dass die Handlungen eines anderen für ihn nachteilige Folgen hat, so können Sie statt einer Beratung auch eine erklärende Ich-Botschaft formulieren mit den folgenden Komponenten:
- Das unannehmbare Verhalten des anderen wird beschrieben.
- Die für ihn erwarteten negativen Folgen werden benannt.
- Das Ausmaß der Besorgnis wird mitgeteilt.
Beispiel:
„Wenn Du die Schule 1 ½ Jahre früher beendest, befürchte ich, dass Du keine Lehrstelle bekommst.“
Eine Beratung ist im Prinzip eine verlängerte erklärende Ich-Botschaft und stellt wegen ihrer Länge eine intensivere Beeinflussung dar. Eine andere Form von Ich-Botschaft ist die zweiteilige, die das Verhalten anspricht und die dadurch ausgelöste Empfindung.
Beispiel:
Ich bin entsetzt, wenn Du die Schule abbrichst.
Vorbild
Während sich die oben genannten Interventionsformen alle auf das Vorliegen von Wertkonflikten bezogen, führt das „Vorbild sein“ dazu, dass Wertkonflikte vermieden werden. Neben dem Vorbild lassen sich dabei als weitere Voraussetzungen für die Übernahme von Werten eine positive emotionale Beziehung zum anderen sowie eine Verstärkung von werthaftem Verhalten benennen (vgl. hierzu u. a. Banduras, „Lernen am Modell“). Von großer Bedeutung ist diese Interventionsform im Eltern-Kind-Verhältnis.
Beispiel:
Die Eltern eines Kindes legen Wert darauf, dass dieses anderen Menschen gegenüber höflich sein soll. Das drückt sich ihrer Ansicht nach auch darin aus, dass man nach dem Essen erst noch einmal sitzen bleibt, wenn andere noch essen. Sollen Kinder nun ein solches Verhalten übernehmen, so sollten Eltern selbst nach dem Essen noch etwas sitzen bleiben, wenn andere noch speisen.
sich selbst ändern
Während die bisherigen Interventionen auf eine Beeinflussung des Verhaltens von anderen gerichtet sind, wird hier eine Lösung des Wertkonflikts vorgeschlagen über eine Veränderung der eigenen Person im Sinne der Akzeptanz von Unterschieden oder gar der Übernahme eines Werts eines anderen.
Dem Ziel einer Änderung der Einstellung gegenüber Wertkonflikten dienen u. a. die Gordon-Trainings. Daneben lassen sich Wertvorstellungen verändern mittels eines offenen Dialogs (über Aktives Zuhören die Ansicht des anderen verstehen lernen) oder Selbstüberprüfung (z. B. sich mit der Genese eigener oder fremder Wertvorstellungen befassen oder sich der Relativität von Wertvorstellungen bewusst werden) (vgl. Breuer, Karlpeter: „Handbuch für Kursleiterinnen und Kursleiter im Gordon-Familientraining“, 1997, 10, 8ff).
Читать дальше