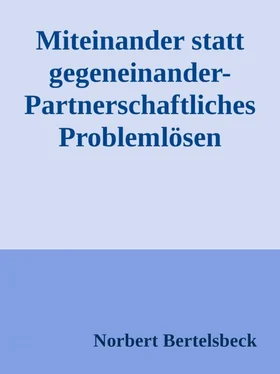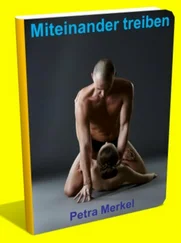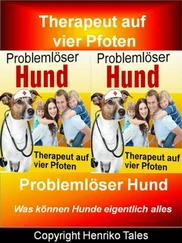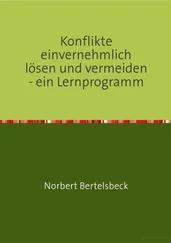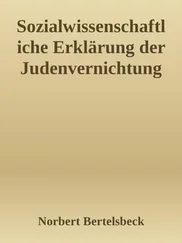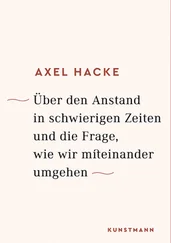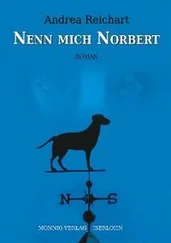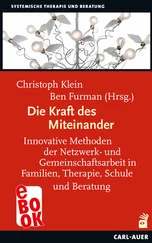Die andere Person hat ein Problem:
- Ich bin primär an dem Anliegen des anderen interessiert
- Ich höre zu
- Ich berate
- Dem anderen zu einer eigenen Lösung verhelfen
- Ich akzeptiere die Lösung des anderen
Ich habe ein Problem mit einem anderen:
- Ich bin primär an meinem Anliegen interessiert
- Ich rede
- Ich beeinflussse
- Ich finde selbst eine Lösung
- Ich muss selbst mit der Lösung zufrieden sein
Deutlich wird, dass ich eine eher passive Rolle einnehme, wenn der andere ein Problem hat, und eine eher aktive, wenn ich ein Problem habe.
Wir haben wechselseitig ein Problem: Bedürfniskonflikt
(1) Bedürfniskonflikt (Definition)
Ein Bedürfniskonflikt liegt vor, wenn
- für Sie das Verhalten eines anderen unannehmbar ist, weil es ein Bedürfnis beeinträchtigt,
- der andere dieses weiß
- und trotzdem an seinem Verhalten festhält.
Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie eine
- Konfrontierende Ich-Botschaft gesandt haben,
- der andere hierauf mit Widerstand reagiert,
- Sie daraufhin umschalten und
- der Widerstand andauert.
(siehe „Handbuch für Kursleiterinnen und Kursleiter im Gordon-Familientraining“, Hg. Karlpeter Breuer, VI, 16)
Beispiele für Bedürfniskonflikte:
- Ihr Sohn hat das Fernsehen sehr laut gestellt. Sie werden dadurch in Ihrer Konzentration fürs Zeitung lesen gestört. Sie haben das Ihrem Kind schon mehrmals gesagt. Auch wenn zwischenzeitlich das Fernsehen daraufhin zunächst leiser gestellt wurde, änderte sich dieses dann wieder zur alten Lautstärke.
- Ihr Mann beteiligt sich nicht an den Arbeiten im Haushalt. Stattdessen besucht er Freunde, obgleich Sie Ihren Mann schon mehrmals gebeten haben, Ihnen zu helfen.
- Ihr Freund raucht häufig während des gemeinsamen Fernsehens, obwohl Sie ihm schon mehrmals gesagt haben, dass Sie den Zigarettenqualm nicht ertragen können.
- Ihr Arbeitskollege telefoniert viel privat. Sie erledigen dadurch Ihre Arbeit langsamer. Das haben Sie Ihrem Kollegen auch schon mitgeteilt. Das Verhalten von ihm hat sich jedoch nicht geändert.
Eine genauere Umschreibung des Bedürfniskonflikts
Es kann die Frage gestellt werden, warum eine andere Person an ihrem Verhalten festhält, obgleich sie weiß, dass sie Ihnen damit Schaden zufügt. Hier bieten sich zwei Erklärungen an:
- Die Person möchte einmal auf ihr Verhalten nicht verzichten, weil sie damit eine Bedürfnisbefriedigung erreicht und sie deshalb Ihre Deprivation billigend in kauf nimmt.
- Eine Person zieht aus ihrem Verhalten zwar keine Befriedigung, weiß aber, dass sie Sie damit schädigen kann. Es liegt dann eine Aggressionshandlung vor.
Ein Bedürfniskonflikt im engeren Sinne ist nur gegeben, wenn das unannehmbare Verhalten einer anderen Person für diese einen Nutzen hat. Nur in einem solchen Fall ist es dann sinnvoll, die (u. a.) Niederlagelose Methode der Konfliktlösung anzuwenden. Liegt eine Aggressionshandlung vor, so wird die Person, die ein unannehmbares Verhalten zeigt, nicht kooperieren wollen, da ihr Ziel ja gerade darin besteht, Ihnen einen Schaden zuzufügen. Die Situation stellt sich dann so dar, dass diese Person mit Ihnen ein Problem hat. Angeraten ist es dann, über das Aktive Zuhören mit dem anderen ins Gespräch zu kommen, um den Grund für das Ziel der Schädigung zu erfahren. Dieser besteht dann häufig darin, dass Sie selbst der Person gegenüber zuvor ein Verhalten gezeigt haben, dass diese deprivierte. Möglicherweise ist dann zunächst einmal Wiedergutmachung angezeigt, sofern Sie selbst der Meinung sind, dass die Deprivation unberechtigt war.
Ein Bedürfniskonflikt liegt nicht vor
Es wurden Elemente genannt, die vorliegen müssen, damit von einem Bedürfniskonflikt gesprochen werden kann. Fehlen Bestandteile, so liegen statt eines Bedürfniskonflikts andere Sachverhalte vor:
- Meinungsunterschiede: Fehlen eines bedürfnisbeeinträchtigenden Verhaltens
Eine Person äußert weiter eine Meinung, die Ihnen nicht gefällt, obgleich die Person dieses weiß.
Sie äußern Ihrer Freundin gegenüber, dass es das Letzte ist, mit Jeans in ein Konzert zu gehen. Diese widerspricht Ihnen lebhaft.
- Legitimes unannehmbares Verhalten: Ein Verhalten mit einer Beeinträchtigung liegt vor, diese wird jedoch als gerechtfertigt angesehen.
Ein Fall von ungewohnter Kindeseinsicht: Horst hat seiner Mutter 10 Euro aus dem Portemonnaie gestohlen. Als die Mutter das bemerkt, muss er das Geld zurückzahlen und erhält einen Tag Stubenarrest. Horst ist der Meinung, dass die Strafe gerechtfertigt ist.
- Missverständnis: Ein Verhalten mit einer Beeinträchtigung liegt vor, der andere weiß jedoch nicht, dass sein Verhalten beeinträchtigend ist.
Die Ehefrau hat ihrem Mann nichts davon gesagt, dass es sie stört, wenn er so häufig seine Eltern besucht.
Ein gelöster Konflikt
Ausgehend vom dargestellten Konfliktbegriff ist ein Konflikt zunächst einmal als gelöst zu betrachten, wenn ein unannehmbares Verhalten in der Zukunft unterlassen wird, nachdem es zuvor auch trotz der Missbilligung der geschädigten Person weiter ausgeführt wurde.
So besteht ein Konflikt nicht mehr, wenn der Sohn in Zukunft das Fernsehen leiser macht, obwohl er zuvor die Lautstärke des Fernsehens, trotz des Wissens um die Missbilligung der Mutter, nicht verändert hatte.
Eine Anmerkung soll zum Schluss noch erfolgen: Das Unterlassen des Verhaltens kann darauf beruhen, dass eine Person Macht ausübt, oder es kann auf freiwilliger Grundlage erfolgen.
So kann der Sohn das Fernsehen leiser stellen, weil seine Mutter ihm Stubenarrest angedroht hat für den Fall, dass er die Lautstärke nicht verändert. Der Sohn kann jedoch die Lautstärke auch ändern, weil er zur Einsicht gekommen ist, mit Kopfhörer noch besser das im Fernsehen Gesprochene zu verstehen als ohne Hörer.
Liegt Machtanwendung vor, so wird das Verhalten wieder ausgeführt, wenn die andere Person keine Macht ausüben kann. Es ist deshalb sinnvoll, davon zu sprechen, dass der Konflikt durch Macht in den Hintergrund gedrängt, aber nicht gelöst wurde.
(2) nicht angemessene Konfliktlösungsmethoden
Welche Möglichkeiten können Sie nun ergreifen, um den Bedürfniskonflikt zu lösen? Gordon unterscheidet zwischen angemessenen und nicht angemessenen Konfliktlösungsmethoden. Zunächst wird mit einem Beispiel auf unangemessene Methoden der Konfliktlösung eingegangen.
Stellen Sie sich vor, Sie lesen gerade ein spannendes Buch im Wohnzimmer und werden durch laute Fernsehgeräusche, die aus dem Kinderzimmer kommen, gestört. Sie gehen daraufhin ins Kinderzimmer und bitten Ihren Sohn, das Gerät leiser zu stellen. Nach anfänglich geringerer Lautstärke hören Sie alsbald wieder lautes Sprechen. Stark verärgert hierüber, stürzen Sie in das Kinderzimmer und schalten das TV-Gerät ab. Zugleich untersagen Sie Ihrem Sohn das Fernsehen für den ganzen Tag.
Eine solche Reaktion auf störendes Verhalten wird hier mit „machtbezogen“ bezeichnet, weil Sie sich in dem Konflikt durchsetzen. Als Machtmittel kommen dabei Belohnungen oder, wie im vorliegenden Beispiel, Bestrafungen in Betracht. Beide Verhaltensweisen werden hier abgelehnt, weil sie in ihrer Wirksamkeit begrenzt sind und zugleich die Beziehungen verschlechtern:
Mangelnde Wirksamkeit
Gordon (Gordon, Thomas: „Die Neue Familienkonferenz“, 2000, Kapitel 2 - 5) hat in Bezug auf Erzieherverhalten die Auswirkungen von Belohnung und Bestrafung unter Zuhilfenahme von Untersuchungsergebnissen verhaltenstheoretischer Art dargestellt.
siehe hierzu auch den Aufsatz in diesem Buch: „Einige handlungstheoretische Überlegungen zu Inhalten des Gordonschen partnerschaftlichen Beziehungskonzepts mit dem Schwerpunkt auf partnerschaftliche Erziehung“; zur Wirkung von Belohnung und Bestrafung aus verhaltenstheoretischer Sicht siehe u. a. Holland, James G.; Skinner B. F.: „Analyse des Verhaltens“, München, Berlin und Wien 1974).
Читать дальше