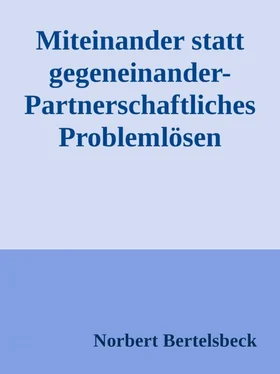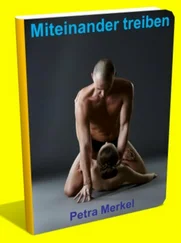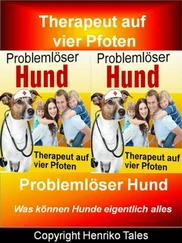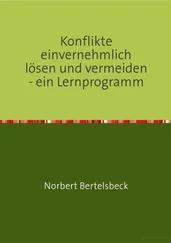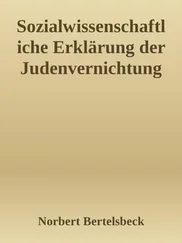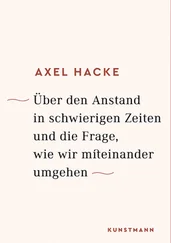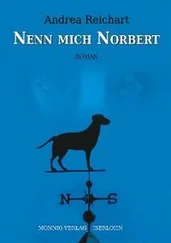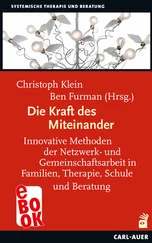1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 - Mangelnde Freizeit
Unannehmbare Verhaltensweisen Dritter führen häufig dazu, dass durch sie Tätigkeiten ausgeübt werden müssen, die zu weniger Freizeit führen.
Beispiel:
Die Wohnung muss noch einmal geputzt werden. Dadurch ist keine Zeit mehr für das Lesen eines Buchs.
- Anstrengung
Tätigkeiten, die als Folge des Auftretens einer negativ bewerteten Verhaltensweise verrichtet werden müssen, können mit Anstrengung verbunden sein oder aus anderen Gründen als unangenehm erlebt werden.
Beispiel:
Das Putzen wird als anstrengend erlebt, ebenso wie das Tragen von schweren Einkaufstaschen.
- Zerstören von Gegenständen
Bestimmte Verhaltensweisen können zur Folge haben, dass Gegenstände zerstört werden, an denen man hängt, oder, wenn diese ersetzt werden, dass dann andere Dinge, die man gerne haben würde, nicht gekauft werden können.
Beispiel:
Beim Herumrennen im Wohnzimmer stößt Sven eine wertvolle Vase um, die dadurch zerbricht. Die Vase gehörte den Eltern von Frau W., die deshalb traurig über den Verlust ist. Ein Ersatz dieser Vase führt darüber hinaus dazu, dass eine andere geplante Anschaffung erst einmal zurückgestellt werden muss.
- Körperliche Beeinträchtigung
Sehr häufig sind Verhaltensweisen unangenehm, weil sie die körperliche Befindlichkeit beeinträchtigen.
Beispiele:
Kopfschmerzen aufgrund starken Lärms von der Musikanlage des Ehemannes; ein bestimmter unausstehlicher Geruch als Folge eines verbrannten Essens der Ehefrau (Brechreiz); eine Stauchung des Knöchels als Folge des Herumliegens von Gegenständen; die Reinigung der Toilette, die der Sohn nicht sauber hinterlassen hat, erfolgt mit Ekelgefühlen (Brechreiz).
- allgemein: Verhinderung von Bedürfnisbefriedigung
Beispiel:
Die Mutter möchte ein spannendes Buch lesen und wird gestört durch laute Musik ihres Sohnes.
Sind gerade unterschiedliche spürbare negative Folgen genannt worden, so kann eine Ich-Botschaft auch Folgen enthalten, die nicht den hier angesprochenen entsprechen:
- Die ein unannehmbares Verhalten erleidende Person kündigt hierfür Bestrafung an.
Die Person geht hier nicht auf die eigene Beeinträchtigung ein, sondern benennt Konsequenzen, die sie aus dem Verhalten des anderen zieht.
Beispiel:
Die Mutter sagt zu Jürgen: „Da Du das Fernsehen so laut aufgedrehst hast, darfst Du heute nicht zum Fußballspielen gehen.“
Eine Person kann auch neben der Mitteilung über für sie spürbare negative Folgen zusätzlich Konsequenzen ankündigen:
Beispiel:
So sagt Jürgens Mutter: „Du hast das Fernsehen so laut aufgedreht, dass ich es bis in die Küche gut hören konnte. Deshalb konnte ich die Zeitung nicht lesen. Du darfst deshalb heute nicht zum Fußballspielen.“
- Eine Person verweist auf Beeinträchtigungen für andere.
Führt eine Person ein unannehmbares Verhalten aus, so kann eine andere auf Beeinträchtigungen für Dritte verweisen, anstatt eigene Folgen zu benennen.
Beispiel:
Jürgen dreht das Fernsehen so laut auf, dass seine Mutter beim Lesen gestört wird. Sie spricht dieses jedoch nicht Jürgen gegenüber an, sondern verweist auf den ebenfalls anwesenden Vater, der bei Büroarbeiten gestört würde.
Im Gordon-Beziehungsmodell soll jede Person, die sich beeinträchtigt fühlt, nur für sich selbst sprechen.
Im vorliegenden Beispiel wäre es dann an der Mutter, nur auf ihre eigene Beeinträchtigung zu verweisen. Darüber hinaus müsste der Vater selbst mit dem Sohn sprechen, wenn er sich bei seiner Büroarbeit beeinträchtigt fühlt.
- Die beeinträchtigte Person bewertet das Verhalten des anderen negativ.
Eine Person kann ein Verhalten zwar exakt beschreiben, aber der Beschreibung eine moralische Bewertung nachfolgen lassen.
Beispiel:
Die Mutter sagt zu Jürgen, wenn er das Fernsehen so laut aufdrehe, dann sei das rücksichtslos.
Schließlich sollen die mit den Folgen einhergehenden Empfindungen benannt werden. Die Empfindung, an die man zuerst denkt, wenn man sich durch ein Verhalten geschädigt fühlt, ist Wut und Ärger. Gordon weist jedoch darauf hin, dass diese Empfindungen nachrangige Emotionen sind, denen zumeist andere, primäre Emotionen wie Angst, Erschrecken, Traurigkeit, Entsetzen, Enttäuschung, Verzweiflung etc. zugrunde liegen (u. a. Gordon, „Die neue Beziehungskonferenz“, 2002, 103 f.).
Beispiele:
- Wenn die Mutter ärgerlich ist, weil ihr Sohn Jens eine teure Vase und damit auch ein Erbstück zerbrochen hat, dann ist sie traurig über den Verlust und enttäuscht über das Verhalten, weil sie Jens schon mehrere Male gesagt hatte, dass er im Wohnzimmer nicht herumrennen soll.
- Wenn die Ehefrau unerwartet spät von der Arbeit nach Hause kommt, dann ist ihr Mann beunruhigt darüber, dass etwas passiert ist.
- Wenn der Ehemann zum wiederholten Male viel Geld im Kasino verspielt hat, dann ist seine Frau darüber sehr verzweifelt, weil dieses Geld für nötige Anschaffungen fehlt.
Es wird empfohlen, dass Personen darüber nachdenken, welche Emotionen dem Ärger zugrunde liegen könnten, um diese dann anstelle des Ärges zu benennen: Werden primäre Emotionen benannt, dann führt dieses auch dazu, dass die Bereitschaft steigt, ein unannehmbares Verhalten zu verändern.
Beispiel:
Wenn die Mutter mitteilt, dass sie ärgerlich darüber ist, dass ihre teure Vase von Jens zerbrochen wurde, dann wird er eher in eine Position gebracht, sein Verhalten zu verteidigen, als wenn die Mutter ihm Einblick in ihr Erleben der
Traurigkeit gibt. Die Betroffenheit ist bei ihm größer und damit ggfs. auch die Bereitschaft, demnächst nicht mehr im Wohnzimmer so umherzurennen.
Der Gefühlsausdruck sollte dabei der Gefühlsintensität entsprechen (Lenz, Adams, „Beziehungskonferenz“, 2001, 127).
Betrachten wir noch einmal das Beispiel mit den schmutzigen Schuhen des Kindes, das die Wohnung betritt, nachdem die Mutter diese gerade geputzt hatte. Eine Konfrontierende Ich-Botschaft der Mutter an ihr Kind könnte dann lauten:
„Wenn Du mit nassen Schuhen durch die Diele, Küche und das Wohnzimmer rennst, dann sind Deine Abdrücke auf dem Boden zu sehen. Ich muss dann wieder putzen, obgleich ich immer noch viele andere Dinge zu erledigen habe. Ich komme dann nicht dazu, mich wenigstens für ein paar Minuten hinzusetzen, um mich auszuruhen. Und das macht mich unzufrieden.“
Konfrontierende Ich-Botschaft im Vergleich mit Feedback
Gibt eine Person einer anderen ein Feed-Back über ihr Verhalten, so erhält diese Informationen darüber, wie das Verhalten wahrgenommen wird. Grundregeln des Feed-Backs sind dabei (vgl. hierzu u. a. Proksch, Stefan: Konfliktmanagement im Unternehmen, 2014, 73):
- Verhalten soll beschreibend, konkret und zeitnah erfolgen.
- Feedback soll nützlich sein, d. h. sich auf Dinge beziehen, die der andere auch tatsächlich beeinflussen kann.
- Feedback sollte erfolgen, wenn der andere hierzu fähig und bereit ist.
Die genannten Merkmale (beschreibend, konkret) hinsichtlich des Formulierens von Verhaltensbotschaften sind auch Bestandteil der Konfrontierenden Ich-Botschaft, die darüber hinaus noch weitere Merkmale enthält: Mitteilen von spürbaren Folgen und Empfindungen. Auch Konfrontierende Ich-Botschaften sollten erfolgen, wenn die andere Person hierzu bereit und fähig ist und darüber hinaus ist es sinnvoll, derartige Ich-Botschaften auf Verhaltensweisen zu beziehen, die die andere Person auch ändern kann. Konfrontierende Ich-Botschaften lassen sich so als eine spezifische Form des Feedbacks charakterisieren.
Wann ist eine Konfrontierende Ich-Botschaft nun wirksam?
Es lassen sich verschiedene Gründe benennen:
- Der andere erfährt erst durch die Konfrontierende Ich-Botschaft, dass sein Verhalten für die andere Person negative Folgen hat. Zugleich ist mit dem Verhalten keine nennenswerte Bedürfnisbefriedigung verbunden.
Читать дальше