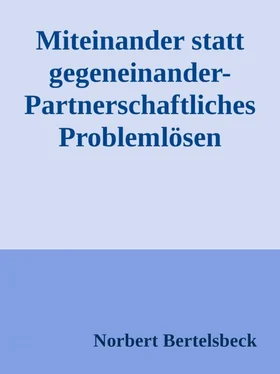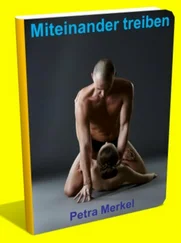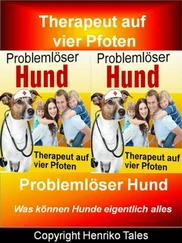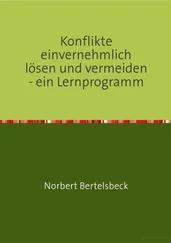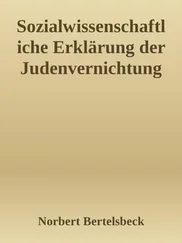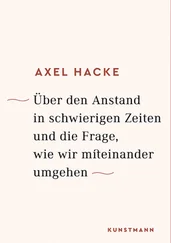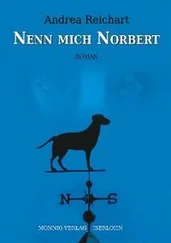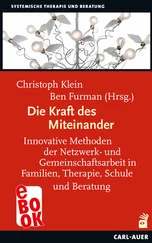1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 (2) Interventionen hinsichtlich unannehmbarer Verhaltensweisen als Folge von Bedürfnisbeeinträchtigungen
Beruht unannehmbares Verhalten darauf, dass entweder eine Bedürfnis- oder aber Wertbeeinträchtigung vorliegt, so soll in diesem Abschnitt auf bedürfnisbeeinträchtigende Verhaltensweisen eingegangen werden. Es werden zunächst nicht angemessene Reaktionen auf Beeinträchtigungen vorgestellt, sodann angemessene.
Nicht angemessene Verhaltensweisen
Gordon (u. a. Gordon, „Die neue Beziehungskonferenz“, 2002, 105 f.) verweist auf Du-Botschaften, die im Zusammenhang mit dem Thema „der andere hat ein Problem“ schon mit Kommunikationssperren bezeichnet wurden. Derartige Botschaften sollen (ebenfalls) beispielhaft dargestellt werden.
Situation:
Ihr Sohn kommt wiederholt mit schmutzigen Schuhen vom Spielplatz und stürmt in die Wohnung, die Sie gerade geputzt haben. Hierauf können Sie in verschiedener Weise reagieren:
Eine Lösungsbotschaft setzen
befehlen:
„Jetzt zieh’ sofort Deine Schuhe aus!“
anweisen:
„Zieh’ Dir das nächst Mal Deine Schuhe draußen aus!“
drohen:
„Wenn Du das nächste Mal Deine Schuhe nicht draußen ausziehst, dann kannst Du Dich auf etwas gefasst machen!“
zureden:
„Zieh’ bitte Deine Schuhe aus.“
zuraten:
„Zieh’ Deine Schuhe aus. Dann bleibt der Fußboden sauber.“
moralisieren:
„Du musst Deine Schuhe ausziehen, wenn Deine Mutter es Dir sagt. Sonst bist Du ein ungezogenes Kind.“
Eine herabsetzende Botschaft senden
kritisieren:
„Ich habe Dir schon so oft gesagt, dass Du Deine Schuhe ausziehen sollst. Ich mache alles für Dich, und Du kannst mir nicht einmal einen kleinen Gefallen tun. Was bist Du nur für ein undankbares Kind!“
beschuldigen:
„Du machst mich völlig fertig mit Deiner Art!“
interpretieren:
„Du willst mich mit Deinem Verhalten nur provozieren!“
belehren:
„Warum ziehst Du nicht mal Deine Schuhe aus. Dann wird der Boden auch nicht dreckig.“
Eine indirekte Botschaft senden
sarkastisch sein:
„Vielen Dank dafür, dass ich den Fußboden wieder putzen darf!“
aufziehen:
„Bist Du etwa ein Zauberer, der bei schmutzigen Schuhen keine Abdrücke hinterlässt?“
Du-Botschaften übermitteln dem anderen nur indirekt Empfindungen, die mit seinem Verhalten einhergehen: So kann hinter einer Aussage wie „Du bist so rücksichtslos“ eine Empfindung stehen wie Enttäuschung oder Traurigkeit, Hilflosigkeit, Angst etc.
Welche Wirkungen haben nun Du-Botschaften aus der Sicht des Gordon-Modells? (u. a. Gordon, „Familienkonferenz“, 2000, 121ff)
- Lösungsbotschaften schränken die Freiheit eines Menschen ein, darüber zu bestimmen, wie er sein Verhalten ändern möchte. Er wehrt sich folglich dagegen.
- Herabsetzende Botschaften drücken einen Mangel an Respekt dem anderen gegenüber aus. Sie führen zu Schuldgefühlen und zu einem Verlust an Selbstachtung, ggfs. auch dazu, sich ungerecht behandelt zu fühlen. Dies hat ebenfalls Widerstand zur Folge.
- Indirekte Botschaften drücken einen Mangel an Offenheit aus, und sie können ebenfalls Wirkungen wie bei herabsetzenden Botschaften entfalten (u. a. Gordon, „Lehrer-Schüler-Konferenz“, 2000, 119 f.)
Da Gordon Du-Botschaften ablehnt, soll nun dargestellt werden, in welcher Weise Personen im partnerschaftlichen Beziehungsmodell auf unannehmbares Verhalten von anderen reagieren können.
Angemessene Verhaltensweisen: Die Konfrontierende Ich-Botschaft
Als erstes ist zu sagen, dass auf unannehmbares Verhalten ebenfalls mit einer Botschaft reagiert werden soll. Der Inhalt einer solchen Botschaft unterscheidet sich jedoch von den gerade thematisierten Du-Botschaften. Es soll zunächst dargelegt werden, welchen Kriterien eine solche Botschaft genügen muss:
Die hier als Kriterien für eine wünschenswerte Botschaft formulierten nachfolgenden Sachverhalte werden im Gordon-Familientraining als Auswirkungen der Ich-Botschaft behandelt (vgl. Hg. Breuer, Karlpeter: „Handbuch für Kursleiterinnen und Kursleiter im Gordon-Familientraining“ 1997, V, 13.
- Sie soll zu einer Verhaltensänderung motivieren.
Befehlen und Drohen motivieren zwar auch zu einer Verhaltensänderung, dies jedoch im Sinne der Vermeidung von Bestrafung. Hingegen ist hier von Motivierung auf der Grundlage der Selbstkontrolle die Rede.
- Die Selbstachtung des anderen soll erhalten bleiben.
Dies ist nicht der Fall, wenn andere beschämt, kritisiert, moralisiert oder beschuldigt werden.
- Der andere soll die Möglichkeit erhalten, selbst zur Problemlösung beizutragen.
Dies ist nicht der Fall, wenn befohlen oder gedroht wird.
- Die Beziehung soll nicht beeinträchtigt werden.
Eine Beeinträchtigung findet statt durch unterschiedliche Formen von Du-Botschaften.
Im Gordon-Modell wird davon ausgegangen, dass eine Botschaft mit den nachfolgenden Merkmalen die zuvor genannten Kriterien erfüllt (Gordon, „Die neue Beziehungskonferenz“, 2002, 97ff; Adams, Lenz: Beziehungskonferenz, 2001, 125ff).
Zunächst wird dem anderen mitgeteilt, was mich stört. Damit wird auf das unannehmbare Verhalten Bezug genommen. Es wird unterschieden zwischen einer Verhaltensbeschreibung und Urteilen über ein Verhalten. Letzteres ist zu vermeiden. Ein Verhalten zu beschreiben beinhaltet, diesem keine weiteren Bedeutungen zuzuweisen, als das, was sich beobachten lässt. Eine Verhaltensbeschreibung lässt sich dann von einer Beurteilung dadurch abgrenzen, dass bei letzterer über die Beobachtung hinausgehende Feststellungen getroffen werden.
Ein Beispiel:
Statt dass eine Mutter zu ihrer Tochter sagt: „Ich finde Deine Wäsche in Deinem Zimmer auf dem Boden und dem Bett, im Wohnzimmer auf dem Sofa und in den Sesseln“, spricht sie zu ihr: „Du bist unordentlich.“
Unordentlich sein stellt ein Urteil dar, das aus einem Verhalten geschlussfolgert wird und das auf Widerspruch derjenigen Person stoßen kann, die so bezeichnet wird. Sie sagt dann womöglich: „Ich bin ja gar nicht unordentlich.“ Die Folge ist, dass eine Auseinandersetzung darüber stattfindet, ob nun Unordentlichkeit vorliegt oder nicht. Die Mutter dringt so mit ihrem eigentlichen Anliegen, das Verhalten der Tochter abstellen zu wollen, nicht durch: Die Tochter schaltet auf stur. Urteile beinhalten eine Etikettierung von Personen. Während Personen gegen (präzise und korrekte) Verhaltensbeschreibungen kaum etwas einwenden, ist dieses anders bei Etikettierungen: Gegen negative Eigenschaftszuschreibungen wehrt man sich zunächst, ggfs. wird eine solche Umweltzuschreibung später als Teil der eigenen Identität übernommen und fördert dann abweichendes Verhalten (vgl. in diesem Sinne Aussagen des labeling approachs, einer Kriminalitätstheorie).
Das unannehmbare Verhalten kann auch übertrieben dargestellt werden. Übertreibungen finden statt, wenn in Aussagen „nie“ und „immer“ verwendet werden.
- „Nie räumst Du Dein Zimmer auf.“
- „Immer bist Du unpünktlich.“
Statt dessen ist es besser zu sagen:
- „Die letzten zwei Wochen habe ich in Deinem Zimmer sechsmal Kleidungsstücke vom Boden aufgehoben.“
- „Von den letzten fünf Verabredungen bist Du dreimal mindestens eine viertel Stunde zu spät gekommen.“
Übertreibungen begünstigen ebenfalls eine mangelnde Bereitschaft, ein unannehmbares Verhalten abzustellen: Das weitere Gespräch wird dann hauptsächlich darum geführt, ob die Aussagen „immer“ und „nie“ tatsächlich zutreffen.
Als Zweites wird auf spürbare Beeinträchtigungen hingewiesen als Folge des Verhaltens. Spürbare negative Folgen lassen sich untergliedern in verschiedene Beeinträchtigungsarten, wovon einige beispielhaft dargestellt werden:
Читать дальше