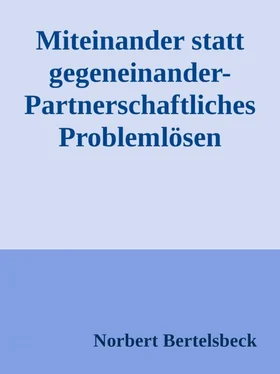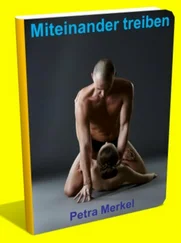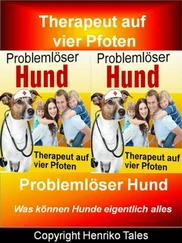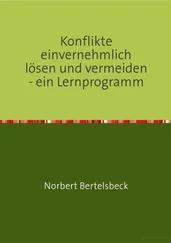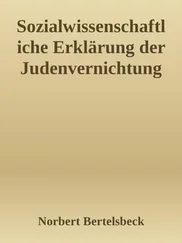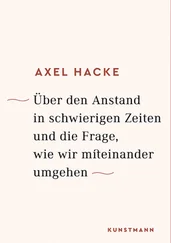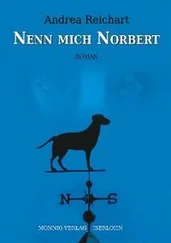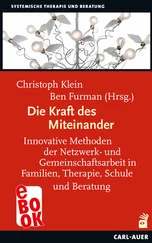1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 - Mit dem unannehmbaren Verhalten ist zwar eine Bedürfnisbefriedigung verbunden, jedoch wird der andere durch die Konfrontierende Ich-Botschaft angeregt, erfolgreich über Alternativen zur Bedürfnisbefriedigung nachzudenken.
- Die Konfrontierende Ich-Botschaft kann beim anderen eine Werthaltung der Rücksichtnahme aktivieren.
- Die Konfrontierende Ich-Botschaft kann beim anderen ein Hilfsmotiv anregen.
Risiken, die mit einer Konfrontierenden Ich-Botschaft verbunden sind
Thomas Gordon (Gordon, Thomas: „Familienkonferenz“, 2000, 133) verweist darauf, dass man mit einer Konfrontierenden Ich-Botschaft dem anderen einen Einblick in sein Innenleben gewährt. Das kann als unangenehm erlebt werden, wenn die Angst besteht, dass man dadurch für den anderen angreifbarer wird. Positiv ist jedoch zu bewerten, dass Aufrichtigkeit auch zu einer herzlicheren Beziehung führt.
Ich-Botschaften und die Freiheit des Verhaltens
Eine Konfrontierende Ich-Botschaft informiert den anderen zwar über sein unannehmbares Verhalten, belässt jedoch die Konsequenzen, die der Angesprochene daraus ziehen will, bei ihm : Der andere hat die Freiheit, sich für eine Verhaltensänderung zu entscheiden und die Art der Änderung zu bestimmen oder aber sein Verhalten (zunächst) beizubehalten. Behält der andere sein Verhalten bei, habe ich meinerseits das Recht, mich mit dem unannehmbaren Verhalten nicht abfinden zu müssen. Wir beide bleiben dann im Gespräch, was seinen Niederschlag findet in der Anwendung weiterer Methoden. Diese sind dann Gegenstand der folgenden Abschnitte.
Empfehlungen zur Reaktion auf unannehmbares Verhalten
- Führt eine andere Person ein unannehmbares Verhalten aus, so sollte zunächst einmal überprüft werden, ob ein Bedürfnis oder ein Wert beeinträchtigt wird.
- Liegt ein bedürfnisbeeinträchtigendes Verhalten vor, so sollte dann geklärt werden, ob dieses anzusprechen oder zu ignorieren ist. Dieses ist dann abhängig vom Ausmaß der Störung.
Gegebenenfalls wird die andere Person überfordert, wenn sämtliches bedürfnisbeeinträchtigendes Verhalten angesprochen wird. Dies gilt für Beziehungen, wo sich Personen fast täglich und zudem über einen längeren Zeitraum sehen. Deshalb kann es auch manchmal ratsam sein, eine Beseitigung eines unannehmbaren Verhaltens auf anderen Wegen anzustreben, wie z. B. über die Veränderung der Umgebung. Möglicherweise kann man auch (durch veränderte Kognitionen) lernen, mit geringfügigen Beeinträchtigungen besser zu leben. Dieses lehrt zumindest die kognitive Verhaltenstherapie.
- Soll das unannehmbare Verhalten angesprochen werden, so ist zu überlegen, wann dies erfolgen soll.
Zu beachten ist, dass für ein solches Gespräch Zeit zur Verfügung stehen sollte, um in Ruhe reden zu können: Sowohl derjenige, der ein Problem ansprechen möchte, sollte Zeit haben, als auch derjenige, mit dem man sprechen möchte. Darüber hinaus sollten Beeinträchtigungen nicht im Zustand hoher emotionaler Erregung (Ärger) angesprochen werden, da sonst die Gefahr des Sendens von Du-Botschaften besteht.
- Schließlich ist zu überlegen, wie ein Verhalten angesprochen werden soll. Eine solche Vorbereitung ist um so wichtiger, je wünschenswerter eine Verhaltensänderung angesehen wird.
(3) Zum Umgang mit Ärger als Folge des Auftretens eines unannehmbaren Verhaltens
Spontane Du-Botschaft
Nimmt eine Person ein unannehmbares Verhalten einer anderen Person wahr, so kann dieses dazu führen, dass Ärger entsteht und spontan eine Du- statt eine Ich-Botschaft geäußert wird:
Die Mutter, die sich von der lauten Musik ihres Sohnes Thorsten beim Lesen eines interessanten Artikels gestört fühlt und zugleich Kopfschmerzen bekommt, wird allmählich immer wütender, als sie daran denkt, dass ihr Sohn auf sie keine Rücksicht nimmt. Sie rennt daraufhin in sein Zimmer und schreit ihn laut an: „Mach’ endlich die verdammte Musik leiser. Ich kann das nicht mehr hören.“ Thorsten macht daraufhin die Musik leiser.
Als Folge einer solchen Du-Botschaft können dann, wenn der Ärger verraucht ist, Selbstvorwürfe auftreten.
So kann die Mutter nach einiger Zeit, wenn sie nicht mehr wütend ist, resignierend zu sich sagen: „Mir gelingt es einfach nicht, wenn ich wütend bin, mich angemessen zu verhalten. Warum habe ich mich damit beschäftigt, wie ich besser mit Problemen umgehen kann, wenn ich es in entscheidenden Augenblicken dann doch falsch mache?“
Wenn Ärger zu spontanen Du-Botschaften führen kann, stellt sich die Frage, wie sich dieses vermeiden lässt. Es lassen sich hierzu einige Vorgehensweisen benennen:
Änderung von Verhaltensweisen
- Dem anderen wird mittels einer Ich-Botschaft mitgeteilt, dass ein Gespräch später erfolgt.
Beispiel:
Die Mutter kann zu ihrem Sohn, der die Musikanlage laut aufgedreht hat, sagen: „Ich bin jetzt sehr ärgerlich darüber, dass Du die Musik so laut hast, obwohl ich lese. Ich möchte jedoch nicht in der Verfassung mit Dir jetzt ein Gespräch führen, sondern heute Nachmittag.“
- Tritt Ärger auf, ist es ratsam, sich schnell aus der Situation zu entfernen und sich dafür selbst zu belohnen.
Beispiel:
Die Mutter könnte, sofern sie momentan Zeit hat, die Wohnung verlassen und in der Stadt shoppen.
- Zukünftige Situationen, in denen ein unannehmbares Verhalten auftreten kann, vorwegnehmen und sich überlegen, wie man angemessen reagieren kann.
Beispiel:
Sie haben bei Ihrem Verkehrsunternehmen telefonisch um eine Bescheinigung Ihres Abonnements für das vergangene Jahr gebeten, die Sie für Ihre Einkommenssteuererklärung benötigen. Als nach einer Woche noch keine Bestätigung vorliegt, beschließen Sie, noch einmal telefonisch nachzufragen. Aufgrund von Erfahrungen halten Sie es für möglich, dass Sie eine negative Antwort erhalten (so etwa: „Das Ausstellen von Bescheinigungen ist für uns nicht so dringlich. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wann Sie Ihre erhalten. Gedulden Sie sich ein wenig.“) und versuchen, sich hierauf mittels der Vorwegnahme einer Konfrontierenden Ich-Botschaft einzustellen.
Maßnahmen zur Verringerung bzw. Vermeidung des Ärgers
- in allgemeiner Weise die Einstellung zu unannehmbarem Verhalten ändern
Unannehmbares Verhalten von anderen als etwas im mitmenschlichen Umgang Unvermeidliches betrachten
- veränderte Sichtweisen spezifischen unannehmbaren Verhaltens über ärgerreduzierende Kognitionen
keine Absicht, Verantwortlichkeit oder Gerechtfertigtsein unterstellen
Die handlungstheoretische Aggressionstheorie von Kornadt unterstellt, dass vorgenannte Kognitionen einen spontan auftretenden Ärger reduzieren können.
Beispiel:
Die Eheleute Müller haben sich darauf geeinigt, dass der Ehemann einkauft, da er früher von der Arbeit kommt. Als Frau Müller nach Hause kommt, sind keine Lebensmittel da. Herr Müller sagt zu ihr, dass er heute länger arbeiten musste und darüber auch vergessen habe, noch einzukaufen. Dadurch, dass Frau Müller Gründe für ein deprivierendes Verhalten erhält, verringert sich ihr Ärger: Sie erfährt, dass ihr Ehemann versehentlich nicht eingekauft hat. Sie kann darüber hinaus seinem Verhalten auch eine verminderte Verantwortlichkeit aufgrund von Überlastung zuschreiben.
sich fragen, ob das Ausmaß der Schädigung den Ärger rechtfertigt
Beispiel:
Ist es wirklich so schlimm, wenn der Partner einmal das Einkaufen vergisst?
sich positive Verhaltensweisen des Partners vor Augen führen
Beispiel:
sich sagen, dass der Partner normalerweise ja immer einkaufen geht
- zu einer optimalen eigenen Bedürfnisbefriedigung gelangen
Ist man selbst zufrieden, so erlebt man ggfs. das unannehmbare Verhalten einer anderen Person als nicht so unangenehm.
Читать дальше