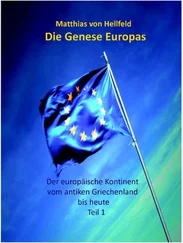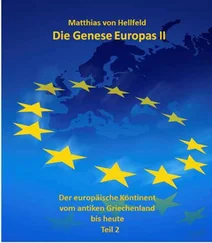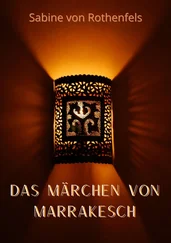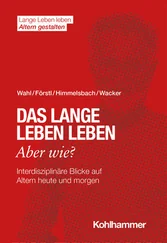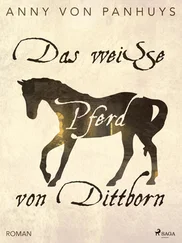Ähnliche Schwierigkeiten ergaben sich auch für Russland. Zar Alexander fand zum einen zwar Gefallen daran, neben Napoleon der mächtigste Herrscher auf dem europäischen Kontinent zu sein. Zum anderen aber war die russische Wirtschaft auf die Einfuhr englischer Erzeugnisse angewiesen. Der Export nach England und die Einfuhr von Textilien, Kaffee oder Tee und Tabak waren gestoppt. Das führte einerseits zu Problemen in der eigenen Wirtschaft und andererseits zu einem drastischen Rückgang der Steuereinnahmen aus diesen Geschäften. Ende 1810 verschlechterte sich das Verhältnis Alexanders zu Napoleon durch die Verlegung von französischen Divisionen an die russische Grenze, was den Zaren veranlasste, die Kontinentalsperre gegen England aufzuheben und die russischen Häfen für englische Waren wieder zu öffnen. Eigentlich hätte die eigenmächtige Handlung des russischen Zaren Napoleon signalisieren müssen, dass der Höhepunkt seiner Herrschaft über Europa vorbei war. Stattdessen aber löste die Nachricht aus Moskau einen lautstarken Tobsuchtsanfall des französischen Kaisers aus, dem wüste Beschimpfungen des „russischen Weichlings“ folgten.
Unmittelbar nach dem russisch-französischen Zerwürfnis begannen beide Seiten, sich auf einen Krieg vorzubereiten, der im Juni 1812 mit dem Marsch der „Grande Armée“ nach Moskau auch begann. Es war die größte Truppenbewegung der Geschichte, die Napoleon gegen Russland ins Werk setzte. Seine eigenen Möglichkeiten überschätzend führte er fast eine halbe Million Soldaten nach Russland. Die russische Armee unter der Führung von General Michail Kutusow ließ die Franzosen ins Leere marschieren, indem sie sich immer weiter ins Landesinnere zurückzog und den Franzosen die Versorgungslinien abschnitt. Vor Moskau kam es am 7. September 1812 zur Schlacht von Borodino, mit fast 30.000 Toten oder Verwundeten auf französischer Seite. Die Schlacht endete mit einem Pyrrhussieg für Napoleon. Der Schriftsteller und Schlachtenmaler Albrecht Adam hat das Ende der Schlacht von Borodino miterlebt:
„Bluttriefend schleppten sich die Soldaten aus dem Kampfe, an vielen Stellen war das Feld mit Leichen bedeckt; was ich an Verwundungen und Verstümmelungen an Menschen und Pferden an diesem Tag gesehen, ist das Grässlichste, was mir je begegnete, und lässt sich nicht beschreiben.“
Mitte September 1812 erreichte Napoleon Moskau, einen Tag später zündeten Russen die Stadt an. Ein an den Zaren gerichtetes Waffenstillstandsabkommen blieb einen Monat lang unbeantwortet, so dass Napoleon Ende Oktober 1812 entnervt aufgab und angesichts des beginnenden Winters den Rückzug seiner Truppen anordnete. Der harte Winter und andauernde Überfälle durch russische Kosakenverbände brachten den Invasoren hohe Verluste bei. Nach der Schlacht an der Beresina Ende November 1812 verließ Napoleon seine Truppe und flüchtete nach Paris zurück. Am Ende der Expedition nach Russland war die „Grande Armée“ nahezu vollständig aufgerieben, nur 45.000 Soldaten sahen die französische Hauptstadt wieder.
Europa gegen Napoleon
Die Kunde von der Niederlage der französischen Armee und dem Rückzug des als unbesiegbar geltenden Napoleon verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Europa. Preußen hatte für den Russlandfeldzug Soldaten abstellen müssen, die von General York befehligt wurden. Jener General York unterzeichnete am 30. Dezember 1812 ein Waffenstillstandsabkommen mit den russischen Befehlshabern, das nur für seine preußische Armee galt. Diese „Konvention von Tauroggen“ überstieg die Kompetenz des Generals, der aber den zu erwartenden Zorn des preußischen Königs in Kauf nahm. Fünf Tage später schrieb er einen Brief an Friedrich Wilhelm III. und forderte ihn darin zum Handeln gegen den geschwächten französischen Kaiser auf. Wohl selten hat ein Brief eine derartige Wirkung erzielt, denn er war der Startschuss zur Befreiung des Kontinents von der Hegemonie Frankreichs. Zwei Monate später veröffentlichte der preußische König den Aufruf „An mein Volk“ und appellierte dabei an das erwachende Nationalgefühl der Deutschen:
“Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litauer! Ihr wisst, was Ihr seit fast sieben Jahren erduldet habt, Ihr wisst, was Euer trauriges Los ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert Euch an die Vorzeit, an den großen Kurfürsten, den großen Friedrich. (…) Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unseren Wohlstand; keinen anderen Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang.“
Der Aufruf zeigte Wirkung. Überall strömten Freiwillige zusammen, von einer Welle nationaler Erregung erfasst organisierten Soldatenfrauen patriotische Kaffeekränzchen und tauschten ihre goldenen Eheringe gegen schmucklose Eisenringe, auf denen die Parole eingraviert war „Gold gab ich für Eisen. 1813“. Der „Aufruf an mein Volk“ versetzte Preußen und Deutsche gleichermaßen in einen nationalen Taumel, Freiwilligenverbände marschierten durch die Straßen, verbreiteten das Gefühl des nationalen Widerstands und signalisierten den französischen Besatzern: dieses Volk ist in Waffen! „Deutschland steht auf! Der preußische Adler erweckt in allen treuen Herzen durch seine kühnen Flügelschläge große Hoffnung“, schrieb der 22jährige Dichter Theodor Körner an seinen Vater. Als er kurz danach auf dem „Feld der Ehre“ sein Leben hingab, hatte die nationale Bewegung ihren ersten Märtyrer. Der Aufruf des preußischen Königs traf auf fruchtbaren Boden, denn die rigoros auf die Durchsetzung französischer Interessen gerichtete Politik Napoleons hatte bei vielen Deutschen nationale Gefühle geweckt. Dieser Stimmungswandel war auch in Spanien oder Portugal bemerkbar, wo sich die alten Reichsstände erhoben und den Widerstand gegen die französische Armee organisierten.
In Deutschland meldeten sich nationale Literaten zu Wort und propagierten einen deutschen „Nationalismus“, der dem Übel der französischen Besatzung ein Ende bereiten sollte. Sie propagierten eine spezifisch deutsche Identität und grenzten sich so vom hegemonialen Frankreich ab, das zum Hort allen Übels erkoren wurde. Gleichzeitig wurden „emotionale Bindungen auf das Kollektiv“ übertragen und eine „eine Sakralisierung des Vaterlands“ (Planert, 2004) vorgenommen. Johann Wolfgang von Goethe machte sich über „Deutschlands Zukunft“ Gedanken und schrieb 1813, dass die Deutschen „eine große Bestimmung haben, eine Bestimmung, welche um so viel größer sein wird denn jenes gewaltige Werk der Zerstörung des Römischen Reichs“ (Pollmann, 1989). Johann Gottlieb Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ waren schon im Titel ein Programm und hatten die Deutschen bereits 1808 aufgefordert, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und „Großes zu vollbringen.“ Aber der deutsche Nationalismus stand vor dem Problem, auf welches Deutschland er sich beziehen sollte. So lange Preußen und Österreich eigenständige Staaten waren, machte die Vorstellung einer Identität aller Deutschen als Angehörige einer Abstammungsgemeinschaft mit gemeinsamer Kultur und Sprache keinen Sinn. Die patriotischen Hoffnungen zielten also nicht auf eine geeinte Nation, sondern erst auf das „Heilige Römische Reich“ unter habsburgischer Führung und als das nicht mehr bestand auf den Rheinbund. Dabei forderten Johann Gottlieb Fichte und andere eine Abkehr von Napoleon und eine Hinwendung zu einem selbständigen deutschen Staat. Sie wollten ein neues Gemeinwesen, dass die Macht der Fürsten einschränkte und an Gesetze band.
Während der „Franzosenzeit“ wirkten die nationalen Zirkel im Verborgenen, hatten keine öffentliche Strahlkraft. Mit den steigenden Repressionen durch französische Truppen in Deutschland wurden die Rufe nach einem „nationalen Zusammengehen“ aber lauter. Alsbald mischten sich bei Theodor Körner oder Achim von Arnim Beschwörungen zum „heiligen Krieg“ oder zum „Kreuzzug“ gegen Frankreich in die romantisierenden nationalen Klagen. Nach der Niederlage Napoleons in Russland, dem königlichen Aufruf zum Widerstand gegen Frankreich und der begeisterten Rezeption durch die preußische und darüber hinaus deutsche Bevölkerung wurden nationale Lieder, Gedichte und Karikaturen verfasst, die Ausdruck eines gewachsenen deutschen Nationalismus waren. Preußen war nun Hoffnungsträger der Befreiung vom Joch der französischen Besatzung und wurde von der „Lyrik der Befreiungskriege mit jener transzendenten Macht ausgestattet, die bisher nur der Religion vorbehalten war“ (Planert, 2004). Ernst Moritz Arndt griff religiöse Überhöhungen in seinem „Kriegskatechismus“ auf und sprach davon, dass es „blutige Tyrannen“ gewesen seien, die „Freiheit und Gerechtigkeit“ getilgt hätten. Ohne die Franzosen oder Napoleon beim Namen zu nennen, wusste jeder wer oder was gemeint war.
Читать дальше