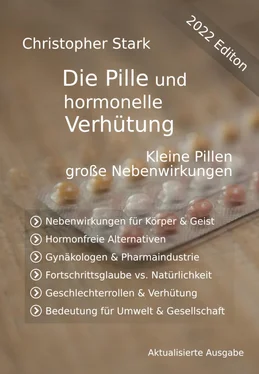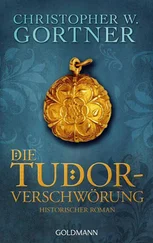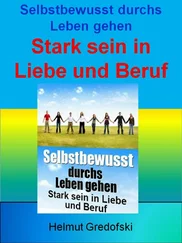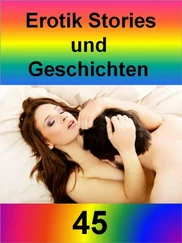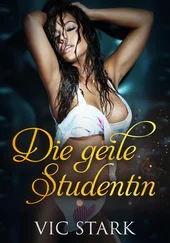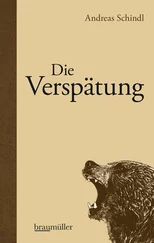Historisch und heute
In Westdeutschland kam die erste Antibabypille 1961 auf den Markt und in der DDR Mitte der 1960er-Jahre. Die Einführung der Pille fiel damit zusammen mit den Protest- und Frauenbewegungen der 1960er-Jahre und trug im Alltag vieler Frauen der Industriestaaten zu einer größeren sexuellen Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bei. Allerdings hatte dieser Teil der Emanzipation schon lange vorher in verschiedenen Gesellschaftsbereichen begonnen, so dass die Grundlagen für einen schnellen Erfolg der Pille bereits gelegt waren. Ein starker Anstieg etwa bei der Häufigkeit des Wechsels von Sexualpartnern hatte in Westeuropa und den USA in den 1950er-Jahren eingesetzt. Auch das Verbot von vorehelichem Sex war im Alltag der Menschen bereits relativ weit zurückgedrängt, was neben einer liberaler werdenden Gesellschaft maßgeblich auch mit der medizinischen Eindämmung der sexuell übertragbaren Krankheit Syphilis Anfang der 1950er-Jahre zusammenhing. Im Zuge der 1968er-Bewegung öffneten sich Moralvorstellungen in der Breite der jungen Bevölkerung weiter und unterstützten die Entwicklung hin zur sexuellen Freiheit.(3)
Entwicklungsgeschichte hormoneller Verhütung
Schwangerschaftsverhütung wurde ungefähr erst Anfang des 20. Jahrhunderts zum Thema in der wissenschaftlichen Medizin.(4) Die Grundlagen für die Gabe von Hormonen zum Zweck der Verhütung hatte wesentlich der österreichische Wissenschaftler Ludwig Haberland gelegt, der 1919 vorschlug, mit Hormonen direkt in den weiblichen Körper einzugreifen. Als einem der ersten Chemiker gelang es dem deutschen Wissenschaftler Adolf Gutenand in einem nächsten Schritt in den 1920er- und 1930er-Jahren, Sexualhormone zu isolieren und die Molekularstruktur jener Hormone aufzuschlüsseln. Er erhielt 1939 den Chemie-Nobelpreis für seine Arbeiten. Auch andere Wissenschaftler wie Walter Hohlweg und Hans Herloff Inhoffen leisteten wichtige Beiträge zur ersten Herstellung künstlicher Hormone bzw. Östrogene. Es folgten Wissenschaftler weltweit, die in diesem Bereich forschten. In der Zeit gelang etwa auch die Isolierung hormonartiger Substanzen aus Pflanzen – etwa aus der Yamswurzel. Dem Chemiker Russel Marker und seinem Mitarbeiter Carl Djerassi gelang es zudem, ein weibliches Sexualhormon herzustellen, das oral eingenommen werden konnte. Dieses wurde später zum Hauptbestandteil der ersten hormonellen Verhütungspillen.(5)
Die US-amerikanische Krankenschwester Margret Sanger eröffnete zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Klinik für die Empfängnisverhütung zum Zweck der Geburtenkontrolle in New York City. Nach anfänglichen juristischen Auseinandersetzungen konnte sie sich etablieren und gab gemeinsam mit Katherine McCormick in den 1950er-Jahren beim Biologen Gregory Pincus die Entwicklung einer Antibabypille in Auftrag. Die Motive sowohl der Auftraggeberinnen, als auch von Herrn Pincus selbst, waren aus heutiger Sicht nicht nur positiv im Sinne der Armutsbekämpfung und dem Wohl von Frauen zu bewerten. Es ging ihnen wesentlich darum, Schwangerschaften von ungebildeten und armen Frauen zu verhindern, um die „Qualität“ des Bevölkerungsdurchschnitts zu heben. Sie hatten also eine klar sozialdarwinistische Zielsetzung.(5,6)
Die moderne Pille entsteht
1957 kam das erste von Pincus entwickelte hormonelle Verhütungspräparat (Enovid) auf den US-amerikanischen Markt und kurz darauf folgte die Einführung eines ähnlichen Mittels namens Anovlar auf dem westdeutschen Markt, entwickelt von der Firma Schering. Damals löste die Einführung „der Pille“ in Deutschland gesellschaftliche Kontroversen aus – aber weniger aus gesundheitlichen Gründen, als mehr aufgrund konservativ-moralischer Vorstellungen gegen die sexuelle Freiheit von Frauen. Daher wurde das Mittel zunächst mit dem Zusatz „Mittel zur Behebung von Menstruationsstörungen“ vertrieben. 1960 wurde die Pille in Westdeutschland offiziell als Verhütungsmittel zugelassen und erfuhr vor allem in den 1970er-Jahren eine rasche Verbreitung.(5,20) Ab 1965 wurde auch in der DDR ein vergleichbares Produkt (Ovosiston) eingeführt.
Die Antibabypille galt für viele Menschen seit den 1968er-Jahren als ein Symbol für die Selbstbestimmung und die Freiheit der Frau. Dies trug viel zum Mythos der Hormonverhütung als ein Mittel der Emanzipation bei. Kritik erfolgte allerdings seit Mitte der 1970er-Jahre durch Vertreterinnen der Frauenbewegung, vor allem auch wegen der Nebenwirkungen.
Die starke Verbreitung hormoneller Verhütungsmittel bei Frauen im gebärfähigen Alter beschränkt sich heute überwiegend auf die reichen, vor allem westlichen Industrieländer in Form von Antibabypillen und auf einige sehr arme Länder in Form von Spritzen oder Implantaten.
Statistiken...
Die regionale Begrenztheit der Pille hängt vor allem mit den vergleichsweise hohen Kosten zusammen. Die weltweit am weitesten verbreitete Verhütungsmethode ist die Sterilisation mit 19,2 % aller Frauen im gebärfähigen Alter. Danach folgen hormonelle Verhütungsmethoden zusammengenommen mit 14,1 % (Pille, Injektion, Implantat). Die Kupferspirale kommt etwa gleichauf auf 13,7 % und das Kondom auf einen Anteil von etwa 7,7 Prozent.(7)
Die Frauen, die in Westeuropa verhüten, verhüten zu 39 % mit hormonellen Mitteln und in Deutschland sind es laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ca. 7 Mio. Frauen. Dies entspricht etwa einem Drittel der 20 Mio. Frauen im gebärfähigen Alter (8 nach Wiegratz et al., 2011). Entsprechend einer etwas älteren Befragung von 2007 betrug der Anteil etwas über die Hälfte aller Frauen zwischen 20 und 44 Jahren.(9) In anderen Quellen, wie in den Zahlen der WHO, wird für Deutschland von einem Anteil von etwa 38,5 % der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren in festen Beziehungen ausgegangen, die hormonell Verhüten.(7) Bei 19-jährigen Frauen sind es nach Zahlen der Barmer- und der Techniker Krankenkasse sogar zwischen 60 und 70 Prozent. 8,62 Man kann festhalten, dass trotz dieser etwas unterschiedlichen Zahlen ein großer Teil der erwachsenen Frauen in Deutschland mit der Pille oder anderen hormonellen Methoden verhütet.
In Europa sind derlei Mittel mit 22,5 % der Frauen im gebärfähigen Alter und in festen Beziehungen etwas weniger verbreitet.(7) In Afrika sticht Kenia mit 47 % hormoneller Verhütung unter allen verhütenden Frauen hervor. In dem westafrikanischen Land ist – wie in vielen anderen armen Ländern auch – insbesondere die nebenwirkungsreiche Hormon-Injektion verbreitet. In Japan wurde die Antibabypille erst 1999 erlaubt. Hier ist die Pille kaum, das Kondom aber mit 46,1 % mit Abstand am weitesten verbreitet.(7) In Asien finden insgesamt sehr häufig die Kupferspirale und die Sterilisation Anwendung. Der Siegeszug hormoneller Verhütung fand weltweit betrachtet also nicht überall statt und sie ist nicht überall so weit verbreitet, wie in Deutschland und Westeuropa.
Verhütungssicherheit
Relevant zu erwähnen zu Beginn dieses Buches ist, dass für die Vergleichbarkeit der Sicherheit von Verhütungsmitteln der sogenannte Pearl-Index dient. Als sicher gelten Methoden, die hohe Werte, deutlich über 90 Punkte auf diesem Index haben. Er gibt an, wie viele von 100 Frauen durchschnittlich innerhalb eines Jahres trotz Anwendung einer Verhütungsmethode schwanger werden. Der Pearl-Index berücksichtigt auch, dass die statistische Wahrscheinlichkeit der Befruchtung einer Frau im gebärfähigen Alter bei einem Mal ungeschütztem Sex nicht 100 % beträgt. Je nach Untersuchung zur Zuverlässigkeit von Verhütungsmitteln kann es abweichende Angaben des Pearl-Indexes für einzelne Methoden geben, je nachdem, welche Kriterien für die Bewertung angelegt werden.
Variante n hormoneller Verhütungsmittel - Natürliche und künstliche Hormone
Читать дальше