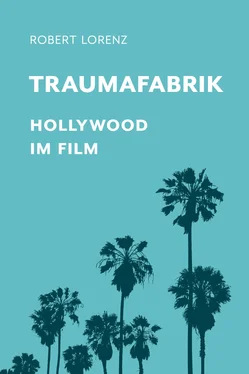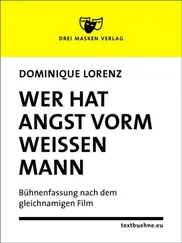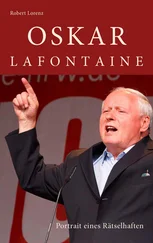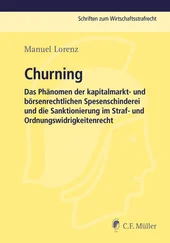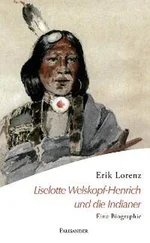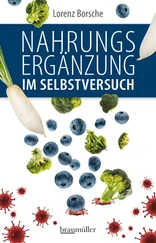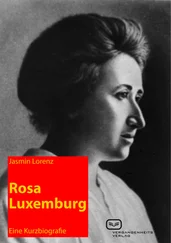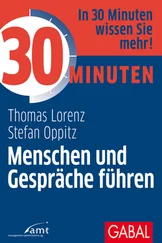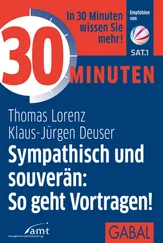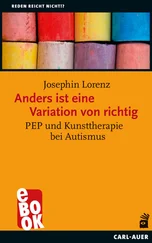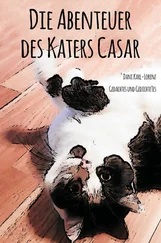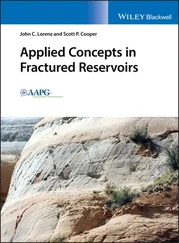Schon in dem Moment, als sich Gillis auf ihren Stuhl gesetzt hat, spätestens aber jetzt, wird er von Norma Desmond und ihrer Villa absorbiert, zum Bestandteil von Desmonds entrückter Parallelwelt. Sie vereinnahmt ihn sofort, wie als Ersatz für den toten Affen, spricht nun auch konsequent von „wir“. Das letzte Quäntchen Autonomie spült schließlich der Dezemberregen hinweg, als es in Gillis’ kleinem Appartement über der Garage durch die Decke tropft und er deshalb in die Villa umzieht – Norma Desmond lässt ihn in das Zimmer ihrer drei Ex-Ehemänner einquartieren. Wie ein Vampir saugt sie sich neuen Lebenselan, will nun den stillgelegten Pool mit Wasser auffüllen lassen und ihr eingemottetes Malibu-Strandhaus wieder in Betrieb nehmen. Gillis lebt jetzt als ihr Schreibknecht und Gigolo – immer den Launen und Allüren der Diva unterworfen, manchmal im maßgeschneiderten Anzug, manchmal in Leoparden-Unterwäsche. In kurzer Badehose klettert er aus dem inzwischen wieder befüllten Pool, sie trocknet ihm den Rücken. Eigenes Geld hat er nicht, sondern steht finanziell komplett in ihrer Abhängigkeit; für jede noch so kleine Erledigung händigt sie ihm Geldscheine aus. Als „a long-term contract with no options“ beschreibt Gillis seine Situation.
Bis zur Ankunft von Joe Gillis hat Norma Desmond das verwunschene Anwesen in tiefer Melancholie zusammen mit ihrem treuen Butler Max (Erich v. Stroheim) bewohnt. Von dem einstigen Glanz des Grundstücks zeugen der von Ratten bevölkerte und mit Laub bedeckte Swimmingpool mit Sprungbrett und drei Einstiegen oder die von Säulenbogen umgebene, nun mit verrottetem Netz längst verfallene Tennisanlage – einst Insignien sagenhaften Reichtums, liegen sie dort nun wie düstere Relikte einer untergegangenen Welt, „out of beat with the rest of the world“, wie Gillis das ganze Anwesen beschreibt. Der Anblick der Villa entfaltet umstandslos einen Lost Place- Charakter, auch die halb verdorrten Palmen im Vorgarten stehen dort wie Allegorien einer verblichenen Grandezza. Norma Desmond ist keineswegs arm – wer weiß schon, wie viel Geld sie zu ihrer Schauspielzeit verdient hat? Aber auf ihrer Psyche lastet ein tiefer Kummer ob des verblassten Starstatus, der hier schwerer wiegt als jeder finanzielle Bankrott.
Ähnlich wie in Robert Aldrichs „What Ever Happened to Baby Jane?“ (1964) ist die Villa ein eigenständiger Charakter des Films, ihr „Casting“ genauso wichtig wie das von Desmond und Gillis. Das reale Gebäude, das für die Außenaufnahmen diente und dessen Interieur man im Studio weitgehend originalgetreu nachbildete, gehörte damals zu den interessantesten Häusern der ganzen Stadt und entfaltete maximales Hollywoodambiente. Erbaut zwischen 1922 und 1925 für eine damals stattliche Geldsumme von dem Geschäftsmann William O. Jenkins (1878–1963), der sein Vermögen ironischerweise in der mexikanischen Revolution gemacht hatte, stand die Villa nach nur einem Jahr wieder leer, ein ganzes Jahrzehnt lang, weshalb das „Jenkins House“ in der Nachbarschaft bald als „Phantom House“ bekannt war. Im Jahr 1936 kaufte es dann ein nochmals reicherer Mann, der Ölmagnat J. Paul Getty (1892–1976). Wiederum 13 Jahre später wurde das Haus an die Paramount vermietet, die den Pool buddelte – das einzige Luxusinsigne, das dem Anwesen bis dahin noch gefehlt hatte. Allein schon der historischer Kontext, dass das Grundstück vom reichsten Mann Mexikos an den reichsten Mann der Welt ging, gebührt dem Charakter der Norma-Desmond’schen Größe und Gigantomanie.
Und wie als Parallele zum Schicksal der Desmond fiel das „Jenkins House“ einem Epochenwechsel zum Opfer. In den 1950er Jahren geriet es zu einer der skandalösen Bausünden von Los Angeles, da man Getty schließlich 1956 die mehrere Jahre lang beantragte Abrissgenehmigung erteilte. An seine Stelle trat das sechsstöckige „Tidewater Building“ (heute: „Harbor Building“, 640 Lorraine Boulevard), ein monumentaler Bau mit einer Fassade aus weißen Marmorplatten auf der Fläche eines ganzen Häuserblocks, der fortan eines der Unternehmen aus Gettys Ölimperium beherbergte. Kurz zuvor war die atmosphärische Kraft des Anwesens allerdings noch für einen weiteren berühmten Hollywoodstreifen abgerufen worden, als die delinquenten Jugendlichen aus „Rebel Without a Cause“ (1955) – einem der bloß drei James-Dean-Filme (zudem mit Natalie Wood und Dennis Hopper) – nachts die Villa erkunden und im leeren Pool unterwegs sind.
Das Haus der Desmond im italienischen Renaissancestil ist allein von seiner Architektur und seiner schieren Größe her extravagant und hollywoodesk. Acht Schlafzimmer, im Keller eine Bowlingbahn, im Innern voller Säulen mit Kapitellen der korinthischen Ordnung; den ursprünglichen Holzboden im Foyer tauschte die Desmond gegen einen edlen Kachelboden aus, damit dort Valentino besser tanzen konnte; die Etagendecke wurde in Portugal gefertigt, hinter einem großen Gemälde verbirgt sich eine Heimkinoleinwand. Das Mobiliar verstärkt die bauliche Opulenz sogar noch: schwere, dunkle Holzmöbel, oft mit dicken Spiralsäulen verziert, vor dem Schreibtisch ein römischer Stuhl, auf dem Gillis einen Skriptauszug des Desmond-Drehbuches liest; ihr Bett ist einer griechischen Triere aus der Antike nachempfunden, ergänzt um eine kleine Engelsfigur am Bug (Dieses Bett hat eine bemerkenswerte Requisitengeschichte und tauchte u. a. 1934 in Howards Hawks’ Screwballklassiker „Twentieth Century“ auf) – von allem viel zu viel, ganz so wie beim Hype um die Hollywoodstars.
Und wer die abgedrehte Statur eines Stummfilmstars aus den Zwanzigern an Haus und Mobiliar noch nicht ermessen kann, für den flechten Wilder, Brackett und Marshman Jr. immer wieder Hinweise auf Norma Desmonds Format ein: Im Studiogebäude der Paramount sei eine ganze Etage ihrer Garderobe gewidmet gewesen; 17.000 Fanbriefe habe sie jede Woche erhalten; ein indischer Maharadscha habe einen ihrer Seidenstrümpfe erbettelt und sich später damit erhängt. In der Garage parkt ihr handgefertigter Isotta-Fraschini mit Leopardenfellbezug und vergoldetem Telefonhörer, mit dem sie dem Fahrer unterwegs ihre Direktiven durchgeben kann. Ihre Star-Gagen hat sie offenbar nicht verprasst, sondern profitabel in Immobilien und Ölquellen angelegt – „I’m richer than all this new Hollywood trash“, sagt sie voller Verachtung für die ihr am Sternenhimmel über der Traumfabrik Nachgefolgten.
Dass „Sunset Blvd.“ in Schwarz-Weiß gedreht ist, entsprach dem damaligen Standard, am Ende der 1940er Jahre. Aber man müsste ihn auch heute noch so drehen; denn jedwede bunte Farbe widerspräche zutiefst dem düsteren, pessimistischen, depressiven Unterton seiner Szenen und natürlich auch dem Stummfilm-Thema. Wilder versetzt sein Publikum in die beklemmende Villa, mitten hinein in die Desmond’sche Obsession. Man kann darin ihre am eigenen Ruhm erkrankte Seele regelrecht greifen. Und obwohl man den Ausgang dieser Manie ja von der ersten Szene an kennt, verfolgt man gebannt den Verlauf dieser vorherbestimmten Tragödie. Gillis und Desmond, der erfolglose Skriptschreiber und der erloschene Stern, gehen eine unheilvolle Symbiose zweier blockierter Menschen ein, der eine am Anfang, die andere am Ende der Karriere. Gillis quartiert sich also in der exzentrisch-morbiden Luxusvilla ein, in der bei leichten Windstößen eine Orgel schauerliche Töne von sich gibt, hunderte von Desmond-Porträts drapiert sind und die Schauspielerin in ihrem Privatkino an mehreren Abenden pro Woche die eigenen Filme abspielen lässt („So much nicer than going out, she’d say.“).
Über diesem Arrangement schwebt ihre Comeback-Absicht wie ein Damoklesschwert. Denn der Profi Gillis ahnt natürlich, dass sich bei Paramount längst niemand mehr für sie interessiert und obendrein ihr Skript von peinlicher Qualität ist. Norma Desmond freilich ist ganz und gar unfähig, sich mit dem Bewusstsein einer glanzvollen Vergangenheit zu begnügen oder die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens zu erkennen, geschweige denn jemals zu akzeptieren. Um jeden Preis will sie, „still sleepwalking along the giddy heights of a lost career“, die einstige Größe zurückerlangen, ja noch steigern. Für ihre Tonfilm-Epigon:innen hat sie aus postpubertärem Selbstschutz nichts als Verachtung übrig („We didn’t need dialogue. We had faces. There just aren’t any faces like that any more. Maybe one, Garbo.“). „I can say anything I want with my eyes!“, lautet ihr Credo. Gleich bei ihrer ersten Begegnung echauffiert sie sich (in theatralischem Furor) gegenüber Gillis über die Filmbranche, die sie – die Größenwahnsinnige – des Größenwahns zeiht, neben dem Bild unbedingt auch noch den Ton bekommen zu müssen: „They took the idols and smashed them. The Fairbanks, the Gilberts, the Valentinos! And who have we got now? Some nobodies!“ Worte hätten die Branche stranguliert, „but there’s a microphone right there to catch the last gurgles, and Technicolor to photograph the red, swollen tongue!“ Mit dem Blick auf Norma Desmond lässt sich begreifen, wie gefährlich der Aufstieg zu Glanz und Gloria, zum Selbstzweck verkommen, sein kann.
Читать дальше