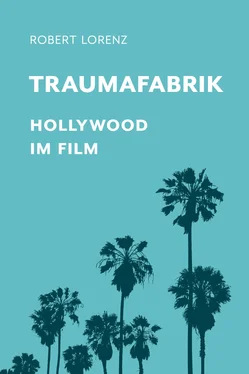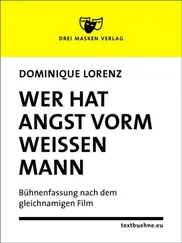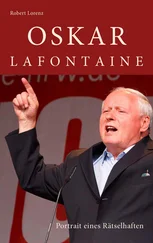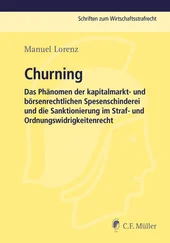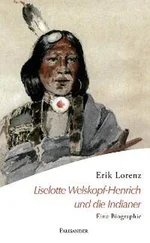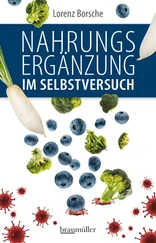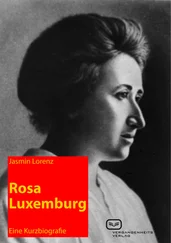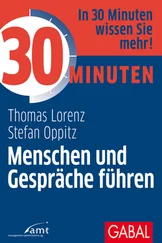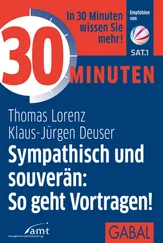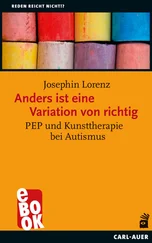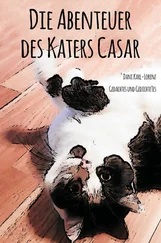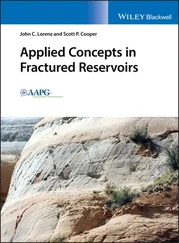Fuller und Connolly machten den Protagonisten quasi zu einer Anti-Hollywoodfigur, indem sie jemanden erschufen, der bereit war, seine Integrität gegenüber seinen Kinderfans über seine Karriere und sein Bankkonto zu stellen. „It Happened in Hollywood“ markierte damit den Beginn der Karriere eines der originellsten US-amerikanischen Regisseure – gleich nach dem Kinostart des Films erhielt Fuller das Angebot, für komfortable Honorare anonym Skripte zu verfassen. Bis das erste Drehbuch entstand, das Fuller als sein eigenes Werk betrachtete und auch als solches präsentieren konnte, vergingen allerdings noch ein paar Monate (der Krimi „Gangs of New York“ von 1938); und seine erste Regiearbeit ließ noch bis 1949 auf sich warten (der historisch inspirierte Western „I Shot Jesse James“).
„It Happened in Hollywood“ hieß zuerst „Once a Hero“, aber Columbia sah im späteren Titel wohl eine zugkräftigere Variante, welche die Leute mit dem „Hollywood“-Label an die Ticketschalter locken sollte; der ursprüngliche Titel ist im Vorspann unterhalb des neuen als Alternative aufgeführt – vermutlich, da mit „Once a Hero“ die Credits in Form eines seitenweise geblätterten Buches bereits eingespielt worden waren.
Der stärkste Teil des Films – er strahlt weit über die übrigen Sequenzen hinaus und macht „It Happened in Hollywood“ dann doch sehenswert – ist sein Finale, dem ein bemerkenswerter Sarkasmus innewohnt. Der pleitegegangene Tim Bart, der seiner ebenfalls bankrotten Liebe, Gloria Gay, helfen und mit ihr ein unbeschwertes Leben führen will, erinnert sich an den Gangsterfilm, in dem er mitspielen sollte und der ihm die Karriere hätte retten können. Bart beschließt, die Szene des fiktiven Raubüberfalls einfach in die Tat umzusetzen, und begibt sich mit seinem Revolver in die Bank. Als ihm diese düstere Idee kommt, die seine ganze bisherige Moral mit einem Mal korrumpiert, da blicken seine entschlossenen Augen aus dem Fenster und man hört den Donner grummeln, während es zu regnen beginnt – Karrieretiefpunkte in Hollywood scheinen hier selbst den wahrhaftigsten Charakter verderben zu können.
Die folgende Sequenz am verregneten Bankgebäude atmet all die triste Kriminalstimmung eines James-Cagney-Prohibitionsgangsterfilms aus den frühen Dreißigern: Im durchnässten Trenchcoat betritt der gefallene Schauspieler Tim Bart die Hollywood Central Bank und man sieht ihm die tiefe Verzweiflung an, mit der er gleich sein Verbrechen begehen will. Während Bart seinen Überfall vorbereitet, fährt draußen eine Limousine vor – der Fluchtwagen echter Gangster, die zum Bankschalter schreiten und Bart zuvorkommen. Der genuine Cowboy Bart zückt daraufhin seinen silbernen Revolver und erledigt mit drei präzisen Schüssen die türmenden Gangster, deren Fluchtwagen in ein geparktes Fahrzeug kracht – die eben noch als Verbrecherwerkzeug vorgesehene Waffe wird so zum Instrument einer Heldentat, der potenzielle Täter eines bewaffneten Raubüberfalls zum Mann der Stunde. „Film hero real hero in gun battle“ jubiliert die Abendzeitung.
Weil Bart nun im ganzen Land auf den Titelseiten als Ganovenkiller und Polizistenretter gefeiert wird, beeilt sich das Studio, seinen geschassten Star so schnell wie möglich zurückzuholen. Als er wieder unter Vertrag genommen werden soll, da das Kinopublikum nun unmissverständlich nach Tim Bart und „outdoor pictures“ zu verlangen scheint, da hängen im Büro des Studiobosses plötzlich überall gerahmte Tim-Bart-Aufnahmen, wo noch zuvor, als man ihn fallen ließ, die Porträts anderer Darsteller die Wände zierten. „It’s grand to see you again“, wird er in Sam Bennetts Büro, dem Entscheidungszentrum von Perfect Pictures, empfangen, wo man ihn längst abgeschrieben hatte. „You know how we’ve always felt about you around here“, heuchelt man ihm – „Just like home, isn’t it, Tim, huh?“
Diese Szene, in der sich oberflächlich alles in Wohlgefallen auflöst, zeigt in Wirklichkeit die Studios – und ihre Angestellten – als Sklaven von Medienkonjunkturen und Nachrichtenwerten. Als der Westerndarsteller seiner Filmfantasie entschlüpft und wie ein echter Revolverheld die Banditen zur Strecke bringt, avanciert er mit einem Mal zum Medienereignis, das die PR-alerten Studioprofis sofort kommerziell ausbeuten wollen. Analog zu Fullers unvermitteltem Engagement, als Drehbuchnovize einen Film zu schreiben, manifestiert sich im Finale ebendieses Films die Kurzlebigkeit von Entscheidungen und Prämissen, der spontaneistische Charakter Hollywoods. Der eben noch mit der Begründung, niemand wolle mehr Western sehen, fallengelassene Bart wird nun mit der gegenteiligen Aussage – das Publikum lechze nach Outdoor-Filmen wie eben Western – zurückgeholt und erneut zum Star aufgebaut. Auf der Plakatwand rufen dicke Lettern: „Tim Bart Rides Again!“
Boulevard der Dämmerung
Ein Leichnam wird in den fensterlosen Raum geschoben, an den Wänden sind wie in einem Parkhaus bereits ein Dutzend andere Verstorbene abgestellt. Weiße Tücher bedecken sie, um den großen Zeh ein Etikett gehängt, die Zusammensetzung ein Spiegel der Gesellschaft – Kinder und Alte, Weiße und Schwarze. Das Licht geht aus, aber plötzlich scheinen die Toten halbtransparent unter den Abdeckungen hervor. Jemand beginnt zu reden und mit einem Mal tauschen sich die Verstorbenen in der Leichenhalle von Los Angeles über ihre Todesursachen aus. Einer von ihnen ist Joe Gillis, ein Drehbuchschreiber, offensichtlich deutlich vor seiner Zeit verblichen, da ihn der damals Anfang dreißigjährige William Holden verkörpert. Gillis’ Geschichte beginnt damit, wie er den Sunset Boulevard hinabfährt.
Das ist das Intro von „Sunset Blvd.“, das es gar nicht gegeben hat. Denn das Testpublikum zweier Previews brach dabei jedes Mal in schallendes Gelächter aus, was dem im Kern finsteren Drama eine völlig andere Richtung gab; viele hielten das spätere Meisterwerk am Ende für totalen Quatsch – Billy Wilder, der Regisseur und Co-Autor des Films, war am Boden zerstört. So änderte er den Anfang und ließ William Holden per Voiceover aus dem Off – in diesem Fall sogar dem Jenseits – sprechen, während die Leiche seiner Filmfigur in einem Pool treibt und von Polizisten aus dem Wasser gefischt wird. Die Anfangsszene mit der Leiche im Pool geriet dann schnell zum markanten Merkmal des Films und gilt längst als dramaturgischer Coup. An ihr lässt sich auch die Bedeutung der ersten Szene ermessen – denn hier lachte keiner mehr.
Dieses alternative Intro von „Sunset Blvd.“ ist inzwischen legendär: Mit bedrohlichen Orchesterklängen schwenkt die Kamera langsam herab auf einen Bordstein, auf dem in weißer Schrift mit fetten Lettern „Sunset Blvd.“ geschrieben steht. Dann schwebt sie, völlig ohne Schnitt, über den Asphalt, während der Cast eingeblendet wird; sie schwebt rückwärts, als würde man einen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit vollführen. Als sie dann wieder aufblickt, erstreckt sich eine Straße, an deren Horizont sich gleißende Scheinwerfer abzeichnen; dann Sirenengeheul, eine Polizeikolonne rast um fünf Uhr morgens den Sunset Boulevard in Los Angeles hinab. Aus dem Off spricht die Stimme eines Mannes; er erzählt von seiner eigenen Ermordung, während die Leiche ebenjenes Mannes im Pool einer Villa treibt (eine raffinierte Einstellung, für die Wilder viel Aufwand betreiben ließ). William Holden, bald darauf eines der berühmtesten Filmgesichter der Fünfziger, später aber auch von den tragischen Gesichtszügen eines schweren Alkoholikers gezeichnet, spricht und spielt diese Figur: Joe Gillis, einen von vielen hundert Drehbuchschreiber:innen, die in L.A. ihr Glück (ver-)suchen.
Es gibt Filme, die sind so klug, so wunderbar, so zeitlos, dass man sich noch lange nach dem Abspann daran erfreut. „Sunset Blvd.“ ist so ein Film: Billy Wilder (1906–2002), der schon bald in den Status eines der größten Regisseure aller Zeiten aufrücken würde, am Ende seiner Karriere ein sechsfacher Oscarpreisträger und unbestrittene Hollywoodinstanz, inszenierte diesen Film mit messerscharfem Zynismus gegenüber dem überdrehten Star-System der Traumfabrik mit ihren ambivalenten Mechanismen, die gleichermaßen schöpferisch wie zerstörerisch wirken. „Sunset Blvd.“, der vom (ultimativen) Ende aus erzählte Film, beschreibt Gillis’ Untergang, wie drei Kugeln in ihn gerieten und seinen toten Körper in den Pool schmetterten.
Читать дальше