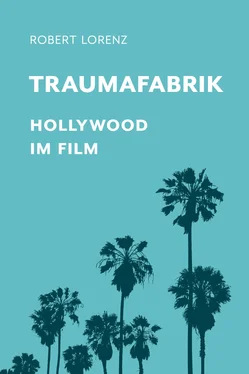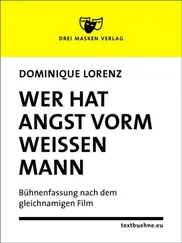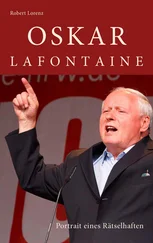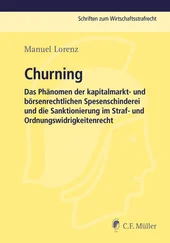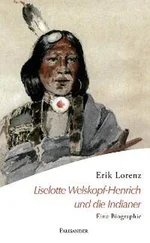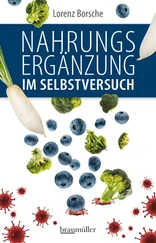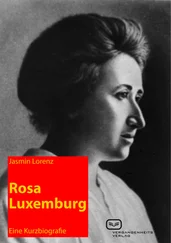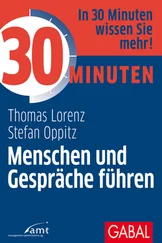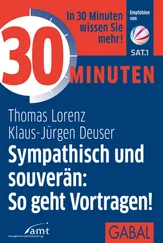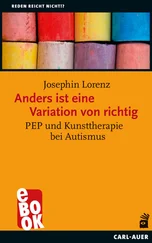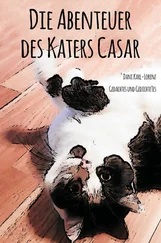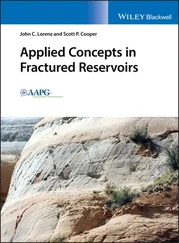„Sunset Blvd.“, der vom (ultimativen) Ende aus erzählte Film, beschreibt Gillis’ Untergang, wie drei Kugeln in ihn gerieten und seinen toten Körper in den Pool schmetterten. Schon einmal hatte Wilder einen Film mit der Voiceover-Rückblende aufgebaut, doch ist im ausgekochten Film noir „Double Indemnity“ (1944) der Versicherungsvertreter Walter Neff (Fred MacMurray), wenn auch angeschossen, noch am Leben, als er mit seiner Erzählung beginnt. Und Jahrzehnte später würde Wilder sie bei einer weiteren Begegnung mit den Abgründen der Filmwelt, in „Fedora“ (1978), wiederholen (abermals mit William Holden als Off-Erzähler). In „Sunset Blvd.“ umfasst die Rückblende ein halbes Jahr. Joe Gillis sitzt in einer der oberen Etagen des „Alto Nido“-Appartementhauses im nördlichen Teil der Ivar Avenue, einem Bau im kalifornisch-spanischen Eklektizismus. Billy Wilder und seine beiden Co-Autoren Charles Brackett und D.M. Marshman Jr. haben Gillis als typische Hollywoodexistenz angelegt und nutzen „Sunset Blvd.“, um darin sporadisch das Mysterium des beim fertigen Film stets unsichtbaren Drehbuchschreibers zu konturieren, einer dem Publikum tendenziell eher unbekannten Figur (an einer Stelle lassen Brackett, Marshman Jr. und Wilder ihren Protagonisten sagen: „Audiences don’t know somebody sits down and writes a picture. They think the actors make it up as they go along.“).
Gillis ist ein Journalist aus Ohio, der wie viele andere Presseleute in die große Filmstadt gekommen ist („Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit.“), aber bloß auf der Stelle tritt. Sein Leben besteht aus dem unablässigen Schreiben von Geschichten, „that may sell and very possible will not“. Seit geraumer Zeit ist er keines seiner Skripte mehr an ein Studio losgeworden und nun sitzen ihm Geldeintreiber (Larry J. Blake und Charles Dayton) im Nacken, die sein Plymouth Cabriolet abschleppen wollen – seit Monaten ist Gillis mit den Raten im Rückstand. Sein wohlsituierter Agent (Lloyd Gough), den Gillis auf dem Golfplatz anpumpt, will ihm kein Geld leihen, da doch die besten Stoffe mit leerem Magen entständen; dabei rekurriert er auf die teuren Sündentempel und Genussstätten der Reichen und Schönen: „Once a talent like yours gets into that Mocambo-Romanoff rut, you’re through.“
Bei Paramount – für das Wilder „Sunset Blvd.“ drehte – gewährt einer der Produzenten (Fred Clark) – „a smart producer, with a set of ulcers to prove it“ – Gillis schließlich einen Fünf-Minuten-Pitch. Als die Frau aus der Drehbuchabteilung, Betty Schaefer (Nancy Olson), sein Skript für schlecht befindet, belächelt Gillis sie als eines dieser „message kids“, denen eine Handlung allein nicht genüge.
Auch Betty Schaefer dient neben Gillis als Repräsentantin der Heerscharen in den Drehbuchabteilungen der Studios. Gillis: „She was so like all of us writers when we first hit Hollywood, itching with ambition, planning to get your names up there. ‚Screenplay by‘, ‚Original Story by.‘“ Die 22-jährige Skriptleserin bei Paramount ist quasi im Studio aufgewachsen, wo ihre Eltern gearbeitet haben, der Vater als Elektriker, die Mutter in der Garderobe. Zehn Jahre lang nahm sie Schauspiel-, Sprech- und Tanzunterricht, und als dann bei ihrem Screentest die Nase nicht gefiel, da ließ sie sich für 300 Dollar operieren – aber genommen hat man sie trotzdem nicht.
Betty Schaefer verkörpert damit die kleine Hollywoodexistenz zu Karrierebeginn, als sie sich noch die Miete mit einer Zimmernachbarin teilt und voller Elan an ihrem beruflichen Fortkommen arbeitet. Angeblich hat sie Wilder an seine zweite Ehefrau Audrey angelehnt, deren Mutter in der Columbia-Schneiderei gearbeitet hatte und deren Vater Setbauer war, weshalb sie von Kindesbeinen an den Studiobetrieb verinnerlichte und später unbedingt in der Filmbranche arbeiten wollte (ihr gelangen am Ende einige kleine Auftritte).
Neben der Prekarität des Drehbuchschreibens zeigen Brackett, Marshman Jr. und Wilder auch einen der zentralen Lebensräume dieser Hollywoodspezies: „Schwab’s Pharmacy“ am Sunset Boulevard, eine Art Apotheke mit Tabakladen und Bistro, von den zahllosen Drehbuchleuten, die dort Zuflucht suchten, liebevoll „headquarters“ genannt, ein Ort voller Legenden: Der „The Great Gatsby“-Autor F. Scott Fitzgerald erlitt dort einen Herzinfarkt, Harold Arlen schrieb darin auf einer Serviette die Melodie für „Over the Rainbow“ und Lana Turner sei dort beim Genuss einer Limonade entdeckt worden (was gar nicht stimmte, aber die Legendenkraft des Geschäfts beweist). Und sie zeigen die Machtlosigkeit der Autor:innen über das eigene Material, sobald es erst einmal in Studiohänden ist und die Dreharbeiten beginnen (oder wie der Regisseur John Huston einmal sagte: „when the picture went on the floor, that was the end of the writer“ [John Huston zit. nach Ford, Dan: A Talk with John Huston (1972), in: Long, Robert Emmet (Hg.): John Huston: Interviews, Jackson 2001, S. 21–29, hier S. 26]). An einer Stelle sagt Gillis über seine Arbeit: „Last one I wrote was about Okies in the Dust Bowl. You’d never know it, because when it reached the screen, the whole thing played on a torpedo boat.“ In dieser Überspitzung steckt viel von Wilders eigenem Verdruss ob des Kontrollverlustes über sein Werk, der den Drehbuchautor einst von der Schreibstube auf den Regiestuhl trieb, in der Absicht (und Hoffnung), nun selbst für die originalgetreue Umsetzung seiner Skripte sorgen zu können.
Als ihm dann endgültig sein Geld ausgeht und Gillis über eine Rückkehr nach Ohio, an seinen alten Schreibtisch bei der Dayton Evening Post, nachdenkt, erwischen ihn die Inkassoleute an einer Straßenkreuzung und setzen zur Verfolgung an. Während seiner Fluchtfahrt auf dem Sunset Boulevard platzt Gillis ein Reifen und er biegt flugs in die nächste Einfahrt ein, seine ahnungslosen Verfolger rauschen an ihm vorbei. Am Ende der Auffahrt des fremden Grundstücks steht ein Garagengebäude mit mehreren Stellplätzen, in dem Gillis sein Fahrzeug versteckt. Wie ein entflohener Häftling tastet er sich voran, als beträte er eine andere Wirklichkeit. „It was a great big white elephant of a place. The kind crazy movie people built in the crazy twenties.“ Das Nummernschild der aufgebockten Luxuskarosse, neben der Gillis in der riesigen Garage seinen Wagen abgestellt hat, datiert von 1932. Gillis’ sarkastische Beschreibung entpuppt sich unversehens als Realität. Bei der Erkundung des spektakulären Anwesens trifft er auf die Eigentümerin: Norma Desmond (Gloria Swanson), eine Frau in ihren Fünfzigern, vergessene Stummfilm-Queen, einst der größte Star der Welt. Sie verwechselt ihn mit dem Sargbauer, denn sie trägt gerade ihren Affen zu Grabe – das exotische Tier als Accessoire der Diva; und natürlich eine Allegorie der morbiden Atmosphäre, die in Desmonds egozentrischem Kleinuniversum vorherrscht. Die Hausherrin wünscht einen weißen Sarg mit Seidenpolsterung.
Das ganze Haus der Desmond ist ein narzisstisches Museum ihrer selbst: In extravaganter Pose wirft sie sich auf ihr Seidenplüschsofa, das von lauter kleinen Desmond-Porträts umgeben ist. Ihre Vision, wieder vor die Kamera zurückzukehren, hat sich längst zur größenwahnsinnigen Obsession gesteigert: Besessen von dem Gedanken, erneut die Spitze Hollywoods zu erklimmen und damit einem mutmaßlichen Publikumsbedürfnis nachzukommen, schreibt sie an einem Skript zu dem Film, in dem sie die mythische Salome spielen will und der ihr sensationelles Comeback vollbringen soll. Doch ist ihr das Wort „Comeback“ verhasst, sie bevorzugt „return“.
Als sie erfährt, dass Gillis professioneller Drehbuchautor ist, will sie ihn engagieren, damit er ihr bei der Fertigstellung ihres wahnwitzigen Projekts hilft, das sich in zusammengebundenen Papierstapeln auf ihrem Schreibtisch bereits als langwierige Angelegenheit manifestiert. Der völlig abgebrannte Autor blufft und gibt sich der Desmond gegenüber als viel beschäftigter und selbstverständlich hochpreisiger Mann aus, wissend, dass sie ihn in ihrer Eitelkeit und Not trotzdem anheuern wird. Ihre versteckte Verzweiflung zeigt sich auch daran, dass sie noch am nächsten Tag längst weiß, dass Gillis völlig mittellos ist, da sie eigenmächtig seine Schulden bezahlt und seine Habseligkeiten in ihr Haus beordert hat; zugleich weiß sie in diesem Moment, dass er käuflich und seinerseits von ihr abhängig ist.
Читать дальше