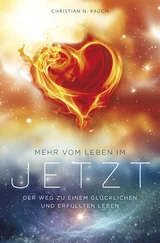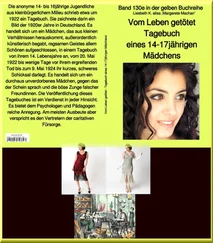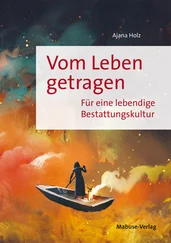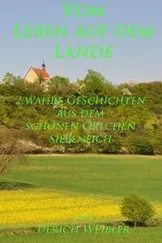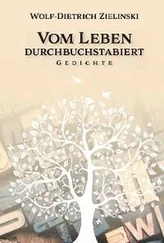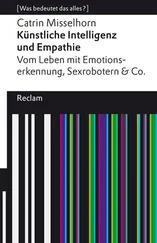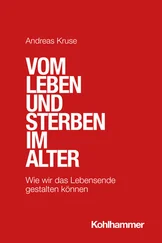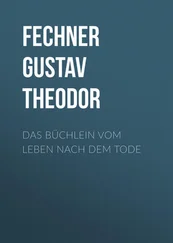Selten hören Menschen von der Krankheit „Hypoplastisches Linksherzsyndrom“ (HLHS). Dieser angeborene Herzfehler, bei dem die linke Herzseite verkümmert entwickelt ist, ist einer der schwersten, der Patient*innen ihr ganzes Leben lang begleitet. Wenn man davon ausgeht, dass in Deutschland 1% aller Neugeborenen mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt kommen - damit eine der häufigsten Fehlbildungen darstellen - und HLHS davon wiederum etwas mehr als 1% ausmacht, mag das zwar wenig klingen, aber die Bedeutung, die Anstrengung, das Leiden und die Höhen und Tiefen eines von (vor) der Geburt an bestimmten Lebens mit dieser Krankheit ist damit letztlich nur auf eine Zahl und einen Begriff minimiert. Patient*innen mit HLHS können nur palliativ behandelt und niemals je geheilt werden. Ein Mensch muss, einfach gesprochen, mit nur einem halben Herz und einem geänderten Herz-Lungen-Kreislauf überleben, der in normalerweise drei Operationen herbeigeführt wird. Was all das bedeutet, können wohl Eltern und Angehörige sowie Patient*innen selbst am besten wiedergeben; vielleicht auch gerade nicht, weil Sprache dabei oft an ihre Grenzen gerät. Selbst mit dem Wort Krankheit empfinde ich eine unzureichende Beschreibung dieses Umstands, da er wohl stark mit Husten oder Schnupfen konnotiert ist. Als „Hypoplast“ ist man, in meinen Augen, krank, aber irgendwie ganz anders krank; eben nicht nur leicht angeschlagen, sondern unheilbar krank. Als „Hypoplast“ gilt man als chronisch krank, teilweise schwer behindert. Denn von Geburt an verläuft das Leben ganz anders. Chronisch krank zu sein: Dafür gibt es vielleicht einen Lexikon-Eintrag, doch abertausende von Geschichten. Wir kannten die Diagnose HLHS bei Leonie bereits in der 18. Schwangerschaftswoche, doch kaum etwas hätte diese unbeschwerte Zeit trüben können; solange wie Leonie in meinem Bauch war, war sie gut versorgt. Ich bin überzeugt davon, dass mein vorgeburtlicher Umgang mit Leonies Krankheit ihr ein zusätzliches Stück Stärke geschenkt hat. Natürlich gab es Momente, in denen ich betrübt war, Tränen vergoss, am Telefon mit meinem Vater ein paar Sekunden, Minuten Stille herrschte, weil ich versuchte mich und die Unfassbarkeit irgendwie zu be herrschen . Ich hatte eine „Stärke-Kerze“ für Leonie gekauft, die ich täglich, oft morgens in ruhigen Stunden anzündete; davor saß eine kleine meditierende Figur. Ich habe stets versucht, Leonie Kraft zu übertragen, ihr und mir Mut zu machen - in Worten und Berührungen. Ich finde, wir haben das auf eine ganz besondere Art geschafft. So verliefen auch die vielen Ultraschallkontrollen nicht unbedingt beängstigend; die Ärzte machten uns immer wieder und vielleicht auch mehr Hoffnung, dass sich das Herz doch noch stärker entwickle und die linke unterentwickelte Herzhälfte mitwachse. Dass eine Untersuchung über Ultraschall aber weder einen Zustand so festhalten noch die Lebenswirklichkeit des Kindes außerhalb des Mutterleibs diagnostizieren kann, haben wir später eingesehen.
Meine Tochter kam mit diesem Herzfehler zur Welt, wurde mit nur einer Lebenswoche das erste Mal am offenen Herzen operiert; mit viereinhalb Monaten ein zweites Mal. Dazwischen fanden gefühlt unzählige Herzkatheter und monatelange Krankenhausaufenthalte statt. Über die Hälfte ihres Lebens verbrachten wir in der Klinik. Ich lernte Abläufe und Stationen, Ärzt*innen und Personal kennen und „Kardiologie“ wurde zu einer Herzensangelegenheit . Trotzdem ist dieser Ort für mich nie zu so etwas wie einer zweiten oder dritten Heimat geworden. Dass diese Krankheit auch in den ersten Lebensmonaten tödlich enden kann, hatte ich mir eigentlich während der Zeit nie ausgemalt. Schließlich werden ja Kinder mit planmäßig drei Operationen auf ein Leben mit einem halben Herz vorbereitet. Es sei ein Leben mit Einschränkungen, aber Patient*innen könnten ein gutes Leben führen. Ja, es war eine gewisse Naivität, eine notwendige Abgrenzung von all den Strapazen, die man sich im Vorfeld schon anlesen und anhören, ansehen und an sich heranlassen konnte. Doch neben der Aufgabe, das erste Kind auf die Welt zu bringen und für es da zu sein, stand eine zweite große, die ich als ein Fertigwerden mit der Krankheit bezeichnen würde. Es standen sich zwei Welten gegenüber, eine normale - Mutter bzw. Eltern sein, ein Kind zu stillen, zu wickeln, zu beruhigen, … - und eine andere normale - Klinikaufenthalte, das eigene Kind nicht im Arm halten zu können, weil es über Schläuche mit Maschinen verbunden war, die ein Überleben garantieren sollten. Ich nahm vieles anfangs einfach so hin. Ich fügte mich den Routinen auf einer Intensivstation. Ich war für meine Tochter da, so viel es ging. Vielleicht war dieser Umgang gerade richtig. Manchmal habe ich immer noch Zweifel daran. Wie naiv ich doch war, wie vorsichtig auch. Aber: es war ein intuitiver Umgang, der keineswegs auch nur annähernd falsch war. Leonie und ich stellten uns aufeinander ein, wir bauten eine Beziehung auf, auch wenn sie nicht zu Hause in einer vertrauten Umgebung begann. Wir mussten uns regelrecht gegen Maschinen, viele unbekannte Menschen, die Leonie als Patientin, nicht als zu liebendes Kind sahen, gegen schmerzvolle Eingriffe und Angriffe menschlicher wie maschineller Art durchsetzen. Das kostete jeden Einzelnen unserer kleinen neuen Familie viel Nerven und Überwindung.
Zwischen Klinik, zu Hause und Kinderarzt
Die ersten vier Wochen nach Leonies Geburt verbrachten wir, ja auf den Tag genau, in der Klinik. Wie ich diese Zeit rückblickend empfand? Die Neuheit, das Ungewohnte an der Situation waren zunächst noch sehr bestimmend und vereinnahmend. Ich tat vieles, was ich tun musste, mir gesagt wurde. Zeit für Rückbildung und Ruhe war weniger gegeben bzw. nahm ich sie mir nicht in dem Maße, in dem es normal gewesen wäre. Über Normalität zerbrach ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht den Kopf. Der nicht nur körperliche, sondern auch psychische Stress sorgte dann auch dafür, dass mein Körper anzeigte, es sei ihm gerade zu viel, Milchstau und Brustentzündung mit Fieber, höllische Nackenschmerzen, die mich nachts schlaflos und glauben machten, ich hätte eine unheilbare Entzündung im ganzen Körper. Zu viert bzw. zu acht - vier Säuglinge und bis zu vier Mütter - in einem Raum auf der Kinderkardiologischen Station, überwacht von Monitoren und den Eintritten der Schwestern, die abwechselnd Windeln, Milchflaschen und Medikamente brachten. Gelegen, also passend, ging wohl nur selten die Tür auf und zu. Ebenso selten wie alle Kinder gleichzeitig ruhig und zufrieden waren. Die Station, auf die man mit seinem Kind nach der Intensivstation verlegt wurde, nannte sich umgangssprachlich „Normalstation“, aber normal war ein Tag dort keineswegs. Es gab daneben auch sehr heilvolle, wenn auch aufregende Momente: der erste „Ausgang“ mit Leonie im Kinderwagen. Sie hatte die ersten drei Wochen ihres Lebens nie ihre Umwelt draußen kennengelernt. Gelb gestrichene Klinikzimmer, sauber gefilterte und regulierte Luft durch die Klimaanlage auf der Intensivstation, Licht und Schatten, die durch die Jalousien reguliert wurden, wiederkehrende Stimmen des Personals und Pieptöne der Maschinen. Daneben ein Lächeln, ein Grinsen aus Leonies Gesicht. Und später der Entlassungsbericht. Trotz der Überforderung und Panik, die ich an diesem Tag empfand, gab es wohl nichts Schöneres, mit Leonie nach Hause zu fahren und uns dort langsam einzurichten.
Die regelmäßigen Untersuchungen und Impfungen beim Kinderarzt begleiteten unseren Alltag genauso wie die Medikamentengaben, unruhige Nächte, täglich penible Einträge in Leonies „Tagebuch“ zum Stillen, Wickeln, Wiegen und ihren Aktivitäten. Auch wenn Ängste oder Sorgen dabei gar nicht immer meine Begleiterinnen waren und meine Gedanken bestimmten, war es doch keine ruhige und entspannte Zeit. Kaum blieben mir ruhige Stunden für mich. Natürlich ist auch das Leben mit dem ersten gesunden Kind nicht immer nur entspannt und bleibt die Mutter auch einmal im Schlafanzug und ohne die Haare gewaschen zu haben. Doch diese innere Gewissheit, bald wieder in die Normalität zurückzukehren, wird schon bald die aufgebrachten Meereswellen beruhigen und eine gewisse Gelassenheit herbeiführen. Nie habe ich mich an die Besuche beim Kardiologen gewöhnt, weil es eine so derart angespannte und unangenehme Situation war: Ich sah mein Kind nicht gern leiden, schreien, sich aufregen. Jede Berührung, jeder Ultraschall waren für Leonie eine Qual. Mir brach es das Herz. Auch die Metaphern der Ärzte, mit denen sie Leonies Zustand beschrieben, waren da wenig bestärkend. Ihr Herz sei ein rohes Ei ; es bliebe ein Ritt auf der Rasierklinge . Sprache kann sehr starke Emotionen auslösen, ohne dass man solche Bilder bis ins Kleinste aufspaltet und interpretiert. Die Worte und Diagnosen der Ärzte haben oft gesessen, mich getroffen. Und doch, zu Hause zu sein, mit Leonie „nichts“ zu tun, ihr und mir Ruhe zu schenken, sie zu beruhigen, ihr die Welt im Kleinen zu erklären, spazieren zu gehen - das überwand gefühlt so viele Steine und Berge.
Читать дальше