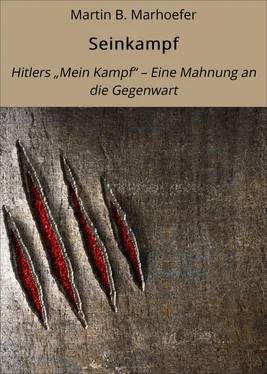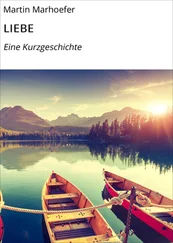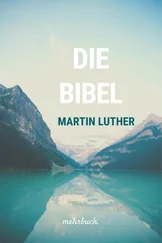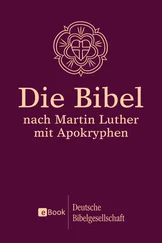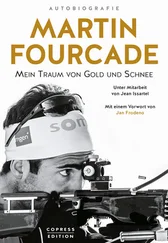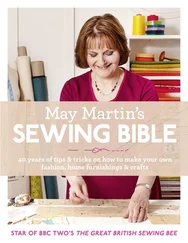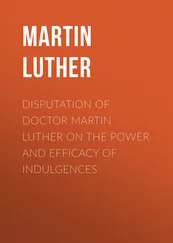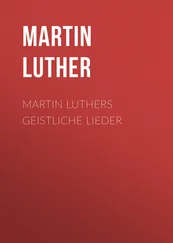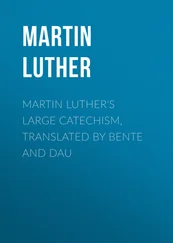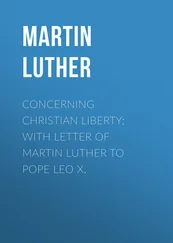Als Hilfsarbeiter schlug Hitler sich in Wien durch, hungerte manchmal, wohnte im Männerwohnheim und tat sich ob seines Schicksals selbst leid. Auch diese Erfahrung führte zu der Bildung einer Weltanschauung, die die Welt später erschauern ließ.
Mit dem Zeichnen von Aquarellen verdiente er sich selbstständig etwas Geld. Dies verschaffte ihm die Zeit, um sich wiederum dem Studium von Büchern und vor allem der Baukunst zu widmen. In diesen Jahren (1909 und 1910) war er überzeugt sich „dereinst als Baumeister einen Namen zu machen“. Darüber hinaus interessierte er sich für Politik, was in seinen Augen „die selbstverständliche Pflicht jedes denkenden Menschen überhaupt“ war. In diesem Sinne setzte er sich auch mit der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften auseinander. Er begriff die „Gewerkschaft als Instrument der Partei des politischen Klassenkampfes“. Er erkannte allerdings auch an, dass sie „als Mittel zur Verteidigung allgemeiner sozialer Rechte des Arbeitnehmers und zur Erkämpfung besserer Lebensbedingungen desselben...“ ihre Berechtigung hatte. Er vertrat die Auffassung, dass „durch unwürdige Unternehmer, die sich nicht als Glied der ganzen Volksgemeinschaft fühlen... aus dem üblen Wirken ihrer Habsucht und Rücksichtslosigkeit tiefe Schäden für die Zukunft erwachsen“.
Ein durchaus sozialer Ansatz, an den er sich möglicherweise in den ersten Jahren seiner späteren Herrschaft erinnerte. Ihm war bewusst, dass er das Volk nur manipulieren konnte, wenn es die Vorteile, die seine Machtübernahme haben sollte, erkannte und spürte. Ein Ansinnen aller autokratischen Gewaltherrscher. Er schaffte es ab 1933, die hohe Arbeitslosigkeit und das Elend der Jahre der Weimarer Republik binnen kurzer Zeit zu eliminieren. Der Preis dafür war noch unbekannt. Es ging aufwärts mit Deutschland. Nicht nur wirtschaftlich, auch psychologisch vermittelte Hitler dem Volk einen neuen Nationalstolz. Die durch den verlorenen ersten Weltkrieg und den Vertrag von Versailles geschundene deutsche Seele durfte sich wieder alter Größe bewusst werden. Arbeit, Wohlstand, Stolz und Gemeinschaft sind wichtige manipulatorische Instrumente der Autokratie. Sie waren unabdingbare Voraussetzungen für die breite Akzeptanz des Hitlerregimes. Dass dieses das deutsche Volk innerhalb weniger Jahre in den Abgrund führen würde, ahnten manche. Die Mehrheit aber wollte davon nichts wissen, wobei nicht vergessen werden darf, dass nicht nur Brot und Spiele das Volk besänftigten, sondern brutale Gewalt gegen Andersdenkende jeglichen Widerstand lebensgefährlich erscheinen ließ. Auch dies ist ein zentrales Instrument autokratischer Herrschaft. Das, als eines der ersten, bereits am 22. März 1933, also wenige Wochen nach der Machtübernahme, in einer ehemaligen Pulverfabrik in Dachau eröffnete Konzentrationslager gibt darüber Zeugnis.
Hitlers Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie gipfelte in der Aussage: „Nur die Kenntnis des Judentums allein bietet den Schlüssel zum Erfassen der inneren und damit wirklichen Absichten der Sozialdemokratie“. Belege für eine solche Behauptung lieferte Hitler freilich nicht.
Im Folgenden befasste sich Hitler mit der „Judenfrage“.
Da er zu einem krankhaften, besessenen Judenhasser wurde, ist die Frage, wann dieser Hass entstand, spannend. Es ist aber nicht einfach, die Entstehungsgeschichte dieser Ideologie lückenlos zu verfolgen. Hitler selbst schrieb, dass es in seinem Elternhaus keinen Antisemitismus gab. Bis zu seinem Umzug nach Wien wäre er mit dem Thema Judentum kaum in Berührung gekommen. Zunächst sah er „im Juden nur die Konfession und hielt deshalb aus Gründen menschlicher Toleranz die Ablehnung religiöser Bekämpfung auch in diesem Falle aufrecht“.
Hitler begann sich mit der Wiener Presse zu beschäftigen. Wie die großen Zeitungen „den Hof umbuhlten“ und „süße Lobeshymnen auf die ‚große Kulturnation’“ verbreiteten, stieß ihn ab. Bei der Kulturnation handelte es sich übrigens um Frankreich. Man bekommt fast den Eindruck, dass er ob dieser nervenden Presse regelrecht ungewollt zur antisemitischen Zeitung „Deutsches Volksblatt“ getrieben wurde. Er machte nun die „schwerste Wandlung überhaupt“ durch.
„...erst nach monatelangem Ringen zwischen Verstand und Gefühl begann der Sieg sich auf die Seite des Verstandes zu schlagen. Zwei Jahre später war das Gefühl dem Verstande gefolgt, um von nun an dessen treuester Wächter und Warner zu sein“.
Mit diesen schwülstigen Worten war Hitler zum Antisemiten geworden.
Von nun an, so schrieb er, ging er nicht mehr blind durch Wien oder schaute sich nur die Bauten an, sondern besah sich auch die Menschen. So stieß er angeblich zum ersten Mal auf „eine Erscheinung in langem Kaftan mit schwarzen Locken. Ist dies auch ein Jude? war mein erster Gedanke. So sahen sie freilich in Linz nicht aus“. Und weiter: „Ist dies auch ein Deutscher?“
Er sichtete weiterhin antisemitische Pamphlete und gab vor, dass „die Bezichtigung so maßlos sei, dass ich, gequält von der Furcht, Unrecht zu tun, wieder ängstlich und unsicher wurde“. Dieser Zynismus schmerzt beim Lesen.
Zu einer Erkenntnis kam er dennoch ohne schlechtes Gewissen. Nämlich „dass es sich hier nicht um Deutsche einer besonderen Konfession handelte, sondern um ein Volk für sich“. Er verstieg sich nun in Abscheu bis hin zu Ekel. Auf Zitierung dieser Stellen des UnBuches wird verzichtet. Die Menschenverachtung ist unerträglich.
Plötzlich sah Hitler die Welt mit den Augen des Verschwörungstheoretikers. Er hatte einen Sündenbock gefunden. Laut einer einfachen Formel hatte nun alles Schlechte und Böse einen Ursprung. Er steigerte sich in einen Hass, den er später grausam auslebte.
Eine weitere abstruse Einsicht verschaffte ihm große Befriedigung:
„Indem ich den Juden als Führer der Sozialdemokratie erkannte, begann es mir wie Schuppen von den Augen zu fallen“.
So schaffte er für sich die Verbindung von Marxismus und Judentum.
Soweit die Ausführungen von Hitler selbst zu seiner Wandlung zum Judenhasser. Laut Kershaw gibt es aber keine verlässliche zeitgenössische Bestätigung, dass diese tatsächlich während seines Aufenthaltes in Wien stattfand. Mit dieser Weltanschauung hätte er seinen Kameraden im 1. Weltkrieg auffallen müssen. Diese konnten sich jedoch nicht an antisemitische Aussagen von Hitler erinnern. Man vermutet daher, dass sein krankhafter Judenhass erst nach dem verloren gegangenen ersten Weltkrieg entstand. Hitler wollte sich als Anführer der nationalistischen Bewegung aber den Anschein einer ausgereiften Weltanschauung geben. Da hätte es nicht gepasst, wenn er erst kurz zuvor zum Antisemiten geworden wäre. Die Wandlung in Zeiten vor dem Krieg, in seiner Adoleszenz in Wien, mag ihm adäquater erschienen sein. Er schrieb dies nach dem Putsch und seiner Verhaftung nieder. Insofern darf das UnBuch als Propagandaschrift in eigener Sache angesehen werden.
Wie auch immer, er pflegte fortan seinen Hass auf Juden.
„Ich war vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden“.
Bislang war von der Ausrottung der Juden noch keine Rede. Die so genannte „Endlösung“ ist viel später entstanden.
Die Vernichtung der Juden war zentrales Element seiner Ideologie und Politik. Über eine mögliche ‚Methode’ ließ er sich hier nicht aus.
Da der extreme Judenhass unmittelbar mit der Person Hitlers verbunden war, soll hier näher darauf eingegangen werden. Die Vernichtung kündigte er bereits in „Mein Kampf“ an. Die Art und Weise jedoch nicht. Vernichtung hätte Entfernung der Juden aus Europa bedeuten können im Sinne einer Deportation. Diese Überlegungen gab es später. Aber auch die konsequente Ermordung hätte den gewünschten Effekt gebracht. Skrupel bestanden ohnehin nicht.
Zunächst wurden durch die Nürnberger Gesetze die Juden von den Deutschen getrennt, was laut Kershaw von den einfachen Deutschen durchaus mitgetragen wurde. Nur die offene Gewalt gegen Juden wurde missbilligt. Somit erzeugte man eine judenfeindliche Stimmung im Volk, worauf viele Juden das Land verließen, sofern sie es sich leisten konnten. Aber nicht nur die allgemeine Volksstimmung trieb sie dazu, sondern auch die Gewalttätigkeiten des Mobs. Jeder, der Juden diskriminierte, arbeitete „dem Führer entgegen“ (Kershaw) und konnte mit Vergünstigungen rechnen. Aber auch andere ethnische und gesellschaftliche Minderheiten wurden zunehmend verfolgt, was insbesondere die Gestapo forcierte. Die Auswirkungen der Judendiskriminierung drückten sich auch in Wirtschaftszahlen aus: „Anfang 1933 hatte es etwa 50 000 jüdische Unternehmen in Deutschland gegeben. Im Juli 1938 waren davon nur noch 9000 Firmen übrig. Der große Vorstoß zum Ausschluss der Juden aus dem Wirtschaftleben erfolgte zwischen Frühjahr und Herbst 1938.“ (Kershaw)
Читать дальше